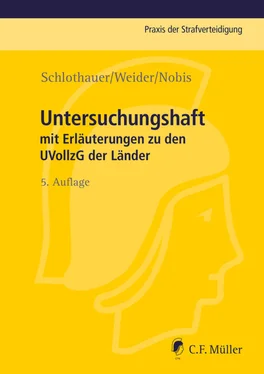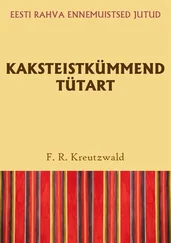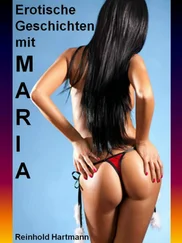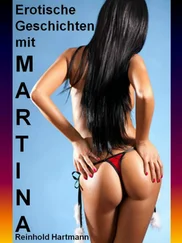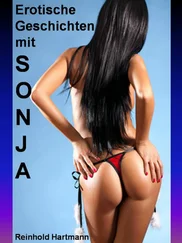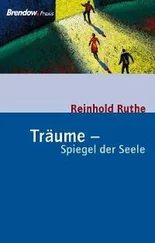22
Dabei sollte sich der Verteidiger ausreichend Zeit für die Besprechungen mit dem Mandanten nehmen. Gefangene berichten immer wieder, ihr Verteidiger habe in kurzer Zeit mit 10, 20 oder mehr Mandanten gesprochen, wobei sich die einzelnen Gespräche auf Begrüßungsfloskeln, „wie gehtʼs“, „gibt es bei Ihnen was Neues?“, „Im Verfahren gibt es nichts Neues, ich kümmere mich darum“ beschränken. Die einzelnen Gespräche dauern nach den Berichten der Gefangenen oft weniger als 5 Minuten. Es ist selbstverständlich, dass sich die Mandanten bei einer derartigen Vorgehensweise nicht ernst genommen fühlen und die Tendenz zum Verteidigerwechsel entwickeln. Trotz aller zeitlichen Probleme muss der Verteidiger das Gesprächs- und Mitteilungsbedürfnis des Mandanten ernst nehmen, auch wenn ihm die Gespräche als überflüssig und als Zeitverschwendung erscheinen. Bei der Abwägung zwischen den eigenen zeitlichen Möglichkeiten und dem Interesse des Mandanten am Gespräch mit seinem Verteidiger muss der Verteidiger stets vor Augen haben, dass er den Mandanten durch eine schnelle „Abfertigung“ nicht auch noch selbst zum bloßen Objekt herabwürdigt.
23
Ist der Verteidiger etwa im Hinblick auf anderweitige große Arbeitsbelastung nicht in der Lage, diese zusätzlichen Anforderungenzu erfüllen sollte er das Mandat nicht übernehmenund die Sache lieber an einen Kollegen abgeben. Auch finanzieller Druck sollte den Verteidiger nicht dazu verleiten, ein Mandat zu übernehmen, dessen Anforderungen er nicht in vollem Umfange gewachsen ist. Die Abgabe des Mandats an einen Kollegen zahlt sich allemal für den Mandanten und ihn selbst mehr aus. Der Kollege, der das Mandat übernommen hat, wird sich bei Gelegenheit „erkenntlich“ zeigen und dem Verteidiger die Übernahme eines anderen Falles anbieten, so dass der Verteidiger in einer dann vielleicht entspannteren Arbeitssituation die Möglichkeit hat, dieses Mandat mit voller Kraft wahrzunehmen.
[1]
Strafrechtsausschuss der Bundesrechtsanwaltskammer Thesen zur Strafverteidigung, S. 13, 73 f.
Teil 1 Einleitung› IV. Überlegungen zur Mandatsübernahme› 2. Besonderheiten bei nicht deutschsprachigen Ausländern
2. Besonderheiten bei nicht deutschsprachigen Ausländern
24
Besonders arbeitsintensivsind Mandate mit nicht deutschsprachigen Ausländern.[1] Diese bedürfen zunächst hinsichtlich der Haftbedingungen besonderer Betreuung, da sie mangels Verständigungsmöglichkeiten oft nicht in der Lage sind, selbst Anträge oder Anliegen zu schreiben oder ihre Wünsche und Bedürfnisse auch nur dem Sozialarbeiter oder dem Stationsbeamten mitzuteilen. Auch können sie sich mangels Verständigungsmöglichkeit oft nicht bei anderen Gefangenen informieren oder sich von ihnen bei der Formulierung und Weiterleitung ihrer Anliegen helfen lassen. Gerade hier hat der Verteidiger die Pflicht, den Mandanten über die Möglichkeit der Ausgestaltung der Haftbedingungenzu informieren und sich selbst in besonderem Maße darum zu kümmern. Die Frage der konkreten Haftsituation ist bei den regelmäßigen Besuchen anzusprechen, damit umgehend vom Verteidiger interveniert werden kann.
25
Darüber hinaus sind die Besuche auch wegen der notwendigen Übersetzung besonders zeitaufwendig. Jeder Verteidiger sollte sich davor hüten, Akteninhalt und Verteidigungsstrategie mit einem Mandanten zu erörtern, der nicht perfekt deutsch spricht, im Vertrauen darauf, man werde sich schon richtig verstehen. Bei der Besprechung von Akteninhalt, Einlassung und Verteidigungsstrategie kommt es auf Feinheiten, oftmals auf Formulierungen an. Schon die geringsten Missverständnisse können fatale Folgen haben. Im Zweifel muss ein Dolmetscherhinzugezogen werden.
26
Muss wegen Verständigungsschwierigkeiten ein Dolmetscher hinzugezogen werden, muss der Verteidiger großen Wert auf die Auswahl des Dolmetschers legen.[2] Nur die Professionalität des Dolmetschers und die Qualität der Übersetzung gewährleisten die optimale Verteidigungsvorbereitung. Nicht zu unterschätzen sind oftmals auch die jenseits der Übersetzung liegenden Hinweise des Dolmetschers. Nicht selten kann er dem Verteidiger die Gepflogenheiten eines fremden Kulturkreises erklären und damit ein für den Verteidiger ansonsten unverständliches Verhalten des Mandanten erläutern.
27
Die Kosten für die Hinzuziehung eines Dolmetschersim Ermittlungsverfahren oder für Gespräche außerhalb der Hauptverhandlung sind dem Verteidiger zu erstatten und zwar unabhängig davon, ob der Verteidiger als Wahl- oder Pflichtverteidiger tätig wird. §§ 187 Abs. 1-3 GVG, Art. 6 Abs. 3 Buchst. e EMRK räumen dem der Gerichtssprache nicht kundigen Angeklagten (Beschuldigten) unabhängig von seiner finanziellen Lage für das gesamte Strafverfahren und damit auch für vorbereitende Gespräche mit einem Verteidiger einen Anspruch auf unentgeltliche Zuziehung eines Dolmetschers ein, auch wenn kein Fall der notwendigen Verteidigung im Sinne des § 140 oder des Art. 6 Abs. 3 Buchst. c EMRK gegeben ist.“[3] Einer vorherigen Beiordnung des Dolmetschers für die Hinzuziehung zu Gesprächen mit dem Verteidiger oder eines sonstigen Antragsverfahrens bedarf es nicht[4], selbst dann nicht, wenn zusätzlich ein Pflichtverteidiger bestellt ist.[5] Allerdings könnte es zur Vermeidung späteren Streits im Kostenfestsetzungsverfahren sinnvoll sein, die Beiordnung des Dolmetschers zu beantragen bzw. die Hinzuziehung des Dolmetschers vom (Haft-) Richter genehmigen zu lassen.
28
Ferner ist bei ausländischen inhaftierten Mandanten in der Regel mit ausländerrechtlichen Folgesachenzu rechnen.[6] Es ist Praxis vieler Ausländerbehörden, nach Erlass des Haftbefehls die Ausweisung und Abschiebung anzudrohen und Abschiebehaft zu erwirken. Damit stehen zusätzliche Termine und Besprechungen an. Auch die Frage der Ausweisung ist für den Mandanten oft von existenzieller Bedeutung. Ist Abschiebehaftangeordnet, ist diese als sog. Überhaft notiert, so dass in Fällen der Aufhebung des Haftbefehls der Mandant automatisch in Abschiebehaft genommen wird. Allerdings sollte die Anordnung der Abschiebehaft als Überhaft auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben. Sie darf nicht auf Vorrat angeordnet werden.[7] Die ausländerrechtliche Problematik kann hier nicht erörtert werden.[8] Nur ein ganz genereller Hinweis auf einen Gesichtspunkt, der in jedem Fall dringend der Überprüfung bedarf: Wird die Ankündigung der Abschiebung und Ausweisung sowie die Abschiebehaft allein mit der im Haftbefehl vorgeworfenen Straftat begründet, besteht in der Regel ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Strafverfahren und ausländerrechtlichem Verfahren. Wird der Mandant freigesprochen oder der Haftbefehl aufgehoben, wird in der Regel auch der Abschiebehaftbefehl nicht mehr vollstreckt. Allerdings geschieht dies nicht automatisch, da die Ausländerbehörde von der Aufhebung des Haftbefehls zunächst nichts erfährt. Hier muss der Verteidiger unverzüglich Kontakt zur Ausländerbehörde aufnehmen und sie von der Aufhebung des Haftbefehls in Kenntnis setzen. Zusätzlich sind Gericht und Staatsanwaltschaft anzugeben, damit die Ausländerbehörde, falls sie dies für erforderlich hält, dort Rücksprache nehmen kann. Gleichzeitig empfiehlt es sich, Gericht und Staatsanwalt zu bitten, die Ausländerbehörde von der Aufhebung des Haftbefehls zu informieren. Es darf nicht angehen, dass der Mandant nur deswegen länger in Haft bleibt, weil die unverzügliche Information der Ausländerbehörde unterbleibt. Hat sie sich von der Aufhebung des Haftbefehls vergewissert, wird der Mandant auf Anweisung der Ausländerbehörde aus der Abschiebehaft entlassen. Probleme entstehen immer dann, wenn der Haftbefehl erst am späten Nachmittag, insbes. freitags, aufgehoben wird. Zu diesen Zeiten ist bei der Ausländerbehörde niemand mehr zu erreichen, so dass davon ausgegangen werden muss, dass der Mandant nicht am Tage der Aufhebung des Haftbefehls auf freien Fuß gesetzt werden kann. Dies kann erst am Folgetag geschehen; liegt ein Wochenende dazwischen, können fast drei Tage bis zur Entlassung des Mandanten vergehen. Dies ist ein unhaltbarer Zustand, auf dessen Problematik hier nur hingewiesen werden kann.
Читать дальше