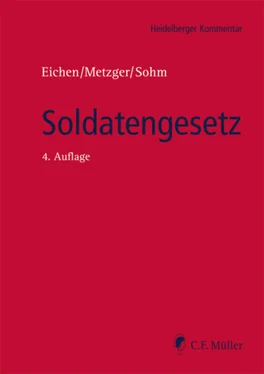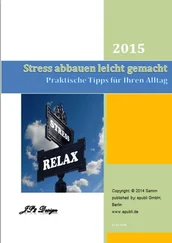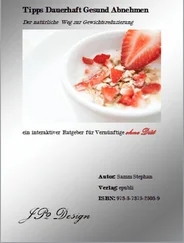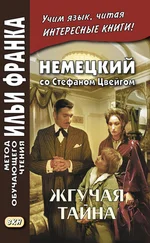ff) Politische Anschauungen
47
Das Verbot der Nichtberücksichtigung polit. Anschauungen beruht auf mehreren Aspekten.
Einerseits soll das Leistungsprinzipentscheidendes Gewicht beim Zugang zu öff. Ämtern und bei förderlichen Maßnahmen im Dienstverhältnis haben, nicht eine Seilschaft zu Fraktionen im BT, einzelnen Abg., Parteien oder parteinahen Organisationen. Dies zielt gegen eine mit dem Schlagwort Ämterpatronage[133] verbundene Personalpolitik im öff. Dienst, die nicht Eignung, Befähigung und Leistung, sondern die systematische Bevorzugung „eigener Leute“ sowie die Benachteiligung polit. anders denkender Personen in den Vordergrund stellt und die – wie bei jedem Regierungswechsel unschwer erkennbar – auch im mil. Bereich weit verbreitet ist. Das mag in einigen wenigen mil. Spitzenpositionen – etwa beim GenInspBw als dem mil. Berater der BReg – oder bei Soldaten in Schaltzentren der Regierungsarbeit – z.B. im Bundeskanzleramt – tragbar sein. Ansonsten ist diese Praxis rechts- und verfassungswidrig. Aus § 50, wonach Berufsoffz auf der Generalsebene jederzeit wie polit. Beamte in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden können, kann nicht gefolgert werden, es sei legitim, die Auswahl der Angehörigen dieser Dienstgradgruppe nicht am Leistungsprinzip, sondern an polit. Zweckmäßigkeitserwägungen zu messen.[134] Es wäre aus Gründen der Einsatzbereitschaft der SK nicht verständlich, wollte man die gesamte mil. Führungsspitze zur Disposition wechselnder Regierungsmehrheiten stellen.[135]
Andererseits soll die Nichtberücksichtigung polit. Anschauungen gewährleisten, dass Soldaten ihre Funktionen parteipolit. neutralausüben. Wer durch polit. Protektion in eine hohe mil. Verwendung gelangt, wird zumindest in der Gefahr sein, nicht zu Gunsten des Dienstherrn, sondern der ihn fördernden Personen und Organisationen zu agieren und wesentliche soldatische Pflichten (z.B. zur Verschwiegenheit) zu verletzen.
Bei leistungsgleichen Bewerbern um eine förderliche Verwendung dürfen polit. Anschauungen als verpöntes Merkmal auch keine Rolle als Stichauswahlkriterium spielen.[136]
Ausnahmsweise können polit. Anschauungen (vor allem bei Bewerbern, die verfassungsfeindliche Tendenzen vertreten) als zulässiges Indiz füreine fehlende Gewähr der Verfassungstreueund damit als Indikator für einen persönlichen Eignungsmangel gewertet werden.[137] Vgl. zur Gewähr künftiger Verfassungstreue als Eignungskriterium die Komm. zu § 37 Rn. 19 ff.
48
Der Begriff „Heimat“ gründet sich auf die „örtliche Herkunft eines Menschen nach Geburt oder Ansässigkeit i.S.d. emotionalen Beziehung zu einem geographisch begrenzten, einzelnen mitprägenden Raum (Ort, Landschaft)“;[138] maßgebend ist die identitätsstiftende Bedeutung der Umgebung während der Kindheit und Jugend.[139] Nach der Rspr. des BVerfG fällt Heimat nicht mit dem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort zusammen;[140] Differenzierungen nach diesen Merkmalen sind deshalb zulässig. Nicht erfasst wird auch die Staatsangehörigkeit als solche.[141] Das Kriterium „Heimat“ sollte vor allem Flüchtlinge, Vertriebene und Umsiedler gegen Diskriminierungen schützen, ohne jedoch praktische Bedeutung erlangt zu haben.[142]
hh) Ethnische oder sonstige Herkunft
49
Über den Begriff „Heimat“ hinaus bezieht sich das Merkmal „ Herkunft“ auf die ständisch-soziale Abstammung und Verwurzelung. Das Merkmal soll die Bevorzugung oder Benachteiligung einer Person wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer sozialen Klasse oder Schicht (z.B. Arbeiterklasse, Adel) verbieten.[143] „Herkunft“ ist deshalb als soziale Herkunft zu verstehen und bezieht sich vor allem auf die soziale Stellung der Eltern, in die jemand hineingeboren wird; nicht erfasst werden soll die gegenwärtige soziale Lebenssituation.[144] Die Begriffe „Heimat“ und „Herkunft“ überschneiden und ergänzen einander nach dem üblichen Sprachgebrauch wechselseitig. Ethnische Herkunft als Unterfall der Herkunft bedeutet Zugehörigkeit zu einer sprachlich[145] und kulturell einheitlichen Volksgruppe. Eine solche Kultur- und Lebensgemeinschaft äußert sich insbes. in gemeinsamer Geschichte, einheitlichen kulturellen Überlieferungen und sozialen Sitten und Gebräuchen. Maßgeblich für Benachteiligungen wegen der ethnischen Herkunft ist, dass die sie prägenden Merkmale wegen ihrer Andersartigkeit zu Vorurteilen führen. Eigene Ethnien sind z.B. Juden, Sinti und Roma sowie nationale ethnische Gruppen wie die Sorben. Die ethnische Herkunft ist ihrerseits eng mit dem ihr untergeordneten Merkmal Rasse verbunden. Während die Rasse insbes. am äußerlich erkennbaren Erscheinungsbild festgemacht wird, ergänzt die ethnische Herkunft das Fremdenbild durch weitere, auch nicht sofort wahrnehmbare, ein Fremdsein begründende Merkmale.[146]
50
Nicht in Art. 33 Abs. 2 GG, sondern in Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG findet sich ein verfassungsrechtl. Verbot der Benachteiligung wegen einer Behinderung. Gleichwohl können sich Bewerberum Einstellung in ein Wehrdienstverhältnis nicht auf diese Vorschrift berufen. Wegen des ebenfalls mit Verfassungsrang ausgestatteten Gebots (Art. 87a Abs. 1 GG) für den Bund, auf einen V-Fall ausgerichtete, einsatzfähige SK aufzustellen, ist die Bw nicht verpflichtet, schwerbehinderte Bewerber für die Einstellung als Soldat zu berücksichtigen. Entspr. sieht europarechtl. z.B. Art. 3 Abs. 4 der RL 2000/78/EG[147] für die Mitgliedstaaten die Möglichkeit vor, „diese Richtlinie hinsichtlich von Diskriminierungen wegen einer Behinderung … nicht für die Streitkräfte“ umzusetzen. Hiervon hat der Gesetzgeber Gebrauch gemacht und das Merkmal der Behinderung weder in den Abs. 1noch in den § 1 Abs. 1 SoldGG einbezogen, sondern Schutz vor Benachteiligung wegen einer Behinderung nur schwerbehinderten Soldaten nach § 1 Abs. 2 Satz 2 SoldGG i.V.m. § 18 SoldGG[148] gewährleistet. Dies geschah wegen des überragenden Erfordernisses der Einsatzbereitschaft und Schlagkraft der SK.[149]
51
In den SK werden mehrere Hundert i.S.d. § 2 Abs. 2 und 3 SGB IX schwerbehinderte Soldaten verwendet. Zu diesem Personenkreis können die Soldaten gehören, zu deren Gunsten § 3 Abs. 2geschaffen worden ist, die ihre körperliche Beeinträchtigung vor allem im Auslandseinsatz erlitten haben. Schwerbehinderte Soldaten können sich neben dem Schutz durch § 18 SoldGG auch – bei Vorliegen der notwendigen tatbestandlichen Voraussetzungen – auf das EinsatzWVG berufen.[150]
d) Dienstl. Beurteilungen[151]
52
Die bei Ernennungen und Verwendungen nach Abs. 1nicht zu berücksichtigenden Kriterien geben i.d.R. klar umrissene Sachverhalte wieder, die relativ leicht zu ermitteln sind. Hingegen sind die Merkmale Eignung, Befähigung und Leistung unbestimmte Rechtsbegriffe, deren Inhalt weitgehend nur durch eine Auslegung ermittelt werden kann. Diese Begriffe (die Eignung im weiteren Sinne) sind verfassungsrechtl. durch Art. 33 Abs. 2 GG vorgegeben. Ihre Inhalte sind teilweise objektiv (z.B. gesetzl. in § 27und in der SLV zur Festlegung der Laufbahnbefähigung) vorgegeben. Darüber hinaus liegt es in der OrgGewalt des Dienstherrn, die Verwendungsmöglichkeiten der Soldaten allg. und abstrakt in Aufgabenkatalogen festzusetzen[152] und die hierzu geforderten Eignungskriterien (Verwendungsprofile) zu bestimmen. Maßgebend sind mil. Zweckmäßigkeitserwägungen des Dienstherrn, die oft in Dienstvorschriften und Erl. zum Ausdruck kommen und allg. die fachl. und persönlichen Anforderungen vorgeben, die generell für die Wahrnehmung mil. Tätigkeiten oder Verwendungen vorausgesetzt werden sollen. Die Zweckmäßigkeit der Festlegung solcher Verwendungsprofile ist gerichtl. nicht überprüfbar.[153] Eine gerichtl. Kontrolle ist nur nach den bei Beurteilungsspielräumen sonst zulässigen Maßstäben[154] rechtl. möglich.
Читать дальше