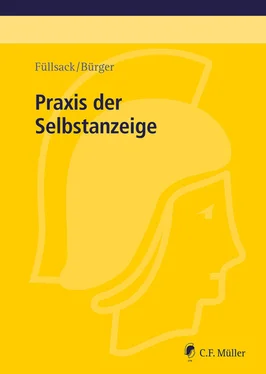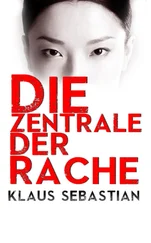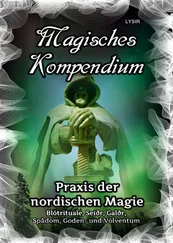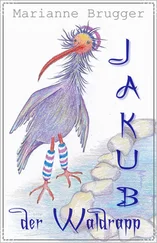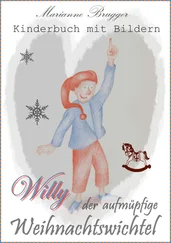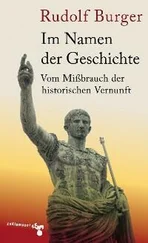Kenntnisse des neuen Selbstanzeigerechts sind nicht nur für ab dem 1.1.2015 eingereichte Selbstanzeigen essentiell. Das neue Recht ist auch von Bedeutung, um die Wirksamkeit einer vor dem 1.1.2015 eingereichten Selbstanzeige prüfen zu können. In Ermangelung einer Regelung des zeitlichen Anwendungsbereichs der Neuregelung ist nach § 2 Abs. 3 StGBdas im konkreten Einzelfall[9] für den Anzeigenden günstigere Gesetz anzuwenden. Insbesondere im Hinblick auf die wieder eingeführte Wirksamkeit von Teilselbstanzeigen im Zusammenhang mit Lohnsteueranmeldungen und Umsatzsteuervoranmeldungen ist das neue Recht das mildere Gesetz . Gleiches gilt auch für die Fälle einer trotz Prüfungsanordnung eingereichten Selbstanzeige.[10] Nach umstrittener Auffassung sperrte die Prüfungsanordnung die Abgabe einer Selbstanzeige für alle Besteuerungszeiträume im Hinblick auf die geprüften Steuerarten. Die Neuregelung behandelt gleichwohl eingereichte Selbstanzeigen nunmehr als wirksam, soweit sie die nicht von der Prüfungsanordnung umfassten Zeiträume betrifft.
Ganz unstreitig dürfte die Anwendung des § 2 Abs. 3 StGB auf die Selbstanzeige allerdings nicht sein. Denn immerhin folgt diese Regelung aus dem allgemeinen strafrechtlichen Rückwirkungsverbot.[11] Ob dieses aber bei Regelungen wie § 371 AO berührt ist, die ihren eigentlichen Anwendungsbereich überhaupt erst nach Beendigung der Tat haben, darf zumindest bezweifelt werden. Die Literatur bejaht jedoch die Anwendbarkeit der lex mitior ( § 2 Abs. 3 StGB) mit Hinweis auf den materiell-rechtlichen Charakter des § 371 AO.[12] Für diese Auffassung spricht immerhin, dass die Selbstanzeige ihrer Natur nach zu den persönlichen Strafaufhebungsgründen zählt, für die das Milderungsgebot gelten soll.[13] Auch die Rechtsprechung des BGH bestätigt die Anwendbarkeit des § 2 Abs. 3 StGB auf die Selbstanzeige nach § 371 AO.[14] Der Berater muss jedenfalls auf die umstrittene Frage der Geltung des alten oder neuen Rechts hinweisen.
13
Hinweis
Dies führt dazu, dass bislang als unwirksam behandelte Selbstanzeigen, solange über sie noch nicht rechtskräftig entschieden ist, auf der Grundlage des neuen Rechts ggf. als wirksam zu behandeln sind. Insofern besteht hier in Einzelfällen (LSt-Anmeldungen, USt-Voranmeldungen, sowie bei Prüfungsanordnungen) Handlungs-, aber sicher auch Argumentationsbedarf.
14
Beispiel
Unternehmer U gab für das Jahr 2013 jeweils unrichtige Umsatzsteuervoranmeldungen ab. Einen Teil dieser korrigierte er mittels der 2014 eingereichten Umsatzsteuerjahreserklärung. Diese wertete das zuständige Finanzamt als Selbstanzeige. Da nicht alle Umsatzsteuervoranmeldungen berichtigt wurden, wurde die Selbstanzeige als unwirksam behandelt und ein Strafverfahren wegen Umsatzsteuerhinterziehung für alle eingereichten Voranmeldezeiträume eingeleitet. Ab dem 1.1.2015 ist für den Bereich der Umsatzsteuervoranmeldungen wieder eine Teilselbstanzeige möglich. Unter Berücksichtigung des § 2 Abs. 3 StGB muss daher im laufenden Verfahren das neue Recht zur Anwendung kommen. Das Verfahren wäre hinsichtlich der zutreffend berichtigten Zeiträume einzustellen. Insoweit würde Straffreiheit nach § 371 AO eintreten.
[1]
Schuster JZ 2015, S. 27 ff., 32.
[2]
Einzelheiten hierzu 4. Kap. Rn. 207 ff.
[3]
So Schuster JZ 2015, S. 27 ff., 32.
[4]
BFH BStBl. II 2007, 364; BFH/NV 2013, 1448; zum Grad an Gewissheit BFH BStBl. II 2013, 526.
[5]
BFH /NV 2007, 2057.
[6]
Kritisch daher zu der Ausweitung auf 10 Jahre Spatscheck DB 2014, Beilage Standpunkte zu Heft 42, 2, 3 f.
[7]
Die Wiedereinführung der Teilselbstanzeige auch für andere Anmeldesteuern hätte nahe gelegen, da sich bei diesen insgesamt die Problematik des ggf. mehrfachen Korrekturbedarfs ergibt, die Anlass war, Sonderregelungen für die Lohnsteueranmeldung und Umsatzsteuervoranmeldung zu schaffen.
[8]
Nicht unter diese Norm fallen die „praxisrelevanten“ Länder: Schweiz, Österreich, Liechtenstein und Luxemburg.
[9]
BGHSt 38, 66, 67; MK- Schmitz § 2 Rn. 36.
[10]
Beyer NWB 2015, 769, 770.
[11]
Zur Entwicklung des Rückwirkungsverbots und der lex mitior Dannecker Das intertemporale Strafrecht (1993), S. 63 ff.
[12]
So MK- Schmitz § 2 Rn. 27; Schwartz PStR 2015, S. 37 ff., 41; i.E. auch Beyer NWB 2015, 769, 771, der aber § 2 Abs. 3 StGB bereits vom Wortlaut her nicht auf Fälle anwenden will, in denen Tatbeendigung vor Inkrafttreten der Neuregelung der Selbstanzeige am 3.5.2011 gegeben war.
[13]
So zumindest in Bezug auf die Einführung von Strafaufhebungsgründen LK- Dannecker § 2 Rn. 62.
[14]
BGHSt 56, 298 = NJW 2011, 3249 = HRRS 2011 Nr. 872 Rn. 61 f.
2. Kapitel Die Selbstanzeige in der Beratungssituation: Was ist abzuklären?
Inhaltsverzeichnis
I. Gesamtüberblick zum Ablauf des Selbstanzeigeverfahrens
II. Personen(anzahl)bezogene Überlegungen
III. Fallgruppen nach Steuerarten (steuerspezifische Überlegungen)
IV. Die psychologische Komponente der Selbstanzeigeberatung
V. Summe aller Überlegungen: Die bestmögliche individuelle Beratung
15
Im Mittelpunkt jeder Selbstanzeigeberatung (damit ist aus Klarstellungsgründen der Oberbegriff für die praktisch weit überwiegenden Selbstanzeigefälle gemeint, ergänzend aber auch die im Bereich Unternehmenssteuer (USt-Voranmeldungen, LSt-Anmeldungen) und zuweilen in Erbfällen vorkommenden Fälle der schlichten Nachmeldung nach § 153 AO) steht das ausführliche Beratungsgespräch. In diesem muss der Berater (Steuerberater oder Rechtsanwalt) seinen Mandanten umfassend beraten, ungefragt über alle bedeutsamen steuerlichen – beim Rechtsanwalt: rechtlichen – Einzelheiten und Folgen unterrichten und den sichersten Weg zur Erreichung des angestrebten Ziels aufzeigen.[1] Der Mandant soll vor Fehlentscheidungen bewahrt werden. Entschließt er sich zur Abgabe einer Selbstanzeige, muss der Steuerberater oder Rechtsanwalt dafür sorgen, dass diese die bezweckte Wirkung hat. Wie jeder Arzt erst über eine Anamnese zur individuellen Diagnose und letztlich zur patientengerechten Therapie gelangen kann, ist auch hier „Maßarbeit“gefragt, um passgenau auf den vorgetragenen Lebenssachverhalt die individuell richtige und bestmögliche Lösung für den Mandanten anbieten zu können. Im Rahmen einer solchen „Sachverhaltsaufnahme“kommt es zunächst darauf an, dem Mandanten, der sich regelmäßig erstmals in einer derartigen Beratungssituation befindet, einen kurzen Gesamtüberblickdarüber zu vermitteln, was es konkret bedeutet, sich beim Finanzamt selbst anzuzeigen ( Rn. 16 ff.). Im Anschluss an eine derartige Instruktion des Mandanten sind nach unseren Erfahrungen insbesondere personenbezogene( Rn. 35 ff.), steuerspezifische( Rn. 69 ff.), aber auch persönlichkeitsbezogene, mithin psychologischeÜberlegungen ( Rn. 102 ff.) in die individuelle Beratung( Rn. 111 ff.) zu integrieren.
[1]
Zur Beratungspflicht des Steuerberaters BGH DStRE 2004, 237 = DB 2004, 131; aktuell auch OLG Koblenz WM 2013, 945; zur Beratungspflicht des Rechtsanwalts BGH NJW 2012, 2435; OLG Hamm Urteil vom 23.10.2014 – 28 U 98/13.
2. Kapitel Die Selbstanzeige in der Beratungssituation: Was ist abzuklären?› I. Gesamtüberblick zum Ablauf des Selbstanzeigeverfahrens
Читать дальше