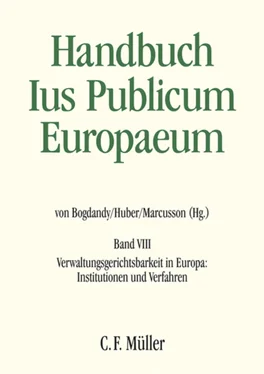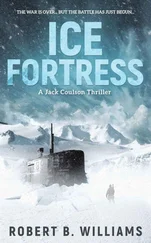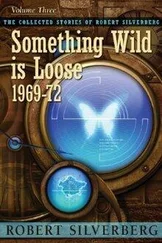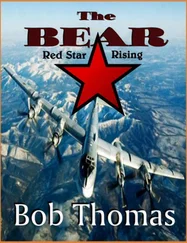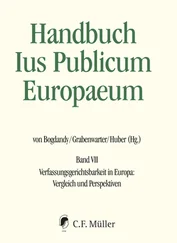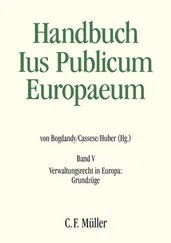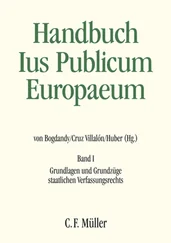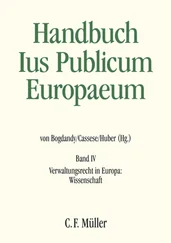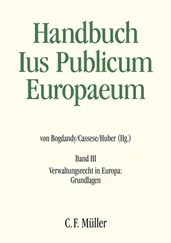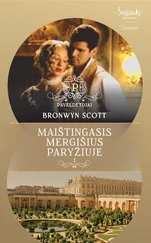Michael Guttner , Institut für Politik und Öffentliches Recht, Juristische Fakultät, Ludwig-Maximilians-Universität München;
Peter M. Huber , Dr. iur., Professor, Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Staatsphilosophie und Forschungsstelle für das Recht der Europäischen Integration, Juristische Fakultät, Ludwig-Maximilians-Universität München, Minister a.D., Richter des Bundesverfassungsgerichts;
Herbert Küpper , Dr. iur., Dr. h.c., Professor, Geschäftsführer des Instituts für Ostrecht München im Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropa Regensburg;
Philip Langbroek , Dr. iur., Professor, Leerstoel voor Rechtspleging en Rechterlijke Organisatie, Afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie, Universiteit Utrecht;
Piotr Lissoń , Dr. iur., Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Lena Marcusson , Dr. iur., Professorin, vormals Lehrstuhl für Verwaltungsrecht, Universität Uppsala;
Franz C. Mayer , Dr. iur., Professor, Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Europarecht, Völkerrecht, Rechtsvergleichung und Rechtspolitik, Fakultät für Rechtswissenschaft, Universität Bielefeld;
Thomas Olechowski , Dr. iur., Professor, Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte, Universität Wien;
Bożena Popowska , Dr. iur., Professorin, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Benjamin Schindler , Dr. iur., Professor, Lehrstuhl für Öffentliches Recht mit besonderer Berücksichtigung des Verwaltungsrechts und des Verfahrensrechts, Universität St. Gallen;
Robert Thomas , Ph. D., Professor, Manchester Centre for Regulation and Governance and Public Law, University of Manchester;
Paulien Willemsen , Dr. iur., Ass. Professorin, Afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie, Universiteit Utrecht;
Jacques Ziller , Dr. iur., Professor, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Pavia.
Peter M. Huber/Michael Guttner
§ 127 Zur verfassungsrechtlichen Prägung des Verwaltungsrechtsschutzes im
europäischen Rechtsraum
I. I. Grundzüge des Verwaltungsrechtsschutzes im europäischen Rechtsraum 1 Auf den ersten Blick weisen die Verwaltungsrechtsordnungen im europäischen Rechtsraum eine bemerkenswerte Vielgestalt auf – nicht nur, was die Organisation der Verwaltung, ihre Handlungen, die demokratische Steuerung und den politischen Gestaltungsfreiraum angeht.[1] Auch und gerade mit Blick auf Art, Umfang und Ausgestaltung des Rechtsschutzes gegen Maßnahmen der Verwaltung, dem nicht nur für den Schutz individueller Interessen, sondern auch für Stellung und Aktionsradius der Verwaltung im Gefüge der Gewalten entscheidende Bedeutung zukommt, unterscheiden sich die einzelnen (Teil-)Rechtsordnungen erheblich. Ob der verwaltungsgerichtliche Rechtsschutz bei den allgemeinen (ordentlichen) Gerichten oder einer spezialisierten Verwaltungsgerichtsbarkeit angesiedelt ist, ob die gerichtliche Kontrolle der Verwaltung primär als objektive Gesetzmäßigkeitskontrolle oder als Instrument zur Durchsetzung subjektiver öffentlicher Rechte oder individueller Interessen der Bürger gegenüber dem Staat und seiner Verwaltung konzipiert ist – in der Regel handelt es sich hierbei um Grundentscheidungen, die das Ergebnis kontingenter historischer Prozesse sind und häufig auch in den jeweiligen Verfassungen Niederschlag gefunden haben. Das gilt auch für die unterschiedlichen Formen verwaltungsinterner und verwaltungsgerichtlicher Kontrolle, die Frage der Kontrolldichte und die Vollstreckung sowie für andere Instrumente des Interessenschutzes. Soweit dies im Verwaltungsprozessrecht Niederschlag gefunden hat, lässt sich daher ohne weiteres von einer verfassungsrechtlichen Prägung des Verwaltungsrechtsschutzes sprechen. § 127 Zur verfassungsrechtlichen Prägung des Verwaltungsrechtsschutzes im europäischen Rechtsraum › I. Grundzüge des Verwaltungsrechtsschutzes im europäischen Rechtsraum › 1. Konstitutionalisierung und Europäisierung
Grundzüge des Verwaltungsrechtsschutzes im europäischen Rechtsraum I. Grundzüge des Verwaltungsrechtsschutzes im europäischen Rechtsraum 1 Auf den ersten Blick weisen die Verwaltungsrechtsordnungen im europäischen Rechtsraum eine bemerkenswerte Vielgestalt auf – nicht nur, was die Organisation der Verwaltung, ihre Handlungen, die demokratische Steuerung und den politischen Gestaltungsfreiraum angeht.[1] Auch und gerade mit Blick auf Art, Umfang und Ausgestaltung des Rechtsschutzes gegen Maßnahmen der Verwaltung, dem nicht nur für den Schutz individueller Interessen, sondern auch für Stellung und Aktionsradius der Verwaltung im Gefüge der Gewalten entscheidende Bedeutung zukommt, unterscheiden sich die einzelnen (Teil-)Rechtsordnungen erheblich. Ob der verwaltungsgerichtliche Rechtsschutz bei den allgemeinen (ordentlichen) Gerichten oder einer spezialisierten Verwaltungsgerichtsbarkeit angesiedelt ist, ob die gerichtliche Kontrolle der Verwaltung primär als objektive Gesetzmäßigkeitskontrolle oder als Instrument zur Durchsetzung subjektiver öffentlicher Rechte oder individueller Interessen der Bürger gegenüber dem Staat und seiner Verwaltung konzipiert ist – in der Regel handelt es sich hierbei um Grundentscheidungen, die das Ergebnis kontingenter historischer Prozesse sind und häufig auch in den jeweiligen Verfassungen Niederschlag gefunden haben. Das gilt auch für die unterschiedlichen Formen verwaltungsinterner und verwaltungsgerichtlicher Kontrolle, die Frage der Kontrolldichte und die Vollstreckung sowie für andere Instrumente des Interessenschutzes. Soweit dies im Verwaltungsprozessrecht Niederschlag gefunden hat, lässt sich daher ohne weiteres von einer verfassungsrechtlichen Prägung des Verwaltungsrechtsschutzes sprechen. § 127 Zur verfassungsrechtlichen Prägung des Verwaltungsrechtsschutzes im europäischen Rechtsraum › I. Grundzüge des Verwaltungsrechtsschutzes im europäischen Rechtsraum › 1. Konstitutionalisierung und Europäisierung
1 – 13
1. 1. Konstitutionalisierung und Europäisierung 2 Die verfassungsrechtliche Prägung im hier verstandenen Sinne meint aber mehr. Betrachtet man den Verwaltungsrechtsschutz im europäischen Rechtsraum, so lassen sich Konturen einer verfassungsrechtlichen Prägung erkennen, die auf ausdrücklichen oder konkludenten Garantien effektiven Rechtsschutzes in den nationalen Verfassungen beruhen,[2] auf den Vorgaben von Art. 6 und Art. 13 EMRK bzw. Art. 47 GRCh sowie weiteren allgemeinen Grundsätzen und bereichsspezifischen Gewährleistungen.[3]
Konstitutionalisierung und Europäisierung 1. Konstitutionalisierung und Europäisierung 2 Die verfassungsrechtliche Prägung im hier verstandenen Sinne meint aber mehr. Betrachtet man den Verwaltungsrechtsschutz im europäischen Rechtsraum, so lassen sich Konturen einer verfassungsrechtlichen Prägung erkennen, die auf ausdrücklichen oder konkludenten Garantien effektiven Rechtsschutzes in den nationalen Verfassungen beruhen,[2] auf den Vorgaben von Art. 6 und Art. 13 EMRK bzw. Art. 47 GRCh sowie weiteren allgemeinen Grundsätzen und bereichsspezifischen Gewährleistungen.[3]
2 – 7
a) a) Konstitutionalisierung 3 Ihr Ausgangspunkt liegt in Deutschland, wo nach dem Zweiten Weltkrieg der vom NS-Regime zerstörte Rechtsstaat nicht nur wieder aufgebaut, sondern in gewisser Weise perfektioniert werden sollte bzw. wurde.[4] Hier hat sie in der berühmt gewordenen Feststellung Fritz Werners von 1959 vom „Verwaltungsrecht als konkretisiertem Verfassungsrecht“ programmatischen Ausdruck gefunden.[5] Konstitutionalisierung des Verwaltungsrechts bedeutete in Deutschland der Sache nach vor allem eine „Vergrundrechtlichung“ und Subjektivierung der Rechtsordnung. Im Zusammenspiel mit den formellen Aspekten des Rechtsstaatsprinzips (Art. 20 Abs. 3 GG), der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, dem Vorrang und dem Vorbehalt des Gesetzes, wurde das Verwaltungsrecht – sehr viel später erst das Zivil- und Strafrecht – konsequent auf Freiheit und Selbstbestimmung des Einzelnen ausgerichtet, durchdrangen die Grundrechte nahezu jeden seiner Winkel. Konzeptionelle oder dogmatische Grundlage für diese Entwicklung waren die Festlegung des Bundesverfassungsgerichts auf einen weiten Schutzbereich der allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) im Elfes -Urteil von 1957,[6] die dem Einzelnen eine Freiheit vor gesetzlosem wie gesetzwidrigem Zwang garantierte,[7] das Lüth -Urteil von 1958,[8] das es gestattete, auch die Normen des von 1900 stammenden Zivilrechts im Lichte der Verfassung zu re-interpretieren, sowie die Garantie effektiven Rechtsschutzes in Art. 19 Abs. 4 GG, die bei jedem Eingriff in ein (grund-)rechtlich geschütztes Interesse den Rechtsweg verbürgte.[9] 4 Die Konstitutionalisierung des Verwaltungsrechts, und mit ihr des Verwaltungsrechtsschutzes, war freilich keineswegs auf Deutschland beschränkt.[10] Nahezu alle Verwaltungsrechtsordnungen Europas haben nach dem Zweiten Weltkrieg – wenn auch nicht gleichzeitig und mit unterschiedlichen inhaltlichen Akzenten – eine Konstitutionalisierung ihres Verwaltungsrechts erlebt, die dieses zwar nicht seines Selbstands beraubt, jedoch den (jeweiligen) verfassungsrechtlichen Anforderungen nachhaltig untergeordnet hat.[11] Kennzeichen dieser Entwicklung ist eine tendenzielle Verselbständigung der Verwaltungsgerichtsbarkeit und eine gewisse Konzentration auf die Durchsetzung rechtlich geschützter Interessen bzw. subjektiver öffentlicher Rechte.
Konstitutionalisierung a) Konstitutionalisierung 3 Ihr Ausgangspunkt liegt in Deutschland, wo nach dem Zweiten Weltkrieg der vom NS-Regime zerstörte Rechtsstaat nicht nur wieder aufgebaut, sondern in gewisser Weise perfektioniert werden sollte bzw. wurde.[4] Hier hat sie in der berühmt gewordenen Feststellung Fritz Werners von 1959 vom „Verwaltungsrecht als konkretisiertem Verfassungsrecht“ programmatischen Ausdruck gefunden.[5] Konstitutionalisierung des Verwaltungsrechts bedeutete in Deutschland der Sache nach vor allem eine „Vergrundrechtlichung“ und Subjektivierung der Rechtsordnung. Im Zusammenspiel mit den formellen Aspekten des Rechtsstaatsprinzips (Art. 20 Abs. 3 GG), der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, dem Vorrang und dem Vorbehalt des Gesetzes, wurde das Verwaltungsrecht – sehr viel später erst das Zivil- und Strafrecht – konsequent auf Freiheit und Selbstbestimmung des Einzelnen ausgerichtet, durchdrangen die Grundrechte nahezu jeden seiner Winkel. Konzeptionelle oder dogmatische Grundlage für diese Entwicklung waren die Festlegung des Bundesverfassungsgerichts auf einen weiten Schutzbereich der allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) im Elfes -Urteil von 1957,[6] die dem Einzelnen eine Freiheit vor gesetzlosem wie gesetzwidrigem Zwang garantierte,[7] das Lüth -Urteil von 1958,[8] das es gestattete, auch die Normen des von 1900 stammenden Zivilrechts im Lichte der Verfassung zu re-interpretieren, sowie die Garantie effektiven Rechtsschutzes in Art. 19 Abs. 4 GG, die bei jedem Eingriff in ein (grund-)rechtlich geschütztes Interesse den Rechtsweg verbürgte.[9] 4 Die Konstitutionalisierung des Verwaltungsrechts, und mit ihr des Verwaltungsrechtsschutzes, war freilich keineswegs auf Deutschland beschränkt.[10] Nahezu alle Verwaltungsrechtsordnungen Europas haben nach dem Zweiten Weltkrieg – wenn auch nicht gleichzeitig und mit unterschiedlichen inhaltlichen Akzenten – eine Konstitutionalisierung ihres Verwaltungsrechts erlebt, die dieses zwar nicht seines Selbstands beraubt, jedoch den (jeweiligen) verfassungsrechtlichen Anforderungen nachhaltig untergeordnet hat.[11] Kennzeichen dieser Entwicklung ist eine tendenzielle Verselbständigung der Verwaltungsgerichtsbarkeit und eine gewisse Konzentration auf die Durchsetzung rechtlich geschützter Interessen bzw. subjektiver öffentlicher Rechte.
3, 4
Читать дальше