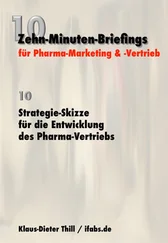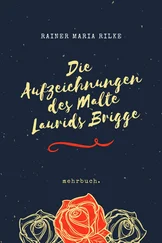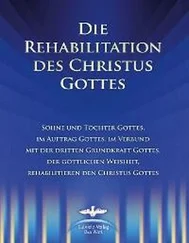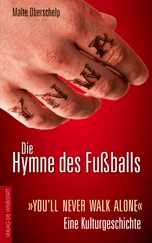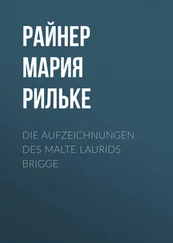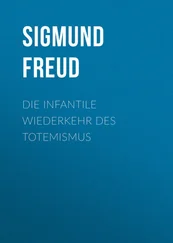Kapitel 8.3 stellt die Praxis des Verstehens als grundlegenden Zugang zur Teilhabe an einer Kultur und ihrer aktiven Gestaltung in den Mittelpunkt. Verstehen ist für das Hineinwachsen in Kultur und Gesellschaften ebenso zentral wie für die Teilhabe an gesellschaftlichen Praktiken, vom Lesen bis hin zur demokratischen Mitbestimmung. Verstehen und Verstehen üben wird auf der Grundlage erfahrungs- und bildungstheoretischer sowie phänomenologischer Zugänge als leibliche bzw. zwischenleibliche Praxis, als ein verkörpertes Antworten vorgestellt, das einerseits auf einer Verständigung beruht, die auf dem Boden eines allgemeinen Horizonts und auf der Grundlage gesellschaftlicher und normalisierender Ordnungssysteme ein Verstehen überhaupt erst ermöglicht. Andererseits beruht es auf einem »grammatischen« Verstehen kultureller Symbole und ihrer Symbolsysteme. In dieser Hinsicht ist Verstehen auf Verständlichkeit bezogen, insofern als diese kulturellen Symbolsysteme in der Schule Gegenstand des Unterrichts sind. Zunächst wird in Abgrenzung von hermeneutischen Theorien des Verstehens nach Dilthey und Gadamer das Fremd-Verstehen als Antworten mit Scheler und Waldenfels herausgearbeitet (  Kap. 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3). Danach wird die Doppelstruktur des Verstehenübens zwischen leiblich-basierter Verständigung und kulturell-grammatischem Verstehen anhand von drei Beispielen verdeutlicht (
Kap. 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3). Danach wird die Doppelstruktur des Verstehenübens zwischen leiblich-basierter Verständigung und kulturell-grammatischem Verstehen anhand von drei Beispielen verdeutlicht (  Kap. 8.3.4). Pädagogisches Verstehen und Verstehen üben wird, so die These, in einem Zwischenraum zwischen Verstehen als Verständigung einerseits und grammatischem Verstehen kultureller Symbolsysteme andererseits verortet (
Kap. 8.3.4). Pädagogisches Verstehen und Verstehen üben wird, so die These, in einem Zwischenraum zwischen Verstehen als Verständigung einerseits und grammatischem Verstehen kultureller Symbolsysteme andererseits verortet ( 
Kap. 8.3.5
).
Für Demokratiebildung und -erziehung sind die Praxis des Urteilens und des Kritisierens von zentraler Bedeutung. Kapitel 8.4 widmet sich diesem Feld als einer besonderen Sache des Übens. Kritisieren und Urteilen werden als leibliche bzw. zwischenleibliche Praxen verstanden, die auf einem elementar-reflexiven Wiederholungsgeschehen basieren (  Kap. 8.4.1und 8.4.2). Zunächst wird die interkorporale Dimension der Reflexivität und des Urteilens mit Merleau-Ponty und Heidegger am Beispiel des Händedrucks herausgearbeitet (
Kap. 8.4.1und 8.4.2). Zunächst wird die interkorporale Dimension der Reflexivität und des Urteilens mit Merleau-Ponty und Heidegger am Beispiel des Händedrucks herausgearbeitet ( 
Kap. 8.4.3
). Danach wird Kritisieren als politische Praxis der Positionierung unter vulnerablen und prekären Bedingungen im öffentlichen Raum bestimmt (  Kap. 8.4.4). Schließlich werden Möglichkeiten erwogen, Urteilen und Kritisieren zu üben. Hier werden Praktiken der Verzögerung und der Distanzierung als Modi des Urteilenübens vorgestellt (
Kap. 8.4.4). Schließlich werden Möglichkeiten erwogen, Urteilen und Kritisieren zu üben. Hier werden Praktiken der Verzögerung und der Distanzierung als Modi des Urteilenübens vorgestellt (  Kap. 8.4.5). Urteilen wird als eine Praxis des Unterscheidenkönnens sowie als distanzierende und einklammernde Bewegung der Unterbrechung dargestellt (
Kap. 8.4.5). Urteilen wird als eine Praxis des Unterscheidenkönnens sowie als distanzierende und einklammernde Bewegung der Unterbrechung dargestellt (  Kap. 8.4.6). Urteilen wird damit als Voraussetzung für Kritik als »Grenzhaltung« (Foucault) im öffentlichen Raum ausgewiesen, die sich auf die Inhalte, auf Beziehungen, Ordnungen und Systeme gleichermaßen verzögernd zurückwendet. Insofern können Urteilen üben und Kritik üben als wesentliche Praxen von Demokratie und Postdemokratie gelten.
Kap. 8.4.6). Urteilen wird damit als Voraussetzung für Kritik als »Grenzhaltung« (Foucault) im öffentlichen Raum ausgewiesen, die sich auf die Inhalte, auf Beziehungen, Ordnungen und Systeme gleichermaßen verzögernd zurückwendet. Insofern können Urteilen üben und Kritik üben als wesentliche Praxen von Demokratie und Postdemokratie gelten.
Das letzte Kapitel widmet sich dem Unterrichten üben als besonderem Feld der Professionalisierung ( 
Kap. 8.5
). Hier werden die erfahrungstheoretischen Überlegungen wieder aufgenommen und die Differenz zwischen Theorie, Praxis und Erfahrung in Bezug auf Unterricht, Unterrichten üben und Unterrichtsforschung fruchtbar gemacht (  Kap. 8.5.1und Kap. 8.5.2). Unterrichten üben wird für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung an Beispielen der Unterrichtsforschung als »Form der Professionalisierung« und als propädeutisches Unterrichten üben ausgewiesen (
Kap. 8.5.1und Kap. 8.5.2). Unterrichten üben wird für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung an Beispielen der Unterrichtsforschung als »Form der Professionalisierung« und als propädeutisches Unterrichten üben ausgewiesen (  Kap. 8.5.3). Dazu wird Fallarbeit als Beispielverstehen hochschuldidaktisch als eine Methode des Lehrenübens dargestellt. Das Praxisbeispiel wird dann in seinen didaktischen und bildenden Funktionen bestimmt und schließlich werden Haltung und Ethos in professionellen Kontexten übungstheoretisch genauer dargestellt (
Kap. 8.5.3). Dazu wird Fallarbeit als Beispielverstehen hochschuldidaktisch als eine Methode des Lehrenübens dargestellt. Das Praxisbeispiel wird dann in seinen didaktischen und bildenden Funktionen bestimmt und schließlich werden Haltung und Ethos in professionellen Kontexten übungstheoretisch genauer dargestellt (  Kap. 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6). Mit dem Unterrichten üben kann also eine Verbindung von theoretischem und reflexivem Wissen für die pädagogische Praxis erfolgen. Es wird möglich, bildende Erfahrung hochschuldidaktisch zu inszenieren und damit Voraussetzungen für eine urteilskräftige, reflektierende und forschende Haltung zu schaffen (
Kap. 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6). Mit dem Unterrichten üben kann also eine Verbindung von theoretischem und reflexivem Wissen für die pädagogische Praxis erfolgen. Es wird möglich, bildende Erfahrung hochschuldidaktisch zu inszenieren und damit Voraussetzungen für eine urteilskräftige, reflektierende und forschende Haltung zu schaffen (  Kap. 8.5.7).
Kap. 8.5.7).
Mit den in diesem Buch dargestellten Aspekten einer Geschichte und Theorie des Übens verbindet sich die Hoffnung, dass diese als Anlässe einer weiteren Übungsforschung dienen, die sich jeweils feldspezifisch verortet und die fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Diskurse aufnimmt mit dem Ziel, Üben als kreative und produktive Praxis zu rehabilitieren.
1Ich danke Elisabeth Münder und Samira Trummer für die aufmerksame Korrektur und Formatierung des Textes sowie für wertvolle Hinweise. Daniel Pastenaci danke ich für die Suche nach geeigneten Bildern sowie für die Erstellung des Abbildungsverzeichnisses.
1 Aspekte einer Theorie des Übens als Praxis und Erfahrung
Ein kleiner Junge strauchelt und kippelt auf seinem roten Fahrrad. Sein Vater hält ihn zunächst am Sattel fest, dann lässt er los. Nach kurzer Zeit kippt der Junge um und fällt hin. Er steigt gleich wieder auf und versucht es erneut. Dieses wiederholt sich mehrfach. Kratzer, Schürfwunden, Tränen und Wut auf das sperrige Fahrrad gehören ebenso dazu wie der Stolz, »es« zu können und es den anderen Kindern und Erwachsenen zu zeigen.

Abb. 1: Fahrradfahren üben: sich bewegen üben (M. Brinkmann, eigene Aufnahme).
Im Klassenrat der 3a sollen auf Anregung der Lehrerin anlässlich verschiedener Vorfälle die Klassenregeln besprochen werden. Die Schülerinnen und Schüler wollen alle Regeln nochmals auf den Prüfstand stellen und eventuelle Konsequenzen bei Regelbruch gemeinsam festlegen. Sie diskutieren über mögliche Prinzipien der Regelgebung, ohne zu einem Ergebnis zu kommen, und üben sich im Urteilen.

Abb. 2: Klassenrat in einer Grundschule: Urteilen üben (Drubig-Photo/Adobe Stock).
Читать дальше
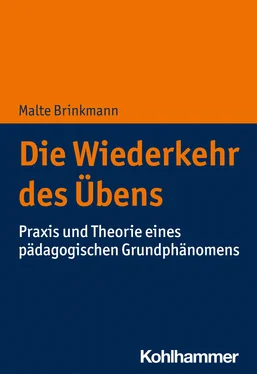
 Kap. 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3). Danach wird die Doppelstruktur des Verstehenübens zwischen leiblich-basierter Verständigung und kulturell-grammatischem Verstehen anhand von drei Beispielen verdeutlicht (
Kap. 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3). Danach wird die Doppelstruktur des Verstehenübens zwischen leiblich-basierter Verständigung und kulturell-grammatischem Verstehen anhand von drei Beispielen verdeutlicht (