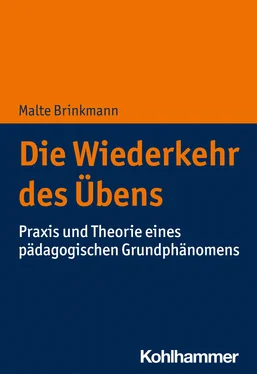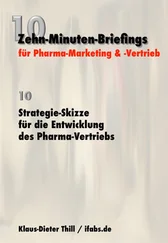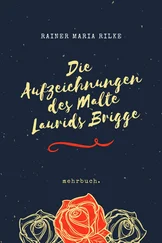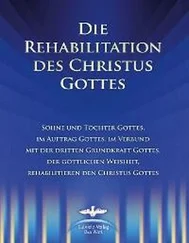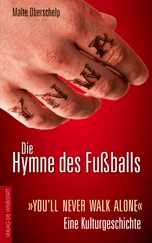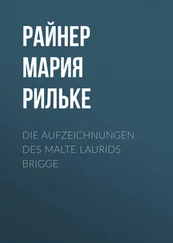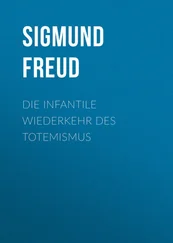Der Anspruch des Buches geht damit über eine bereichs- oder fachdidaktische Bestimmung des Übens ebenso hinaus wie über die »älteren« Untersuchungen des Übens (vgl. Weise 1932, Rabbow 1954, Bollnow 1978, Loser 1976). Ohne Übung ist weder Bildung noch Lernen möglich – ja, ohne Üben ist ein lebendiges, weltbezogenes und weltoffenes Leben in demokratischen Gemeinschaften nicht möglich. Es geht also um eine Rehabilitierung des Übens als sowohl leibliche als auch geistige, produktive Praxis, mit der ein fundamentales Verhältnis zu sich, zu Anderen und zur Welt konstituiert wird.
Üben wird, so die hier vertretene Perspektive, als ein Relationsphänomen bestimmt. Diese Relationen werden zum einen in Selbstverhältnissen manifest, die in geistigen, meditierenden, philosophierenden oder imaginierenden Übungen im Mittelpunkt stehen. Die Relationen zu Anderen werden im Verhältnis zu Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern oder Exerzitienleiterinnen und Exerzitienleitern sinnfällig. Davon werden gegenstands- und fachbezogene Relationen unterschieden, wie sie im letzten Teil dieses Buches exemplarisch beschrieben werden. Eine Bewegungsübung ( 
Kap. 8.1
) wird ganz anders erfahren als eine Imaginationsübung ( 
Kap. 8.2
) oder eine Übung im Schulunterricht ( 
Kap. 8.5
). Daher wird der Gegenstandsbezug in (fach-)spezifischen Feldern als eine wichtige Dimension herausgearbeitet. In der gegenstandsspezifischen und relationalen Perspektive wird Üben als ein pädagogisches Phänomen und eine pädagogische Praxis bestimmbar. Als solche ist Üben in soziale, gesellschaftliche und kulturelle Zusammenhänge eingebettet. Diese sozialen Verhältnisse werden in Bezug auf das Üben als leibliche bzw. zwischenleibliche Relationen ( 
Kap. 5.1
) sowie als sozialtheoretische, responsive und antwortende Relationen ( 
Kap. 4.4
) ausgewiesen und in unterschiedlichen Praktiken wie dem Verstehen ( 
Kap. 8.3.5
) oder dem Urteilen ( 
Kap. 8.4.3
) genauer bestimmt.
Die hier vorgestellte pädagogische Perspektive auf Üben grenzt sich von psychologischen und kompetenztheoretischen Theorien deutlich ab. Lernen und Üben werden hier nicht als stetiger und stufenweiser Zuwachs von kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten verstanden. Mit der Fokussierung auf kognitive Prozesse (entweder die Informationsverarbeitung oder die Vernetzung) und ihre Kontinuität können psychologische und kompetenztheoretische Lerntheorien weder implizites Wissen noch emotionale, ästhetische, leibliche und ethische Dimensionen angemessen erfassen. Vor allem aber werden so negative Erfahrungen, d. h. Erfahrungen der Irritation, der Enttäuschung und des Scheiterns, die eben zur Erfahrung des Übens dazugehören, nicht in ihrem produktiven Potenzial erkannt. Sie gelten in diesen Theorien stattdessen als Betriebsunfälle erfolgreichen Lernens und Übens, welche weiter optimiert werden müssten ( 
Kap. 4.3
).
Der Blick wird daher auf die Praxis des Übens gelenkt und damit erstens auf die Erfahrung im Üben, zweitens auf die bildenden Aspekte, drittens auf die sozialen und viertens auf die edukativen Zusammenhänge. Üben wird also erfahrungs-, bildungs-, sozial- und erziehungstheoretisch beschrieben und untersucht.
Die Erfahrungstheorie versucht die leiblichen, kinästhetischen Strukturen im Üben genauer zu betrachten. Aus phänomenologischer Perspektive werden Leiblichkeit und Verkörperung im Üben genauer analysiert. Die erfahrungstheoretische Betrachtungsweise verschiebt dabei die Perspektive weg von den Ergebnissen, den Kompetenzen oder den Leistungen, die im Üben perfektioniert oder optimiert werden könnten, hin zu den Prozessen und Erfahrungen im Üben selbst. Diese werden in drei Strukturen untersucht: Leiblichkeit, Zeitlichkeit und Machtförmigkeit. Die erfahrungstheoretische Betrachtungsweise ermöglicht es zudem, im Prozess des Übens die »schwierigen« Momente, die Erfahrungen der Enttäuschung, des Scheiterns, der »Unzuhandenheit« (Heidegger), des Nicht-Könnens und der Fehler in den Blick zu nehmen – also jene Erfahrungen, die für den Prozess und die Erfahrung des Übens konstitutiv sind. Sie gelten in bildungstheoretischer Perspektive als Grundmomente von Lern- und Übungsprozessen insofern, als mit ihnen und durch sie eine Umwendung, ein Umüben und Umlernen möglich wird: In der formatio der Übung kann sich eine transformatio ereignen; die Wiederholung der Tätigkeiten kann zu einem Ereignis und zu einer existenziellen Erfahrung führen, die Anstrengung und Überwindung im Üben führt zur Erfahrung von Flow, Gelassenheit und Achtsamkeit. Im scheinbaren Paradox der angestrengten Entspannung bzw. des fokussierten Loslassens verbirgt sich die Produktivität und Kreativität des Übens, die auch zur Erfahrung der Fülle des Augenblicks, zum Anhalten des Bewusstseinsstroms und zum Innehalten und Verzögern alltäglicher Verrichtungen führen kann. Deshalb werden im letzten Teil didaktische Praktiken des Übens als Praktiken der Verzögerung bestimmt. Üben changiert also zwischen Kontinuität und Diskontinuität, zwischen Fokussierung und Gelassenheit, zwischen Habitus und Transformation bzw. Selbstführung und Fremdführung.
Die Praktiken des asketischen, meditierenden, geistigen oder spirituellen Übens sind nie nur auf das Individuum bezogen. Sie finden in einem sozialen, gesellschaftlichen und machtförmigen Raum statt, der – das ist die dritte oben angesprochene Struktur in diesem Buch – in sozialtheoretischer Perspektive eingeholt wird. Üben findet auch durch Andere angeleitet und vor Anderen statt. Damit ist Üben auch eine Praxis der Macht, die aber, wie oben dargestellt, nicht nur unterwerfend und disziplinierend bzw. normalisierend ist. Die Erfahrung im Üben impliziert auch – das werde ich mit Foucault verdeutlichen – widerständige Momente und Freiheitsspielräume. Das Ziel der performativen Übung wird damit als ein Selbstkönnen bestimmt, in dem neben disziplinierenden, normalisierenden immer auch ereignishafte und singuläre Momente konstitutiv sind.
Diese Einsichten werden schließlich in edukativer Perspektive für eine Didaktik der Übung fruchtbar gemacht. Übung als intersubjektive und edukative Praxis in der Lehre, im Unterricht oder in pädagogischen Settings soll Üben als individuelle Praxis anleiten, unterstützen und ermöglichen. Übungen funktionieren ein- und ausschließend, disziplinierend und normalisierend und zugleich ermöglichend und formierend. Im machtförmigen Spannungsgefüge zwischen Selbstsorge und Fürsorge wird die Didaktik der Übung als Kunst der Verschränkung von Aus-, Selbst- und Fremdführung bestimmt. Die Didaktik der Übung wird systematisch auf unterschiedliche Felder bezogen und sach- und fachbezogen dargestellt.
Der hier vorgestellte Zugang zum Phänomen und zur Praxis des Übens wird im bildungs- und erziehungstheoretischen Diskurs der Allgemeinen Erziehungswissenschaft verortet, einer Disziplin, die auf den produktiven Austausch mit Didaktik und Fachdidaktiken nicht verzichten kann. Neben den bildungs- und erziehungswissenschaftlichen Aspekten stehen in diesem Buch schulische und unterrichtliche im Mittelpunkt. Das ist nicht nur der Berufsbiographie des Autors geschuldet, sondern auch der Tatsache, dass zwar keine Unterrichtsstunde ohne Üben auskommt, Üben aber gleichwohl und vor allem in der Schule, in der Unterrichtslehre und -forschung sowie in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung eine vergessene und verkannte Praxis ist.
Читать дальше