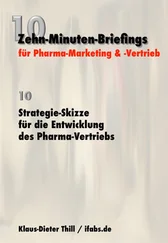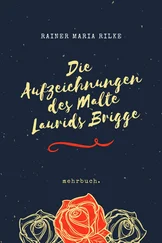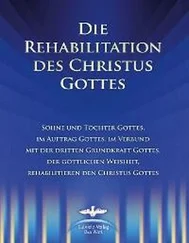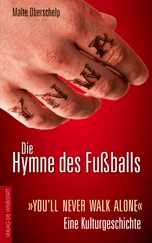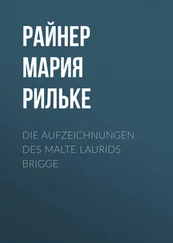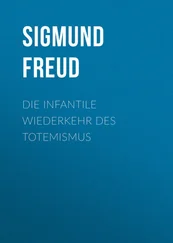1 ...7 8 9 11 12 13 ...20
1.5 Üben als besondere Lernform
Im Alltag lassen sich Lernen und Üben schwer unterscheiden. Sie gehen ineinander über. Gleichwohl lassen sich Unterschiede benennen, die Üben als eine besondere Lernform ausweisen. Elementare Strukturen des Übens sind die Wiederholung, Negativität, Leiblichkeit und Machtförmigkeit (  Kap. 5). Geübt werden leibliche und motorische Lebens- und Weltvollzüge, Fertigkeiten und Fähigkeiten sowie individuelle Haltungen und Einstellungen. Jede Übung hat daher bei unterschiedlicher Schwerpunktsetzung eine ästhetisch-sinnliche, eine methodisch-reflexive und eine praktisch-ethische Dimension. Üben ist immer Einüben, Ausüben und Sich-üben zur gleichen Zeit (
Kap. 5). Geübt werden leibliche und motorische Lebens- und Weltvollzüge, Fertigkeiten und Fähigkeiten sowie individuelle Haltungen und Einstellungen. Jede Übung hat daher bei unterschiedlicher Schwerpunktsetzung eine ästhetisch-sinnliche, eine methodisch-reflexive und eine praktisch-ethische Dimension. Üben ist immer Einüben, Ausüben und Sich-üben zur gleichen Zeit (  Kap. 4). Üben ist eine Tätigkeit. Sie braucht, wie das Lernen auch, eine Sache, einen Inhalt, einen Stoff – also ein Stück Welt, das Anlass, Thema, Inhalt oder Ziel des Übens ist. Mit anderen Worten: Üben hat immer einen Gegenstand. Dieser ist in einem spezifischen Tätigkeitsfeld lokalisiert. In den unterschiedlichen Feldern des Übens (
Kap. 4). Üben ist eine Tätigkeit. Sie braucht, wie das Lernen auch, eine Sache, einen Inhalt, einen Stoff – also ein Stück Welt, das Anlass, Thema, Inhalt oder Ziel des Übens ist. Mit anderen Worten: Üben hat immer einen Gegenstand. Dieser ist in einem spezifischen Tätigkeitsfeld lokalisiert. In den unterschiedlichen Feldern des Übens (  Kap. 8) ergeben sich daher jeweils unterschiedliche Erfahrungs- und Anforderungsstrukturen des Übens. Fahrradfahren üben hat eine andere Erfahrungsstruktur und folgt anderen Regeln als das Verstehen üben oder das Imaginieren üben. In den unterschiedlichen Feldern des Übens wird der Gegenstand und damit das »Stückchen Welt«, die Sache oder der Inhalt, auf eine je besondere Weise erfahren. Insofern wird das Nicht-Können in diesen Feldern ebenfalls jeweils anders erfahren. Nicht- oder Missverstehen der Anderen bedeutet eine andere Qualität in der negativen Erfahrung als z. B. nicht Fahrrad fahren können. Für alle diese Erfahrungen aber gilt: In diesen negativen Erfahrungen manifestieren sich die produktiven Chancen des Übens. Aufgrund seiner Wiederholungsstruktur zielt Üben nicht direkt und unmittelbar auf Einsicht, auf einen Wow-Effekt oder auf ein Aha-Erlebnis. Trotzdem ist im Üben ein Lernen aus Erfahrung möglich, denn Einsicht oder Erkenntnis ergeben sich im Üben – im Unterschied zum Lernen – erst nach oder mit den Wiederholungen (
Kap. 8) ergeben sich daher jeweils unterschiedliche Erfahrungs- und Anforderungsstrukturen des Übens. Fahrradfahren üben hat eine andere Erfahrungsstruktur und folgt anderen Regeln als das Verstehen üben oder das Imaginieren üben. In den unterschiedlichen Feldern des Übens wird der Gegenstand und damit das »Stückchen Welt«, die Sache oder der Inhalt, auf eine je besondere Weise erfahren. Insofern wird das Nicht-Können in diesen Feldern ebenfalls jeweils anders erfahren. Nicht- oder Missverstehen der Anderen bedeutet eine andere Qualität in der negativen Erfahrung als z. B. nicht Fahrrad fahren können. Für alle diese Erfahrungen aber gilt: In diesen negativen Erfahrungen manifestieren sich die produktiven Chancen des Übens. Aufgrund seiner Wiederholungsstruktur zielt Üben nicht direkt und unmittelbar auf Einsicht, auf einen Wow-Effekt oder auf ein Aha-Erlebnis. Trotzdem ist im Üben ein Lernen aus Erfahrung möglich, denn Einsicht oder Erkenntnis ergeben sich im Üben – im Unterschied zum Lernen – erst nach oder mit den Wiederholungen (  Kap. 4und 5.2). Üben unterscheidet sich also vom Lernen durch den wiederholenden Charakter, der dieser Praxis einen kreis- oder spiralförmigen Grundzug verleiht (
Kap. 4und 5.2). Üben unterscheidet sich also vom Lernen durch den wiederholenden Charakter, der dieser Praxis einen kreis- oder spiralförmigen Grundzug verleiht (  Kap. 7). Üben ist auch nicht schiere Wiederholung im Sinne einer Repetition desselben. Aufgrund des Bruches in der Wiederholung, der »temporalen Differenz« (
Kap. 7). Üben ist auch nicht schiere Wiederholung im Sinne einer Repetition desselben. Aufgrund des Bruches in der Wiederholung, der »temporalen Differenz« (  Kap. 5.2), richtet sich Üben auf jene negativen Erfahrungen des Nicht-Könnens. Sie werden in einer gezielten Operation angesteuert. Der negative Grundzug des Übens lässt sich nicht vollständig eliminieren. Ohne Negativität, ohne Nicht-Können und Nicht-Wissen wäre das Üben beendet – und ohne Negativität wäre der bildende Charakter des Übens nicht kenntlich.
Kap. 5.2), richtet sich Üben auf jene negativen Erfahrungen des Nicht-Könnens. Sie werden in einer gezielten Operation angesteuert. Der negative Grundzug des Übens lässt sich nicht vollständig eliminieren. Ohne Negativität, ohne Nicht-Können und Nicht-Wissen wäre das Üben beendet – und ohne Negativität wäre der bildende Charakter des Übens nicht kenntlich.
Hintergrund dieser Überlegungen ist eine phänomenologische Erfahrungs- und eine pädagogische Lerntheorie. Diese versucht, eurozentrische und logozentrische Duale zu überwinden und leibliche, aisthetische und motorische Aspekte ebenso einzubeziehen wie geistige und vernünftige (  Kap. 4). Negativität kann dann als elementare Erfahrungsstruktur im Üben bestimmt werden, die die Produktivität und Kreativität und zugleich die implizite Reflexivität des Übens hervorbringt. Aufgrund der leiblichen Grundstruktur des Übens, die auf situativer, kulturell und gesellschaftlich basierter Verkörperung und horizonthafter Gestaltwahrnehmung beruht, spreche ich von einer Positionierung des Übenden (vgl. Spivak 2008, Butler 2018;
Kap. 4). Negativität kann dann als elementare Erfahrungsstruktur im Üben bestimmt werden, die die Produktivität und Kreativität und zugleich die implizite Reflexivität des Übens hervorbringt. Aufgrund der leiblichen Grundstruktur des Übens, die auf situativer, kulturell und gesellschaftlich basierter Verkörperung und horizonthafter Gestaltwahrnehmung beruht, spreche ich von einer Positionierung des Übenden (vgl. Spivak 2008, Butler 2018;  Kap. 8.4). In den negativen Erfahrungen der Übenden, im temporalen Zwischenraum der Wiederholung und im machtförmigen Spannungsgefüge zwischen Selbstsorge und Fürsorge erweist sich die bildende und überschreitende Produktivität und Kreativität des Übens. Das bildungs- und übungstheoretisch ausgewiesene Ziel des Übens kann als Selbstsorge und Selbstformung bestimmt werden, mit denen sich eine praktische und »gekonnte« Transformation ereignen kann.
Kap. 8.4). In den negativen Erfahrungen der Übenden, im temporalen Zwischenraum der Wiederholung und im machtförmigen Spannungsgefüge zwischen Selbstsorge und Fürsorge erweist sich die bildende und überschreitende Produktivität und Kreativität des Übens. Das bildungs- und übungstheoretisch ausgewiesene Ziel des Übens kann als Selbstsorge und Selbstformung bestimmt werden, mit denen sich eine praktische und »gekonnte« Transformation ereignen kann.
1.6 Üben ist nicht Spielen
Üben ist im Unterschied zum Spiel eine anstrengende und herausfordernde Tätigkeit. Auch wenn man im Üben die Erfahrung der Selbstvergessenheit, des Flow oder der Gelassenheit machen kann, basiert diese immer auf zuvor eingeübten Praktiken. Mit anderen Worten: Um diese Erfahrungen machen zu können, muss man schon etwas geübt haben, muss man schon etwas können, muss man schon in einem Feld oder einer »Domäne« ausgewiesen sein. Spätestens wenn sich negative Erfahrungen einstellen, erfordert das Üben Ausdauer, Beharrlichkeit, Anstrengungs- und Überwindungsbereitschaft – also Tugenden oder Haltungen. Diese ethischen Aspekte werden vor allem im asiatischen Raum, insbesondere in China, mit dem Üben (lianxi) verbunden (  Kap. 3). Die ethische Dimension des Selbstübens und der Selbstsorge machen in Asien ebenso wie in der europäischen Antike und im Mittelalter den bedeutsamsten Anteil des Übens aus – noch vor dem einübenden Erwerb von Fertigkeiten und der ausübenden Vertiefung als Gewohnheit und Habitus. Das Ethos des Übens (
Kap. 3). Die ethische Dimension des Selbstübens und der Selbstsorge machen in Asien ebenso wie in der europäischen Antike und im Mittelalter den bedeutsamsten Anteil des Übens aus – noch vor dem einübenden Erwerb von Fertigkeiten und der ausübenden Vertiefung als Gewohnheit und Habitus. Das Ethos des Übens (  Kap. 3und 6) als Reaktion auf die allem Üben inhärenten negativen Erfahrungen unterscheidet diese Praxis von der ästhetischen Praxis des Spiels.
Kap. 3und 6) als Reaktion auf die allem Üben inhärenten negativen Erfahrungen unterscheidet diese Praxis von der ästhetischen Praxis des Spiels.
Die Ambivalenz des Übens zwischen Perfektion und Negation, zwischen Freiheit und Zwang, Selbstsorge und Fürsorge bewirkt aber eine notorische Unsicherheit der pädagogischen Theoriebildung, um die Praxen des Spielens von jenen des Übens zu unterscheiden. Während die Übung in der Pädagogik wenig gewürdigt wird, steht es um das Spiel anders: Spätestens seit Schiller werden mit dem Spiel Freiheit und Authentizität verbunden. Das hat dazu geführt, dass vor allem ästhetische und kulturelle Bildung mit »Mythen« wie Ganzheit, Totalität und Authentizität verbunden werden, die sie notorisch überfordern (vgl. Brinkmann/Willat 2019). Klammert man diese hehren Hoffnungen und Ziele ein und nimmt die Zeitstruktur des Übens und des Spielens in den Blick, ergibt sich ein differenzierteres Bild. Schleiermacher bestimmt in seiner Vorlesung von 1826 das Üben als Praxis, deren Ziel in der Zukunft liege. Im Spiel hingegen erfahre man eine Befriedigung in der Gegenwart (vgl. Schleiermacher 2000, S. 56). Spiel ist in dieser Perspektive eigentlich »Anti-Übung« (ebd.), weil es in der Gegenwart aufgeht und sich um die Zukunft nicht kümmert. Aufgrund des Bezuges auf ein Ziel hin wird in der Übung an einem Problem, einer Sache oder an einer Fähigkeit »gearbeitet«. Dies ist anstrengend und oftmals mit Frust, Enttäuschung oder Irritationen verbunden. Im Spiel hingegen werden Stolpersteine entweder nicht oder in einer besonderen Leichtigkeit erfahren. Im kindlichen Spiel ist diese Trennung noch nicht vollständig gegeben. Hier ist der Zukunftsbezug im Spiel gleichsam implizit mitgegeben. Erst später, so Schleiermacher, lassen sich Spielen und Üben aufgrund zunehmender »Progression« und Reflexivität auseinanderhalten. In diesem Buch wird im Unterschied zu Schleiermacher, der eine teleologische und entelechische Struktur des Lernens unterstellt, die Zeitstruktur des Übens genauer als differenzielle und diskontinuierliche bestimmt. Üben als Wiederholen – so die im Folgenden vertreten These – basiert nicht auf einer Teleologie, sondern auf einer zeitlich erfahrbaren Differenz, die die Performativität des Übens begründet (  Kap. 5.2). Gleichwohl bleibt auch in dieser Perspektive der systematische Unterschied zwischen Spielen und Üben bestehen.
Kap. 5.2). Gleichwohl bleibt auch in dieser Perspektive der systematische Unterschied zwischen Spielen und Üben bestehen.
Читать дальше
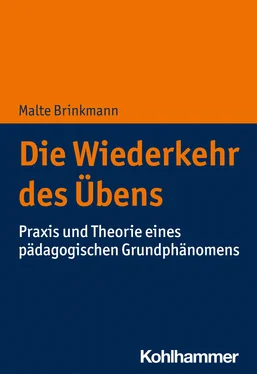
 Kap. 5). Geübt werden leibliche und motorische Lebens- und Weltvollzüge, Fertigkeiten und Fähigkeiten sowie individuelle Haltungen und Einstellungen. Jede Übung hat daher bei unterschiedlicher Schwerpunktsetzung eine ästhetisch-sinnliche, eine methodisch-reflexive und eine praktisch-ethische Dimension. Üben ist immer Einüben, Ausüben und Sich-üben zur gleichen Zeit (
Kap. 5). Geübt werden leibliche und motorische Lebens- und Weltvollzüge, Fertigkeiten und Fähigkeiten sowie individuelle Haltungen und Einstellungen. Jede Übung hat daher bei unterschiedlicher Schwerpunktsetzung eine ästhetisch-sinnliche, eine methodisch-reflexive und eine praktisch-ethische Dimension. Üben ist immer Einüben, Ausüben und Sich-üben zur gleichen Zeit (