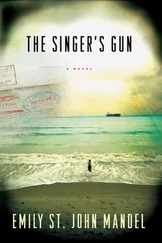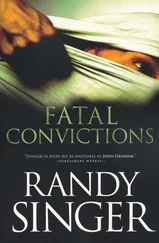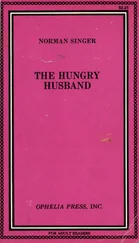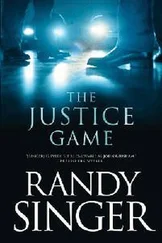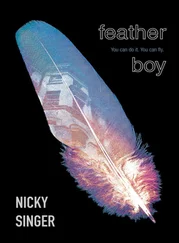Zuerst zwickte sie mit der Zange die beiden Plomben auf. Dann begann sie geschickt den Bretterdeckel aufzustemmen. Die Nägel sassen fest und knarzten beim Herausziehen. Fineli bekam vor Anstrengung rote Wangen. Die Signora trippelte wie ein Kind um die Kiste und konnte es kaum erwarten, bis der Deckel entfernt war. Das letzte Brett war noch daran, als sie schon in die Holzwolle griff und diese ungeduldig auf den Boden warf. Gut gepolstert und in ein grosses Stück schweren Seidenstoffs eingeschlagen stand die geschnitzte Wiege im Viereck. Gemeinsam hoben die beiden Frauen sie sorgsam heraus und stellten sie auf den bereitgestellten Handwagen. Rasch entfernte die Signora einzelne Holzwollenknäuel und das Seidentuch und verharrte für einige Augenblicke gerührt vor dem wunderschön gearbeiteten Wiegenbettchen. Das Holz schimmerte rötlich und die Blumenranken mit den geschnitzten Glockenblumen und den kleinen Rosen spielten im Sonnenlicht.
«Schau, Giuseppina, das mein Papa, das mein Onkel, das mein Tante.» Die Signora fuhr mit ihrer feinen Hand über die geschnitzten Namen und Jahreszahlen an der Wiege. «Und das mein Bruder, mein Schwester und das meine Name, Angelina. Ich sein die jüngste von alle.» Sie rieb sich rasch ein paar Tränen vom Gesicht und lachte wieder fröhlich.
Fast hätte Fineli auch ihr Taschentuch gebraucht. Sie war froh, dass die Signora wieder strahlte und brachte, um ihre Rührung zu verbergen, das Werkzeug zurück an seinen Platz. Die Holzwolle warfen sie in die leere Kiste zurück. Gemeinsam zogen sie den Wagen mit der Wiege über den Hof zum Haus. Dort fasste Fineli das kleine Möbel mit beiden Händen und trug es, schwer atmend hinter der Signora hergehend, in den Salon. Dass die zukünftige Mama dabei half, liess sie nicht zu, obwohl das Schaukelbettchen aus Kastanienholz viel schwerer war, als sie gedacht hatte. Im Salon stellte sie die Wiege aufatmend neben den Kachelofen auf den weichen Teppich aus dem Morgenland. Da passte sie gut hin, fand Fineli.
Wenn sie am Freitag jeweils den Salon putzte, setzte sie sich immer einen Augenblick auf den weichen roten Flor und fuhr mit den Fingern die schönen Muster nach. Die Fransen mussten jederzeit schön gekämmt daliegen, darauf legte die Signora grossen Wert. Der Herr hatte den Teppich von einer technischen Studienreise mitgebracht. Ein Land, in dem so wunderbare Teppiche geknüpft wurden, musste ein prächtiges, wundersames Land sein. Persien hiess es. Der König dort hiess Schah. Und die Menschen dort glaubten nicht an den Herrgott. Fineli hätte dem Signore gern viele Fragen gestellt oder sich einfach dazugesetzt, wenn der Signore seiner Frau und den Gästen davon erzählte, aber das gehörte sich nicht.
Die Signora gab der Wiege einen leichten Schubs und strahlte, dann entfernte sie das Seidenpapier, das den weichen Bettinhalt schützte. Die Decke und das kleine Kissen in der Wiege waren aus Seide und reich mit Wappen und Blumenranken bestickt. Es waren die gleichen Ranken wie auf der Wiege. Als die Signora die Decke heraushob, lag da ein Brief auf der kleinen Matratze. «Oh, Mamma.» Angelina liess sich schwer neben der Wiege auf den weichen Teppich nieder und hielt den Brief an die Wangen, den Tränen liess sie jetzt ihren Lauf.
Leise ging Fineli aus dem Salon.
In der Amtsstube
Verlegen trat Susanne von einem Fuss auf den andern. Gleichzeitig zerrte sie ihren kleinen Buben näher zu sich. Sie warteten im grossen dunklen Korridor des Gemeindehauses. Sie traute sich nicht, sich hinzusetzen, auch wenn der Rücken schmerzte und Beine und Füsse geschwollen waren. Die Stühle neben der Türe schienen der einfachen Frau zu vornehm. Susannes Kleidung und Haube waren sauber, schliesslich war sie Wäscherin. Der Rock und die Jacke waren geflickt, die Strümpfe grobgestrickt und kratzig. Die braunen derben Schuhe waren an den Spitzen abgestossen, die Absätze schiefgetreten. Über den Rist spannte sich eine feine Landschaft aus Rissen und Risslein. Auch wenn Susanne sich hätte Schuhfett kaufen können, diese Schuhe wären nicht mehr zu retten gewesen. Das Leder war alt und ausgetrocknet, die Nähte hielten kaum noch.
Susannes Hände waren rot und schrundig aufgerissen. Da half kein Melkfett, das sie manchmal auf den Höfen zum Einreiben erhielt, die Haut erholte sich nie von der Seifenlauge und dem heissen Wasser. Die Nägel waren stumpf und blassbläulich verfärbt. Das Waschblau, das der Weisswäsche der Reichen eine elegante Note gab, war in die feinen Rillen ihrer Nägel eingedrungen. Die Haare der Wäscherin waren früher glänzend kastanienbraun gewesen und hatten ihrem Josua gut gefallen. Aber das war lange her. Jetzt zeigte sie ihre Haare schon längst niemandem mehr. Sie waren stumpf und hatten die Farbe alten Buchenlaubes angenommen. Es störte sie nicht. Sie selber hatte keinen Spiegel, und dass sie einem Mann hätte gefallen wollen, war lange vorbei. Ihr Josua war vor acht Jahren beim Holzen verunglückt und hatte sie mit drei Kindern zurückgelassen. Ein späterer Liebhaber hatte sich davon gemacht, als sie schwanger geworden war. Mit dem kleinen Bub, der dann zur Welt kam, war ihr guter Ruf dahin. Eine Witwe, die zur Unzeit noch ein Kind zur Welt bringt, beim besten Willen, nein, das gehörte sich einfach nicht. Viele Haushaltungen, in denen sie all die Jahre die Wäsche zur Zufriedenheit der Meisterinnen erledigt hatte, brauchten plötzlich keine Wäscherin mehr, oder waren mit ihrer Arbeit nicht mehr zufrieden. Andere Meisterinnen sagten ihr ins Gesicht, dass sie ihre Wäsche nicht in die Hände einer liederlichen Person geben würden. Einer der Bauern hatte sie gar als wohlfeile Dirne betrachtet und sich im Waschhaus an sie herangemacht. Sie hatte ein Stück Wäsche aus dem kochend heissen Sudhafen gezogen und es ihm auf die Hände gepatscht. Fluchend hatte er sich verzogen und sie bei seiner Frau scheinheilig angeschwärzt. So verlor sie auch diese Stelle.
Zum Glück dachten die Wirtsleute im Dorf etwas grosszügiger, so hatte sie wenigstens vier Plätze als Wäscherin behalten können. Aber es reichte einfach nicht. Die beiden grösseren Kinder halfen zwar schon mit, aber ihr kleiner Lohn für Viehhüten oder Botengänge machte die tägliche Suppe nicht fett. Für die drei Kinder ihres Josua erhielt sie auch hin und wieder einen Zustupf aus der Armenkasse, aber für Johann, «das Uneheliche», erhielt sie nichts. Zwar brauchte er wenig. Die Kleider und Schuhe trug er von den Grossen nach, bis sie zerfielen oder zu klein wurden. Einen eigenen Strohsack brauchte er noch nicht, er war klein und schmächtig. Aber es ging einfach nicht mehr. Er hatte ein rebellisches, widerspenstiges Wesen. So klein, wie er war, brachte er die Halbgeschwister durcheinander und sie selber oft fast zur Verzweiflung. Ihre Meisterinnen wollten ihn nicht in ihren Waschküchen haben, da er sich oft mit den Meisterskindern auf Händel und Streitereien einliess oder kleine Schäden anrichtete. So hatte die «Kronen»-Wirtin Susanne letzte Woche vor die Wahl gestellt, nachdem er dem Wirtssohn beim Händeln das neue Hemd zerrissen hatte. «Entweder, du gibst den Saubub ins Armenhaus, oder du musst nicht mehr kommen.»
Auch wenn der Wirtsbub einen Kopf grösser war als ihr schmächtiger Johann und Susanne das Hemd rasch und sorgfältig geflickt hatte, es war nichts zu machen, es ging einfach nicht mehr. Er musste weg.
So stand sie nun im dunklen Gang und wartete. Der kleine Johann stand gleichmütig daneben. Er wusste ungefähr, worum es ging, es berührte ihn nicht. Die Halbgeschwister hatten ihm am Tag zuvor hämisch erzählt, dass ihn die Mutter nicht mehr wolle. Als Baschter habe er sowieso bei ihnen nichts verloren, man kenne ja nicht einmal seinen Vater. Er solle froh sein, wenn ihn der Armenvater im Armenhaus bei den Waisenkindern aufnehme. Richtig verstanden hatte Johann das Ganze nicht, aber schon lange gespürt, dass er allen im Weg war.
Читать дальше