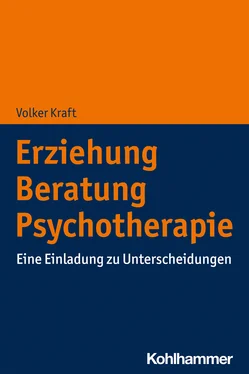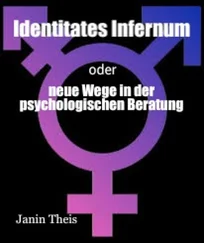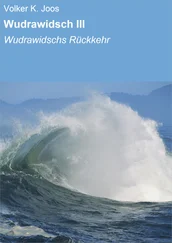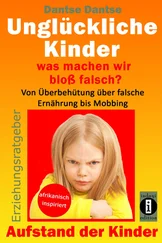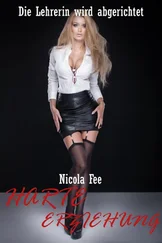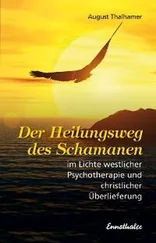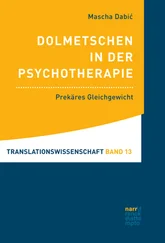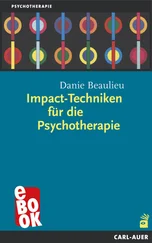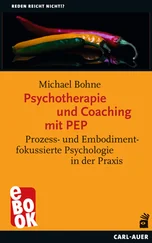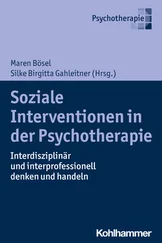Volker Kraft - Erziehung - Beratung - Psychotherapie
Здесь есть возможность читать онлайн «Volker Kraft - Erziehung - Beratung - Psychotherapie» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Erziehung - Beratung - Psychotherapie
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Erziehung - Beratung - Psychotherapie: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Erziehung - Beratung - Psychotherapie»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Erziehung - Beratung - Psychotherapie — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Erziehung - Beratung - Psychotherapie», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Zunächst sieht man, dass das »Zeigen« eine Tätigkeit ist, ein Handeln, ein aktiver Vollzug. Wer zeigt, tut etwas. Dieses Handeln ist auf eine prinzipielle, man kann sogar sagen: auf eine buchstäblich radikale Weise sozial: Jemand zeigt jemandem etwas. Es werden also, anders gesagt, Personen durch Orientierung auf eine Sache miteinander verbunden oder zu verbinden versucht. Damit kommen zunächst drei konstitutive Elemente zum Vorschein: ein »Zeiger«, ein Adressat und ein Sachverhalt. Im Sinne der Logik ist »zeigen« demnach ein »mehrstelliges Prädikat«. Denn es enthält sowohl einen Verweis auf Sachverhalte oder Themen (auf nichts lässt sich nicht zeigen) als auch, damit unmittelbar verbunden oder gleichsam verschmolzen, einen Verweis auf Personen. Die Beispiele verdeutlichen zudem, dass das »Zeigen« auf verschiedene Weisen geschehen kann. Es findet sich ohne oder vor der Sprache, in Sprache eingebettet oder als Sprache allein, durch eine schlichte Geste wird ebenso zu zeigen versucht wie beispielsweise durch diesen Text. Der Zeigeakt selbst lässt sich also als ein weiteres (viertes) konstitutives Element herausstellen. Schließlich, und damit steht und fällt die ganze Figur, ist das »Zeigen« ohne Absicht nicht zu denken, es ist, anders gesagt, prinzipiell intentional: Wer immer einem anderen etwas zeigt, verfolgt dabei eine bestimmte Absicht (was spätestens dann – mit befreiendem Lachen, oft allerdings mit Irritation, Verlegenheit oder gar Beschämung – bemerkt wird, wenn man »unbeabsichtigt« etwas zeigt). Über seine Absicht ist ein »Zeiger« nicht nur mit einem bestimmten Sachverhalt verbunden, sondern unmittelbar auch mit dem Adressaten seiner Bemühungen, denn der Andere muss ja, zumindest der Möglichkeit nach, das, was gezeigt wird, auch verstehen können. Dafür sind nicht nur Aufmerksamkeit, Wahrnehmung und kognitive Verarbeitung notwendige Voraussetzungen, sondern auch ein gemeinsamer kultureller Horizont: was bei uns als höfliche Geste aufgefasst wird, kann in anderen Teilen der Erde unverzüglich für Entsetzen sorgen. Durch diese fünf konstitutiven Elemente (Zeiger, Adressat, Sachverhalt, Zeigeakt und kultureller Horizont) wird erkennbar, dass dem »Zeigen« eine Struktur zugrunde liegt oder eingeschrieben ist, die auch aus der Rhetorik bekannt ist (vgl. Landweer 2010). Zeigen ist eben immer auch eine Art gestisch verdichteten Sprechens, und es gibt gute Gründe für die Annahme, dass sich im Prozess der Evolution die Sprache aus dem Zeigen heraus entwickelt hat. Nicht zuletzt in der »Gebärdensprache« kommt eben diese Eigenschaft prägnant zum Vorschein. Der genuine Zusammenhang zwischen Zeigen und Reden macht deutlich, dass es sich offensichtlich um eine anthropologische Universalie handelt, etwas also, das für Menschen typisch ist.
Wer den Umgang mit Haustieren, etwa Hunden oder Katzen, gewohnt ist, weiß, dass das Zeigen im kommunikativen Kontakt mit Tieren nicht auf gewohnte menschliche Weise funktioniert: die geliebten vierbeinigen Gesellen schauen meist beharrlich auf den Arm oder ausgestreckten Finger des Zeigenden, nicht aber oder nur zufällig auf das Gezeigte, denn sie verlängern die Blickachse, die vom Zeiger zum Objekt führt, in aller Regel nicht.
Diese Alltagserfahrung ist mittlerweile durch eine Vielzahl empirischer Studien und daraus entwickelten, differenzierten Theorien wissenschaftlich belegt und bestätigt worden. Die Adresse für dieses Wissenschaftsgebiet ist die »evolutionäre Anthropologie« und seit geraumer Zeit mit dem Namen Michael Tomasello (z. B. 2002; 2009) und einer international weit verzweigten Gruppe von Forscherinnen und Forschern verbunden. 4Um der Menschheitsgeschichte genauer auf die Spur zu kommen, spielt dabei der Vergleich mit unseren nächsten evolutionären Verwandten, den Menschenaffen, eine besondere Rolle. Wie unterscheiden sich hinsichtlich des Zeigens kleine Affen von kleinen Kindern?
Steht man im Zoo vor einem Affen-Gehege, Schimpansen am besten, sorgt der spontane Eindruck frappierender Ähnlichkeit mit menschlichen Wesen unverzüglich für Verwunderung und freudiges Erstaunen. Der Ausdruck ihrer Gesichter kommt uns ebenso bekannt vor wie etliche Gesten, durch die sich die Tiere untereinander (und manchmal auch mit dem Publikum vor dem Zaun) zu verständigen scheinen. Wir bewundern die Geschicklichkeit ihrer Bewegungen, freuen uns, wie sie miteinander spielen oder sich wechselseitig pflegen oder sich »schlau«, manchmal äußerst geschickt herumliegende Gegenstände als Werkzeug benutzend, ihr Futter verschaffen. Diese Eindrücke von Zoobesuchern lassen sich durch die vielfältigen Befunde der Primatenforschung sehr viel genauer fassen, und damit besteht auch die Möglichkeit, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu erkennen und mittlerweile weitestgehend auch zu erklären. Dabei muss man unterscheiden, ob die Beobachtungen und Befunde von Affen in natürlicher Umgebung gewonnen wurden, oder ob sie von Populationen stammen, die im Kontakt mit Menschen (z. B. in Zoos oder eben auch Forschungseinrichtungen) aufgewachsen sind. 5
Beide Gruppen unterscheiden sich in einer Hinsicht überhaupt nicht voneinander: Betrachtet man allein die vokale Kommunikation, also das Sich-Verständigen mit der Stimme, ist der Befund eindeutig: Das diesbezügliche Repertoire der Affen ist fast gänzlich genetisch festgelegt. Lernprozesse spielen dabei kaum eine Rolle, und dementsprechend sind ihre stimmlichen Äußerungen beschränkt, stereotyp und gleichförmig: Das Sprechen oder gar das Singen können Affen niemals lernen.
Was die gestische Kommunikation anbetrifft, treten zwischen diesen beiden Gruppen allerdings deutliche Unterschiede zu Tage, vor allem deshalb, weil hierbei in ungleich stärkerem Maße Lernprozesse beteiligt sind. In ihrer natürlichen Umgebung kommunizieren Primaten mit Hilfe bestimmter Gesten wie Körperhaltungen, Gesichtsausdrücke oder Handbewegungen. Auch sie sind zu einem großen Teil genetisch festgelegt und werden dementsprechend, sozusagen strikt programmgemäß, eingesetzt. Allerdings gibt es einen großen anderen Teil von Gesten, die evolutionär weniger dringliche Bereiche betreffen, z. B. spielen, stillen, betteln oder die Fellpflege. Und diese werden individuell gelernt und flexibel benutzt. Primaten verhalten sich also nicht alle gleich, und sie verwenden ihre Signale auch unterschiedlich und dieselben auch zu unterschiedlichen Zwecken. In dieser Hinsicht, also im absichtlichen und flexiblen Gebrauch erlernter Kommunikationssignale, ist die gestische Kommunikation der Primaten mit der sprachlichen Kommunikation des Menschen durchaus vergleichbar (vgl. Tomasello 2009, S. 32). Zwei Typen von Gesten können eindeutig unterschieden werden, »Aufmerksamkeitsfänger« und »Intentionsbewegungen«. Zur ersten Gruppe gehört zum Beispiel das Auf-den-Boden-Schlagen (häufig um zu spielen) oder den Rücken anzubieten (als Einladung zur Körperpflege); zur zweiten Gruppe zählen beispielsweise das Armheben (um mit einem Spiel zu beginnen), das Betteln mit der Hand (um Futter zu bekommen) oder das Armauflegen als Einleitung gemeinsamen Gehens. Von allen faszinierenden Details abgesehen geht es an dieser Stelle nur um zwei Einsichten: Erstens kommt zum Vorschein, dass schon bei Primaten absichtlich auf andere gerichtete Handlungen beobachtbar sind, so dass diese Gesten als Vorläufer menschlicher Kommunikation anzusehen sind. Zweitens darf man nicht übersehen, dass diesen Gesten keine »Bedeutung« innewohnt, die dann vom Anderen erkannt und »verstanden« würde, der dann dementsprechend handelte. Vielmehr haben diese Gesten den Charakter von einem »display«, sie fungieren gewissermaßen als eine Art von Anzeige für veränderliche Informationen, Reize also, auf die dann wiederum reagiert wird.
Affen hingegen, die im Umgang mit Menschen aufwachsen, sind in der Lage, ihr gestisches Repertoire um eine entscheidende Dimension zu erweitern: sie können zu »zeigen« lernen. Hierfür gibt es zahlreiche experimentelle Befunde: Beispielsweise »zeigen« Affen mit Fingern oder Händen auf außerhalb ihrer Reichweite liegendes Futter, damit ein Mensch es für sie holt. Oder sie machen einen Menschen auf ein vorher verstecktes Werkzeug aufmerksam, das für die Futterbeschaffung nötig ist. Oder sie zeigen nachdrücklich auf eine verschlossene Tür, hinter der sie für sie Interessantes vermuten, damit ein Mensch sie öffnet. Solche »zeigeähnlichen« Verhaltensweisen können als Erweiterung von Aufmerksamkeitsgesten verstanden werden, wobei die Versuchstiere sehr genau beobachten und auch der menschlichen Blickrichtung zu folgen vermögen. Dieses »Zeigeverhalten« findet sich allerdings lediglich in auffordernder Absicht, also als imperative Geste. Gesten, die »nur« ein Interesse an einer Sache signalisieren, deklarative Gesten also, zeigen sie ebenso wenig wie informative Gesten, die dazu dienen, darüber zu informieren, was für ein anderes Individuum vielleicht interessant, brauchbar oder nützlich sein könnte. Zudem, und das dürfte ein entscheidendes Argument sein, zeigen Affen diese »zeigeähnlichen« Verhaltensweisen ausschließlich Menschen gegenüber, nicht aber gegenüber ihren Artgenossen. Offenbar gibt es eine unüberwindbare Grenze für die ansonsten so verblüffende Lernfähigkeit dieser Tiere. In den berühmten Objektwahl-Experimenten kommt eben diese Grenze eindrucksvoll zum Vorschein: Eine Person versteckt vor den Augen der Affen Futter unter einem von drei Eimern, während eine andere Person, ein »Helfer«, dabei zuschaut. In dem weiteren Verlauf dieses Experiments zeigt dann dieser menschliche »Helfer« auf den Eimer, unter dem das Futter versteckt wurde. Und obwohl die Affen diese Zeigegeste des menschlichen Helfers auf den richtigen Eimer aufmerksam und hochmotiviert verfolgten, treffen sie ihre Wahl rein zufällig. Anscheinend können sie die Bedeutung dieser Zeigegeste einfach nicht verstehen, also nicht die richtigen Schlüsse daraus ziehen und somit nicht nachvollziehen, dass der Mensch ihnen etwas zeigt, damit sie es sich für ihre Zwecke nehmen können. Kleine Kinder bewältigen diese Aufgabe schon im Alter von 14 Monaten und meist vor dem Spracherwerb mit gutem Erfolg.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Erziehung - Beratung - Psychotherapie»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Erziehung - Beratung - Psychotherapie» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Erziehung - Beratung - Psychotherapie» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.