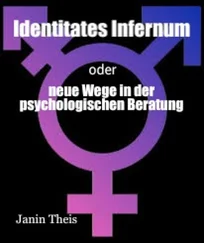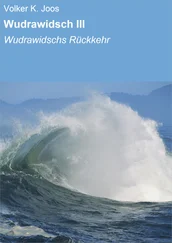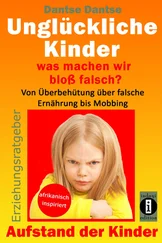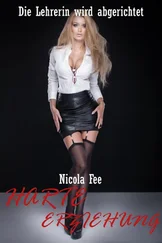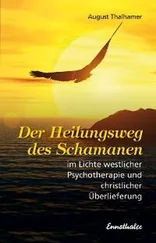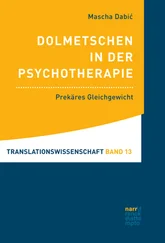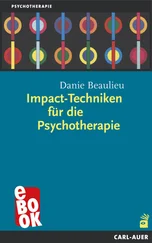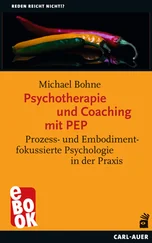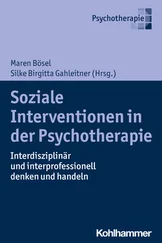1 ...6 7 8 10 11 12 ...24 Die Zeigegeste ist also die erste und ursprüngliche Form menschlicher Kommunikation, und sie erweist sich als im Kern kooperativ. 6Im Zeigen muss »gemeinsam operiert« werden, in welcher Form auch immer, sei es im Auffordern, im Informieren oder im Mit-teilen. Und Kooperation funktioniert nur mit Identifikation, mit eben dem Sich-Hineinversetzen-Können in eine andere Konstellation zur Welt. Kein noch so langes Training kann Primaten dazu verhelfen. Und es ist aufschlussreich, dass viele Schwierigkeiten, die autistische Kinder haben, mit dieser mangelnden Fähigkeit zur Perspektivenübernahme in engem Zusammenhang gesehen werden (vgl. Tomasello 2002, S. 95). Die Zeigegeste ist sozusagen das Minimalprogramm menschlicher Kommunikation, sie ist Sprache vor der Sprache (und deswegen greifen wir in fremden Ländern mit unbekannten Sprachen gerade darauf zurück, wenn wir uns verständigen wollen). Sie bildet, geht die Neunmonatsrevolution erfolgreich ihren Weg, die Grundlage für alle weiteren Entwicklungsschritte, die jetzt folgen, vor allem, wenn über das Gebärdenspiel die Sprachentwicklung nun rasch voranschreitet und durch Worte sich das Zeigen von der unmittelbaren Wahrnehmung lösen kann und symbolisch wird. Dann bekommen Dinge eine Bezeichnung und werden Worte zu Zeichen, auf die gezeigt werden kann. Neben die bis hierhin bestimmenden deiktischen Gesten treten, so der gängige Sprachgebrauch, ikonische (symbolische) Gesten, wodurch sich die Möglichkeiten des Lernens exponentiell erweitern. Das genauer nachzuzeichnen, sozusagen die ontogenetische Geschichte des Zeigens zu erzählen, ist für die Zwecke dieser Darstellung nicht erforderlich und muss anderen Arbeiten überlassen bleiben.
Zum Abschluss dieses Abschnittes soll die Aufmerksamkeit vielmehr auf etwas anderes gelenkt werden (man sieht also auch hier: »joint-attention«): Bisher wurde das Zeigen, phylogenetisch wie ontogenetisch, vorwiegend aus der Perspektive des Lernens betrachtet. Die Neunmonatsrevolution weist aber weit darüber hinaus, denn sie führt auch zum Lehren. Anders gesagt: Warum gibt es bei Affen keine Schulen (und daher auch keine PISA-Studien)? Die Antwort auf diese rhetorische Frage kann nach den bisherigen Ausführungen nicht verwundern, denn, auch das weiß man inzwischen recht genau, erwachsene Affen tun wenig, um ihrem Nachwuchs hilfreiche Informationen bereitzustellen, sie überlassen ihn weitgehend sich selbst und zeigen keinerlei Interesse daran, dass die kleinen Affen bestimmte Fähigkeiten oder Fertigkeiten erlernen. Das ist bei Menschen, wie jeder Leser aus (manchmal schmerzhaft erinnerter) eigener Erfahrung weiß, in der Regel anders, werden kleine Menschen doch üblicherweise »erzogen« und das schon seit ziemlich langer Zeit. Somit erweist sich die Erziehung, die für menschliche Kulturen und Gesellschaften kennzeichnend ist, auch als Ausdruck und Folge einer Revolution, keiner politischen zwar, aber einer stammesgeschichtlichen wie ontogenetischen. Der Mechanismus des Zeigens steht dabei im Mittelpunkt, nicht zuletzt deshalb, weil Menschen auf die Idee gekommen sind, ihn von Zufällen unabhängiger zu machen und auf Dauer zu stellen, ihn schließlich zu organisieren und zu institutionalisieren. So betrachtet sieht man: Familien wie Schulen lassen sich im Kern durchaus als institutionalisierte Zeigegesten verstehen. Und pädagogische Berufe demgemäß als Zeigeberufe. Und Erziehung nur als Kooperation.
Wie das im Einzelnen zu denken ist, wird der nächste Abschnitt zeigen.
1.2 Die Zeigestruktur der Erziehung
Die Darstellung der Zeigestruktur der Erziehung erfolgt in fünf Schritten: Im ersten Schritt wird genauer erläutert, wie man überhaupt von der Entwicklungspsychologie in die Pädagogik kommen kann. Dabei ist die (kaum zu überschätzende) Einsicht zu gewinnen, dass das »didaktische Dreieck« der Pädagogik der Form nach eben jenem Muster der Kommunikation entspricht, das sich im Zuge der Neunmonatsrevolution herausgebildet hat (  Kap. 1.2.1). Der zweite Schritt baut hierauf auf und zeigt, dass das Zeigen allein durch einen spezifischen Bezug auf das Lernen zum pädagogischen Zeigen wird. Dadurch ergibt sich eine Grundform, die aus zwei getrennten Operationen besteht, die wiederum durch einen Mechanismus eigener Art miteinander verbunden werden müssen (
Kap. 1.2.1). Der zweite Schritt baut hierauf auf und zeigt, dass das Zeigen allein durch einen spezifischen Bezug auf das Lernen zum pädagogischen Zeigen wird. Dadurch ergibt sich eine Grundform, die aus zwei getrennten Operationen besteht, die wiederum durch einen Mechanismus eigener Art miteinander verbunden werden müssen (  Kap. 1.2.2). Die unterschiedlichen Funktionen, die der Erziehung zukommen, führen demgemäß zu verschiedenen Varianten pädagogischen Zeigens, die im dritten Schritt dargestellt werden (
Kap. 1.2.2). Die unterschiedlichen Funktionen, die der Erziehung zukommen, führen demgemäß zu verschiedenen Varianten pädagogischen Zeigens, die im dritten Schritt dargestellt werden (  Kap. 1.2.3). In welcher Weise hierbei Emotion und Affekt eine besondere Rolle übernehmen, wird im Rückgriff auf Theoreme der psychoanalytischen Selbstpsychologie im vierten Schritt vorgeführt (
Kap. 1.2.3). In welcher Weise hierbei Emotion und Affekt eine besondere Rolle übernehmen, wird im Rückgriff auf Theoreme der psychoanalytischen Selbstpsychologie im vierten Schritt vorgeführt (  Kap. 1.2.4). Mit dem fünften und letzten Schritt dieses Abschnittes schließt sich der Kreis insofern, als zum Vorschein gebracht wird, was für pädagogisches Zeigen wesentlich ist: Es muss, durch ostensive Kommunikation, wiederum selbst gezeigt werden, ist doch das Zeigen des Zeigens gleichsam der Schlüssel, der die Tür in die Werkstatt der Erziehung allein zu öffnen vermag (
Kap. 1.2.4). Mit dem fünften und letzten Schritt dieses Abschnittes schließt sich der Kreis insofern, als zum Vorschein gebracht wird, was für pädagogisches Zeigen wesentlich ist: Es muss, durch ostensive Kommunikation, wiederum selbst gezeigt werden, ist doch das Zeigen des Zeigens gleichsam der Schlüssel, der die Tür in die Werkstatt der Erziehung allein zu öffnen vermag (  Kap. 1.2.5).
Kap. 1.2.5).
1.2.1 Die entwicklungspsychologische Fundierung der pädagogischen Situation: Von ›joint-attention‹ zum ›didaktischen Dreieck‹
Im vorherigen Abschnitt ist deutlich geworden, dass das Zeigen nicht nur in phylogenetischer Hinsicht, also mit Blick auf die menschliche Gattung, sondern auch in ontogenetischer Hinsicht, also mit Blick auf die Entwicklung jedes einzelnen Menschen, von grundlegender Bedeutung ist. Im Verlauf und erfolgreichen Abschluss der »Neunmonatsrevolution« konvergieren beide Dimensionen insofern, als die Umstellung von dyadischer auf triadische Kommunikation im Modus geteilter Intentionalität nicht nur als Voraussetzung der kulturellen Entwicklung, sondern auch als Voraussetzung aller individuellen Entwicklungsprozesse anzusehen ist. Der evolutionäre Mechanismus, der diese beiden Funktionen übernimmt, ist die Erziehung. Das Besondere dabei liegt darin, dass beide Funktionen in einer Operation, eben der pädagogischen Bemühung um das Lernen des Nachwuchses, verschmolzen sind: der kulturelle Bestand wird tradiert, indem die Kinder sich ihn aneignen. Insofern ist alle Erziehung im Kern zunächst konservativ (und, wer weiß, vielleicht sind auch viele Erzieherinnen und Erzieher »eigentlich« konservativer, als sie es sich selbst einzugestehen bereit oder in der Lage sind). Aber im Prozess der Aneignung ist immer auch die Bedingung der Möglichkeit für Veränderung und Weiterentwicklung enthalten, dafür sorgt das lernende Bewusstsein. Anders gesagt: Erziehung hat prinzipiell zwei Seiten: conservation and change. Dieser Gedanke kann hier nicht weiterverfolgt werden. Vielmehr geht es jetzt um eine Einsicht, die auch unmittelbar aus der Betrachtung der »Neunmonatsrevolution« gewonnen werden kann: Es lässt sich nämlich zeigen, dass das Grundmuster früher triadischer Kommunikation gleichsam als Prototyp einer pädagogischen Situation aufgefasst werden kann. Wie muss man sich das vorstellen?
Der als »joint-attention« bezeichnete Entwicklungskomplex besteht, wie oben erläutert, aus drei Stadien. Mit der dritten und letzten dieser Phasen (dem »Lenken der Aufmerksamkeit«) wird der Wechsel von dyadischer zu triadischer Kommunikation vollzogen, und es ergibt sich ein frühes kommunikatives Dreieck (kleine Person – große Person – Ding/Gegenstand). Die implizite Annahme hierbei ist, dass Personen Dinge auf unterschiedliche Weise wahrnehmen und dementsprechend auch von unterschiedlichen Intentionen geleitet werden. Damit sich Kooperation überhaupt ergeben kann, müssen eben diese (unterschiedlichen) Absichten geteilt werden können.
Читать дальше
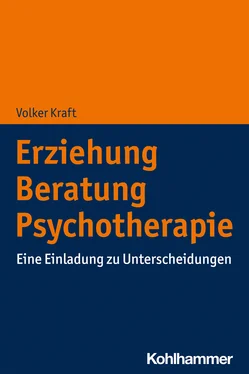
 Kap. 1.2.1). Der zweite Schritt baut hierauf auf und zeigt, dass das Zeigen allein durch einen spezifischen Bezug auf das Lernen zum pädagogischen Zeigen wird. Dadurch ergibt sich eine Grundform, die aus zwei getrennten Operationen besteht, die wiederum durch einen Mechanismus eigener Art miteinander verbunden werden müssen (
Kap. 1.2.1). Der zweite Schritt baut hierauf auf und zeigt, dass das Zeigen allein durch einen spezifischen Bezug auf das Lernen zum pädagogischen Zeigen wird. Dadurch ergibt sich eine Grundform, die aus zwei getrennten Operationen besteht, die wiederum durch einen Mechanismus eigener Art miteinander verbunden werden müssen (