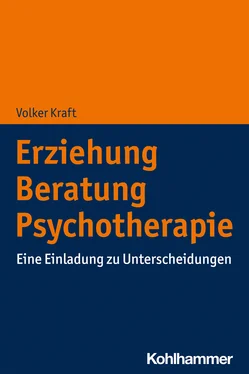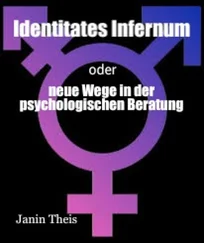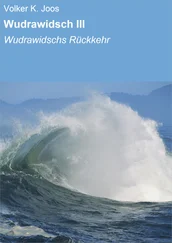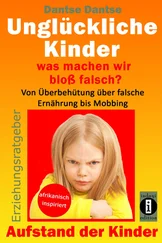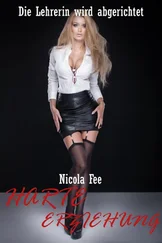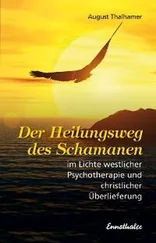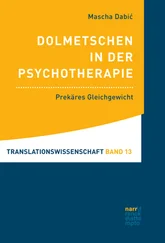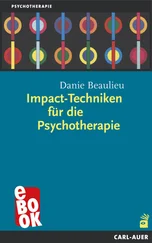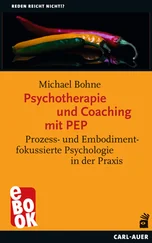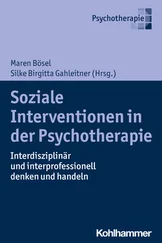1.1.1 Was heißt »operativ«?
Da der Ausdruck »operativ« (und dann auch »Operative Pädagogik«) für den hier verfolgten Ansatz kennzeichnend ist und im Gang der Darstellung häufiger vorkommt, soll er an dieser Stelle genauer erläutert werden.
Das Wort stammt, wie unschwer zu erkennen ist, aus dem Lateinischen und geht auf »opus« zurück, was »Werk, Arbeit, Beschäftigung, Handlung« bedeutet (bzw. auch auf »opera« – »Arbeit, Tätigkeit, Mühe«). Hiervon abgeleitet ist das Verb »operari«, was mit »beschäftigt sein, arbeiten, wirken, verrichten« übersetzt werden kann. Später bildet sich dann die adjektivische Form »operativ« heraus, das »wirkend, tätig eingreifend, eine Operation betreffend« bedeutet (vgl. Pfeifer 1999, S. 951).
Vor diesem semantischen Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass aus diesem Wortfeld stammende Ausdrücke in vielen Lebensbereichen auftauchen. In der Medizin unterscheidet man zwischen »operativer« (wenn etwas durch einen Eingriff entfernt wird) und »konservativer« Behandlung, und man spricht vom Chirurgen als »Operateur« (übrigens der ursprünglich verwendete Ausdruck). In der Musik kennt man die »Oper« und die »Operette« (das »Werkchen«) und in Literatur und Wissenschaft das opus magnum (oder magnum opus). In der Mathematik ist der »Operator« eine formale Vorschrift, die festlegt, was geschehen soll (z. B. das Pluszeichen bei der Addition), und auch in Logik und Informatik ist der Ausdruck in verschiedenen Wendungen gebräuchlich. »Operateure« kennt man nicht nur bei Film und Fernsehen, sondern auch in der Datenverarbeitung oder generell an zentralen Schaltstellen in komplexen technischen Anlagen. In der Betriebswirtschaft spricht man vom »operativen Geschäft« und meint damit dasjenige, das sich ausschließlich auf den eigentlichen Zweck des Unternehmens richtet (Finanzspekulationen von z. B. Automobilkonzernen gehören demnach nicht zum »operativen Geschäft«). Auch Zeithorizonte kommen ins Spiel, wie im Management, wo zwischen »operativer« (kurzfristiger), taktischer (mittelfristiger) und strategischer (langfristiger) Ebene unterschieden wird. Beim Militär ist das anders, dort liegt die operative Ebene zwischen Strategie und Taktik, wiewohl auch dort der Begriff der »Operation« in verschiedenen Zusammensetzungen (z. B. Defensiv- oder Offensivoperation, Operationslinie oder Operationsbasis) verwendet wird, ganz abgesehen davon, dass gerade besondere Aktionen spezieller Einheiten mit diesem Ausdruck verbunden werden (z. B. »Operation Neptune’s Spear«, der Name für die Tötung Bin Ladens am 2.5.2011).
Wie man an diesen Beispielen sieht, ist immer dann, wenn von »operativ« gesprochen wird, die unmittelbare Handlung selbst und ihre Zweck-Mittel-Relation gemeint. In der Situation entscheidet sich operativ, was geschieht, und dadurch wird festgelegt oder festzulegen versucht, was darauf folgt oder folgen sollte. Plus ist eben plus und nicht minus, und wie in der Genetik und gemäß dem dort leitenden »Operon-Modell« entscheidet sich durch eine bestimmte Operation, welche Reaktionen sich einstellen, wie es aller Wahrscheinlichkeit nach weitergeht. Der Ausdruck »operativ« bezieht sich also, anders gesagt, auf den unmittelbaren Handlungsvollzug selbst und dessen Verbindung oder Verknüpfung mit anderen zu einer Abfolge zielgerichteter Handlungsketten.
Nun liegt der Einwand nahe, dass dieses zwar für technische Abläufe gelten mag, nicht aber für kommunikative. Macht es überhaupt Sinn, das Erziehungsgeschehen auf diese Weise zu modellieren? Die Antwort lautet schlicht: Ja, es macht Sinn. Denn wir wissen, dass Erziehung funktioniert, und zwar, denkt man in evolutionstheoretischen Dimensionen, schon ziemlich lange. Damit wird nicht bestritten, dass es Unterschiede zur Technik gibt, die sich genauer aufweisen ließen. Gleichwohl: auch die größten, wichtigsten und schönsten Erziehungsziele verwirklichen sich nicht von selbst, sondern müssen durch das enge Nadelöhr pädagogischer Operationen.
Von »pädagogischen Operationen« zu sprechen, mag zwar ungewohnt klingen, ist aber der Sache nach durchaus vernünftig, um damit Handlungsweisen zu kennzeichnen, die sich unmittelbar auf das lernende Bewusstsein der Edukanden richten – manchmal als Eingriff, manchmal vermutlich auch als Angriff, immer aber als Versuch des Zugriffs, der Einflussnahme eben. Wer erzieht, bringt sich als »pädagogischer Operator« zur Geltung, als eine Kraft also, die auf andere Kräfte zu wirken versucht. Insofern, das ist mit dieser Sichtweise notwendig verbunden, sind nicht die Kinder, sondern die Erzieherinnen und Erzieher die Subjekte der Erziehung. Wenn also von »Operativer Pädagogik« die Rede ist, sind hier damit stets all jene Theoriebemühungen gemeint, die den unmittelbaren Handlungsvollzug selbst als Ausgangspunkt zu Grunde legen. Erziehung, das ist für manche vermutlich eine arge Zumutung, wird hierbei also aus der Sicht der Erzieher rekonstruiert und konzeptualisiert. Denn es geht, um auf Kant anzuspielen, um die »Mechanismen in der Erziehungskunst«, sozusagen um pädagogische Technologie und damit zuallererst um die Frage, wie man pädagogisch Wirkungen zu erzielen vermag. Das ist, so könnte man sagen, eine theoriekonstitutive Entscheidung, eine Festlegung eben. Dass damit nicht alle pädagogischen Probleme erfasst oder gar gelöst werden können, liegt auf der Hand. Die Frage ist vielmehr, welche Gestalt eine Theorie der Erziehung annimmt, wenn sie auf diese Weise angelegt wird. Demnach könnte das Motto für dieses Kapitel so lauten: Wenn Du pädagogisch denkst, denke zuallererst operativ (und sieh zu, wie weit Du damit kommst, und welche Probleme sich dann im Fortgang einstellen).
Auf den ersten Blick scheint »zeigen« ein einfacher, schlichter Ausdruck zu sein, geradezu selbstverständlich. Diese vermeintliche Selbstverständlichkeit rührt daher, dass das Zeigen unseren Alltag auf vielfältige Weise durchzieht, ein erster Hinweis darauf, dass ihm für Kultur und Gesellschaft eine ebenso grundlegende wie vielfach verdeckte Bedeutung zukommt: An einer Kreuzung erscheint eine rote Figur in der Ampel, und wir bleiben stehen. Wir sehen Wahlplakate, und denken uns unseren Teil über den Kandidaten und seine Partei. An der Litfaßsäule sehen wir die Ankündigung eines Konzertes, das unser Interesse erregt, und am Abend gehen wir dorthin. Nach einem Einkauf führen wir stolz die schicke Jacke vor, die wir erworben haben. Wir gehen in ein Museum und werden über die Geschichte des Kieler Hafens belehrt. Bei der Anfertigung eines Referats verwenden wir natürlich »power-point«, und später im Seminarvortrag lenken wir die Aufmerksamkeit des Publikums mit dem Laserpointer auf besonders wichtige Teile der projizierten Graphik. Im Laborpraktikum kommt unter dem Mikroskop plötzlich etwas zum Vorschein, was vorher mit bloßem Auge nicht zu erkennen war. Wir kandidieren für ein Amt im AStA und werden aufgefordert, uns vorzustellen. Wir haben in der Statistikübung eine Regressionsgleichung nicht verstanden und bitten eine Kommilitonin, uns den Zusammenhang genauer zu erklären, so dass auch wir es verstehen und selbst damit weiterarbeiten können. Und wenn beim Segeln im Sturm das eigene Wort nicht mehr zu vernehmen ist, reicht ein Handzeichen, um zu wissen, was zu tun ist.
Die Reihe solcher Beispiele ließe sich leicht fortsetzen. Schaut man sie sich genauer an, dann sieht man, dass das »Zeigen«, so selbstverständlich es uns auch erscheinen mag, so selbstverständlich offenbar nicht ist. Es ist daher nicht verwunderlich, dass das »Zeigen« in verschiedenen Wissenschaftsgebieten verstärkt theoretische Aufmerksamkeit gefunden und empirische Forschungen stimuliert hat. »Zeigen« gilt – gerade in jüngster Zeit unter der Formel »iconic« oder »visual turn« – nicht nur in Evolutionstheorie, Anthropologie und Entwicklungspsychologie, sondern auch in den Bildwissenschaften, in Philosophie und vor allem in der Phänomenologie als ein überaus bedeutsames Thema. Die Erziehungswissenschaft befindet sich also durchaus in guter Gesellschaft. Auf dieses weit verzweigte diskursive Netz von Theorien und Befunden kann an dieser Stelle nicht genauer eingegangen werden. 3Hier interessiert zunächst nur die Frage, durch welche gemeinsamen Merkmale sich das »Zeigen« näher bestimmen lässt. Wie die Beispiele deutlich machen, deckt der Ausdruck eine ganze Palette von Verhaltensweisen oder Phänomenen, und er wird offensichtlich in sehr verschiedenen Situationen verwendet. Was ist das Gemeinsame, gibt es einen strukturellen Kern des Zeigens?
Читать дальше