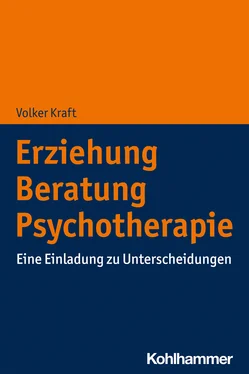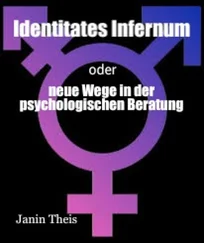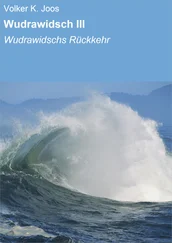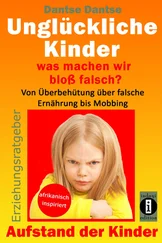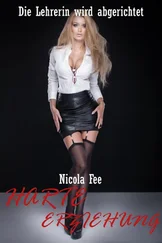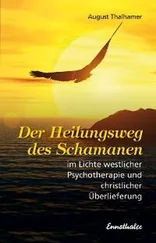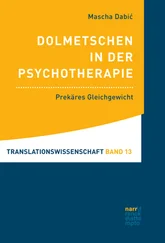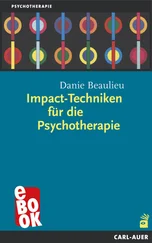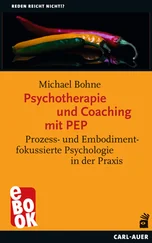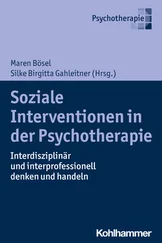Dieser Akzent auf Differenzen ist nicht ohne Probleme. Denn einerseits ist Beratung mittlerweile ein weit verzweigtes Feld mit einer Vielzahl von theoretischen Ansätzen, Konzepten und Methoden (vgl. Nestmann/Engel/Sickendiek 2004; 2013), wie andererseits gerade auch Psychotherapie als Teil der Psychologie und der Medizin ein komplexes eigenständiges Fachgebiet darstellt. Angesichts der damit verbundenen Materialfülle muss daher versucht werden, sie umsichtig so zu reduzieren, dass gleichwohl die Unterschiede und Unterscheidungen sichtbar und prägnant herausgearbeitet werden können. Das soll, wie in der Gliederung des Inhaltsverzeichnisses deutlich wird, in drei Hinsichten versucht werden, die gleichsam drei Ebenen der Unterscheidung repräsentieren.
Im ersten Kapitel ( 
Kap. 1 1 Differenzen in operativer Perspektive In diesem Kapitel stehen die Unterschiede der drei Handlungsformen (Erziehung – Beratung – Psychotherapie) auf der Ebene der Operationen im Mittelpunkt. Dazu bedarf es einiger begrifflicher Klärungen und der Erläuterung der theoretischen Werkzeuge, die dabei verwendet werden: Zunächst ist zu klären, was hier mit dem Ausdruck »operativ« gemeint ist ( Kap. 1.1.1 ), dann wird die Zeige-Theorie in ihren Grundannahmen näher erläutert ( Kap. 1.1.2 ). Nach diesen Vorklärungen stehen die drei Handlungsformen selbst im Mittelpunkt, also die jeweiligen Zeigestrukturen von Erziehung ( Kap. 1.2 ), Beratung ( Kap. 1.3 ) und Psychotherapie ( Kap. 1.4 ); als Abschluss dieses Kapitels wird der Ertrag dieser Bemühungen zusammengefasst ( Kap. 1.5 ).
) wird es um »Differenzen in operativer Perspektive« gehen, das ist die Ebene der Interaktion, also der spezifischen Form des Sprechens in den drei kommunikativen Praxen. Zunächst einmal müssen die Tatbestände ja phänomenologisch beschrieben und so gesichert werden, dass klar wird, worum es eigentlich geht. Das theoretische Werkzeug, das hierfür vornehmlich verwendet werden soll, ist die »Zeige-Theorie«, da alle drei Formen des kommunikativen Handelns der Sache nach auch als Zeigeformen verstanden werden können. Denn die Zeigestruktur der Beratung ist eine andere als die Zeigestruktur der Psychotherapie, und beide unterscheiden sich von der Zeigestruktur der Erziehung.
Im zweiten Kapitel ( 
Kap. 2
) wird nachgezeichnet, wie die drei Zeigestrukturen berufsförmige Gestalt gewinnen. Denn alle drei Interaktionsformen brauchen Menschen, die sie leibhaftig vergegenwärtigen und sie verwirklichen. In modernen Gesellschaften gibt es dafür Berufe und Professionen, die eben »professionell« handeln und in aller Regel auch dafür bezahlt werden, »Interaktionsagenten« sozusagen. Dafür wird man ausgebildet, muss studieren und bestimmte Praxiserfahrungen sammeln, bevor man selbständig und in jeweils spezifischen Grenzen autonom tätig werden darf. Die Palette pädagogischer Berufe ist weit gefächert, es gibt eine Vielzahl von Ausbildungsgängen und Handlungsfeldern; der berufliche Korridor der Psychotherapie erscheint demgegenüber sehr viel enger zu sein und genießt, wenn er in eigener Praxis ausgeübt wird, zudem den Status einer Profession. Das professionelle Bild der Beratung zeigt sich hingegen äußerst schillernd, denn einerseits gibt es nur sehr wenige eigenständige Beratungsberufe, andererseits wird Beratung in zunehmendem Maße und in immer mehr Bereichen ausgeübt.
Nun schweben die drei Handlungsformen mit den dazugehörigen Berufen nicht im luftleeren Raum, sondern sie sind kulturell fundiert, sozial institutionalisiert und gesellschaftlich organisiert. Durch diese besondere Art der Rahmung gewinnen sie überhaupt erst eine gewisse Verlässlichkeit und Stabilität, denn so werden die jeweiligen Interaktionen von individuellen Umständen, Motiven und Zufällen unabhängiger. In moderner Diktion: diese drei Formen von Interaktion sind Teil von spezifischen sozialen Systemen. Deswegen geht es abschließend im dritten Kapitel ( 
Kap. 3
) um die »Differenzen in systemfunktionaler Perspektive«. Die Erziehung gehört in das Erziehungssystem, während die Psychotherapie Teil des Gesundheitssystems ist. Wie lassen sich diese beiden Systeme theoretisch unterscheiden, und welche Einsichten folgen daraus? Und schließlich: Wo bleibt in dieser Sichtweise die Beratung? Gibt es auch ein eigenes Beratungssystem, oder kommt der Beratung nicht vielmehr eine Sonderstellung zu? Gerade die letzte Frage macht deutlich, dass es durchaus Sinn macht, auch auf systemfunktionaler Ebene den Unterschieden nachzugehen.
Es sind also, zusammengefasst, drei Ebenen, auf denen jeweils Unterschiede und Unterscheidungen zum Thema werden sollen: Operation und Interaktion (Ebene 1), Profession (Ebene 2) und System (Ebene 3); im Vorgriff auf systemtheoretische Einsichten könnte man auch sagen: Interaktion, Organisation und Gesellschaft.
Der Umstand, dass zu jeder der drei genannten Aspekte eine Fülle von Material zur Verfügung steht, kann für die Darstellung nicht ohne Folgen bleiben. Um sich in den komplexen und teilweise auch miteinander verwobenen Sachverhalten nicht zu verlieren, muss also drastisch reduziert und vereinfacht werden. Das ist, wie immer bei Vereinfachungen, nicht ohne Risiko. Denn der Autor läuft Gefahr, sich als »terrible simplificateur« zu erweisen, ein Ausdruck, den Jacob Burckhardt in einem Brief an Preen erstmals 1889 als seitdem häufig verwendeten Lehnbegriff in die deutsche Sprache eingeführt hat, als jemand also, der die Dinge auf grobe und unzulässige Weise vereinfacht, sie dadurch entstellt und ihnen nicht gerecht wird. Allerdings gibt es nicht nur unzulässige, sondern auch zulässige Vereinfachungen. Zulässig sind sie immer dann, wenn mit ihrer Hilfe versucht wird, in komplexe Sachverhalte auf elementare Weise einzuführen (vgl. Benner 2020). Es ist so wie mit dem Erlernen einer neuen Sprache, denn dabei beginnt man ja auch nicht mit grammatikalischen Ausnahmen, Sonderformen, Überschneidungen und semantischen Raffinessen, sondern zunächst mit dem möglichst Einfachen, das dann im Fortgang relativiert, modifiziert und verfeinert wird.
Diesem Prinzip der Darstellung soll hier gefolgt werden. Der Anspruch ist also nicht, mit diesem Text alle Fragen pädagogischen Denkens vollständig und abschließend zu behandeln (und sozusagen en passant auch gleich noch jene der Beratung und Psychotherapie), sondern vielmehr, gleichsam im Sinne einer Minimaldefinition, das herauszuheben und zu sichern, das notwendig gegeben sein muss, wenn pädagogisch gedacht und argumentiert werden soll. Ob das gelingt, lässt sich allerdings erst am Ende beantworten.
Für den Aufbau des Buches und für die Gestaltung der einzelnen Kapitel hat dieses Prinzip (»so-einfach-wie-möglich«) bestimmte Konsequenzen. Es gibt drei Kapitel, die jeweils Differenzen aus drei spezifischen Perspektiven zum Gegenstand haben. Jedes Kapitel beginnt mit einem Abschnitt über »Begriffliche Klärungen und theoretische Werkzeuge«. Hier werden nur die Begriffe eingeführt und erläutert, die für den jeweiligen Abschnitt von grundlegender Bedeutung sind und ohne deren Kenntnis der Gang der Darstellung nicht nachvollziehbar wäre. Danach folgt jeweils der »begriffliche Dreiklang« von »Erziehung – Beratung – Psychotherapie« in Form von drei eigenen kleinen Durchführungen (nur im letzten Kapitel wird aus Gründen einer prägnanteren Darstellung diese Reihenfolge verändert). Am Ende jedes Kapitels findet sich eine Zusammenfassung, in der auch auf Überschneidungen, Grauzonen und theoretische Anschlussmöglichkeiten hingewiesen wird. Es gibt ein umfangreiches Literaturverzeichnis; die Darstellung selbst wird daher von erweiternden Kontexten und theoretischen Hintergründen möglichst frei gehalten.
Читать дальше