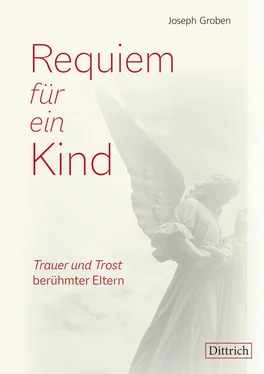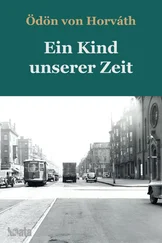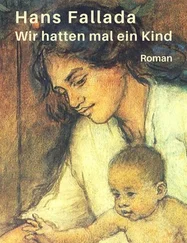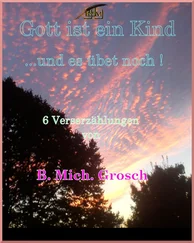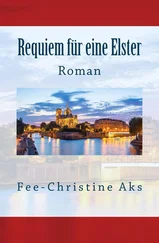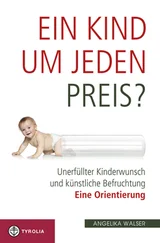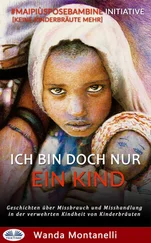1 ...6 7 8 10 11 12 ...25 Cicero selbst verließ fluchtartig Tusculum, das ihm unerträglich geworden war, und fand Zuflucht bei Atticus. Er suchte Trost in dessen Bibliothek, indem er sämtliche Werke über das Thema des Trauerschmerzes durchlas. »Auf diese Weise bleibt meine Trauer innerhalb der Grenzen, welche die Philosophen vorschreiben. Ich habe nicht nur alles gelesen, was sie zu diesem Thema geschrieben haben, was an sich schon Mut erfordert, sondern ich habe es in mein Werk übertragen …« Da er möglichst jeden Kontakt mit Besuchern meiden wollte, zog er sich schließlich auf ein Landgut zurück, das er in Astura, am Meer, gekauft hatte. Dort gab es einen dichten undurchdringlichen Wald, in dem er sich den ganzen Tag aufhielt, um zu lesen, zu meditieren und zu schreiben. In mehreren Briefen an Atticus teilte er seine Absicht mit, eine »consolatio«, eine Trostschrift, »an sich selbst« zu verfassen, um seinen Schmerz zu lindern (»librum de minuendo luctu«), »Ganze Tage schreibe ich, nicht damit ich dadurch etwas gewinne, doch es lenkt mich eine Weile ab. Freilich nicht genug – der Schmerz ist übermächtig – aber ich erhole mich doch dabei und bin nach Kräften bemüht, wenn nicht den Geist, so doch meine Miene so weit wie möglich in Fassung zu bringen. Wenn ich das tue, komme ich mir bisweilen vor, als beginge ich ein Unrecht; bisweilen glaube ich auch wieder, es sei unrecht, wenn ich es nicht tue.«
Die »consolatio«, die er »mitten in der Trauer und im Schmerz« verfasste, ist verschollen, nur einige Fragmente davon sind überliefert worden, u.a. vom hl. Hieronymus. Aber das große philosophische Werk der »Tusculanae disputationes«, das im August jenes Jahres entstand und verwandte Themen behandelt, ermöglicht es, den Inhalt dieser Trostschrift zu rekonstruieren, umso mehr als Cicero sich auf einige Autoren beruft, deren Ideen zum philosophischen Gemeingut des Altertums gehören. Als Einleitung entwickelt Cicero folgende »tröstliche« Hauptideen: Es ist kein Übel, jung zu sterben, das menschliche Dasein ist so traurig, dass es gut ist, daraus zu fliehen. Cicero kritisiert die Argumente gegen das Leid, die von den verschiedenen philosophischen Schulen des Altertums vertreten wurden, von den Peri-Patetikern, den Epikuräern, den Stoikern usw. Stichhaltig und wirksam erscheint ihm nur die Beweisführung Crantors, eines Akademikers, der sich an Platos Lehre anlehnt, vor allem an seine Lehre von der Unsterblichkeit der Seele. Seelen wie die Tullias können nicht vergehen, so wenig wie die Seelen großer Menschen der Vergangenheit, wie z.B. die Scipios. Mit dem Tode seiner Tochter wird diese Hypothese nicht bloß eine Hoffnung für ihn, sie wird ihm zur Gewissheit – oder zu einer notwendigen emotionalen Kompensation.
Vielleicht traute Cicero seiner Trostschrift nicht zu, ein zeitüberdauerndes Zeugnis, ein »monumentum aere perennius« zu sein. Jedenfalls unterbreitete er am 11. März seinem Freund Atticus sein Projekt, ein Marmordenkmal für Tullia zu errichten. Dieses Heiligtum sollte kein Grabmal sein, eher eine Kapelle oder ein kleiner Tempel, der von Säulen umgeben wäre (»De fano illo dico, de quo tantum, quantum me amas, velim cogites …« Ad Att, XII, 18). Als Begründung fügte er hinzu: »Vielleicht reißt das meine Wunden wieder auf, aber ich fühle mich wie durch ein Gelübde oder ein Versprechen gebunden.«
Bei den Griechen errichtete man solch ein Gebäude, das sie »heroon« nannten, zu Ehren von Personen, denen man eine göttliche Natur zusprach, z.B. Städtegründern, mythischen Vorfahren usw. Insgesamt sahen manche Philosophen damals in den überlieferten Gottheiten nur Sterbliche, die der Menschheit große Dienste geleistet hatten und dadurch »unsterblich« geworden waren. Sie argumentierten, dass ein Wesen, das mit einer außergewöhnlichen Intelligenz ausgestattet sei, nicht auf ewig verschwinden könne; dieselbe Überlegung war gültig für alle Wesen, die besonders geliebt und verehrt wurden. Die Toten besaßen, in ihren Augen, ein eigenes Leben, eine immaterielle Existenz, die sie halbwegs zwischen ihrem früheren Aufenthalt und jenem der überlieferten Gottheiten führten. So wurde Tullia heroisiert. Dank der Liebe, die sie verdiente und die ihr entgegengebracht wurde, hatte sie eine unvergängliche Daseinsform gewonnen.
Cicero ging unverzüglich an die Verwirklichung seines Planes heran. Bereits im Sommer gedachte er, das Heiligtum zu vollenden (»Cogito … ita tamen, ut hac aestate fanum absolutum sit«, ad Att. 14.3.45). Er beauftragte den Architekten Cluatius mit dem Entwurf, er beabsichtigte, den Bau »mit allen Verzierungen der griechischen und römischen Kunst zu dekorieren.« Atticus wurde beauftragt, wegen der Beschaffung von Marmorsäulen mit Apelles von Chio zu verhandeln.
Mehrere Monate lang suchte Cicero einen geeigneten Platz für das Heiligtum. Er dachte zuerst an die Insel Arpinas, seinen Geburtsort, dann an sein Landgut Tusculum, dann an den Meeresstrand von Ostia. Alle drei Standorte wurden schließlich verworfen, weil sie zu weit entfernt und abgelegen waren. Deshalb unternahm Cicero Schritte, um einen Garten in Rom selbst zu erwerben. Aber die angesprochenen Besitzer wollten nicht verkaufen, trotz der Bereitschaft Ciceros, einen sehr hohen Preis zu bezahlen. »Hab nur keine Angst wegen der Preise für diese Gartengrundstücke. Ich brauche kein Silbergeschirr mehr, keine Teppiche, keine schön gelegenen Villen wie einst: Nur dies Eine brauche ich noch.«
Am besten gefielen ihm die Gärten eines gewissen Scapula, weil dort immer viel Volk vorbeikam (»maxima celebritas«). Damit würde der Kult für Tullia eine echte Aussicht auf Popularität erhalten. Diesen Plan eines zentral gelegenen Standortes musste er aufgeben, als er hörte, dass die Gärten Scapulas im Perimeter der Urbanisierungspläne Cäsars lagen. Er konnte es sich nicht leisten, die Erweiterung des Marsfeldes zu behindern. Atticus gab zu bedenken, dass die Megalomanie des Tempelbaus Ciceros Vermögensverhältnisse überforderten. Vergeblich bemühte sich dieser um Anleihen (»video etiam a quibus adiuvari possim«). Angesichts der sich häufenden Schwierigkeiten bekräftigte er am 3. Mai 45 nochmals: »Ich will, dass dieser Tempel gebaut werde und nichts kann mich von diesem Vorhaben abbringen.« Deutlich betonte er, dass es ihm nicht um ein Grabmal gehe, sondern um eine »Apotheose«. Im lateinischen Text steht das griechische »αποθϵωσιν«.
Als Atticus die Befürchtung aussprach, dass Ciceros Trauer seinem Ansehen schaden könne, antwortete dieser mit der vorwurfsvollen Frage: »Ich sollte nicht trauern? Wie könnte man das?« Dennoch wurde es bald merklich still um das Anliegen. Im Spätsommer 45 verlor sich das Thema im Briefwechsel. War der Bau vollendet? Es ist eher wahrscheinlich, dass das Tempelchen nie gebaut wurde.
In Max Brods Roman wird das Projekt im Rückblick folgenderweise dargestellt: »Tullia war tot, vor einem Jahr gestorben, zum unbeschreiblichen Schmerz des Vaters, dem sie das Liebste auf Erden gewesen war … Hatte der Jammernde damals nicht einen Tempel zum Gedächtnis Tullias bauen wollen, – nicht etwa eine Grabstätte; denn für ihn sollte sie nicht tot sein, als Gottheit sollte sie weiterleben, verehrt von ihm und von allem Volk. Deshalb sollte ja auch der Tempel unbedingt an einer vielbefahrenen und begangenen Straße liegen. Monatelang hielt der Konsular Ausschau nach einem passenden Grundstück …« ( S. 32) Im Roman sind es die »schrecklichen Zuckungen des Bürgerkriegs«, welche die Verwirklichung des Tempelbaus vereitelten.
Die philosophischen Werke
Der Tod seiner Tochter bedeutete auch eine Krise im Denken Ciceros. Er wurde zum Anlass, die großen Theorien kritisch zu überprüfen. Nie war Cicero philosophisch so produktiv wie in den Monaten nach Tullias Tod. Er betäubte seinen Kummer in einer ungeheuren Arbeitswut, die ihm fast keine Zeit zum persönlichen Grübeln übrigließ. Die lateinische Literatur verdankt dieser übermenschlichen »Trauerarbeit« einige ihrer besten Bücher, inhaltlich wie stilistisch. Es darf nicht vergessen werden, dass die Grammatik und Stilistik der lateinischen Sprache wesentlich auf den Werken Ciceros und Cäsars beruhen. Ciceros Reden und Abhandlungen bilden das Rückgrat der Latinität, er schuf die klassische lateinische Sprache, die für Jahrhunderte gültig blieb.
Читать дальше