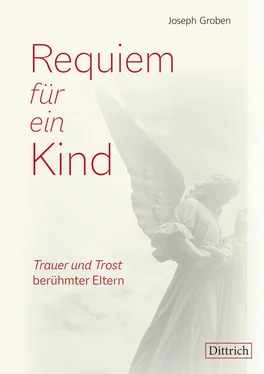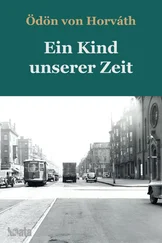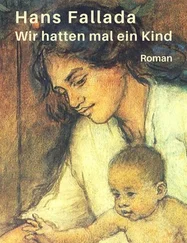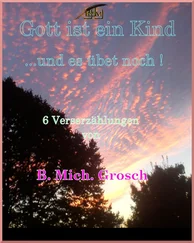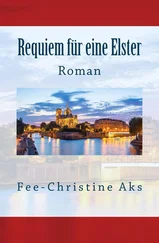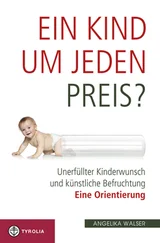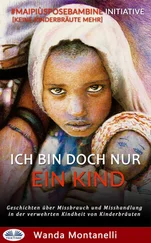Nach dem Tod seines einzigen Kindes und seiner Frau schrieb Lessing recht philosophisch und geistreich: »Die Freude war nur kurz. Und ich verlor ihn so ungern, diesen Sohn! Denn er hatte soviel Verstand! Soviel Verstand! – Soviel Verstand! … Glauben Sie nicht, dass die wenigen Stunden meiner Vaterschaft mich schon zu einem Affen von Vater gemacht haben! Ich weiß, was ich sage. War es nicht Verstand, dass man ihn mit eisernen Zangen auf die Welt ziehen musste? Dass er so bald Unrat merkte? War es nicht Verstand, dass er die erste Gelegenheit ergriff, sich wieder davon zu machen? Freilich zerrt mir der Ruschelkopf auch die Mutter mit fort.« Wenn er dann noch hinzufügt: »Ich wollte es auch einmal so gut haben wie andere Menschen. Aber es ist mir schlecht bekommen«, so verstehen wir, dass hier jemand in seinem Tiefsten getroffen ist, dass er aber seinen Schmerz heroisch-männlich niederkämpft. Nicht bei jedermann haben Tränen eine heilsame Wirkung.
Rabindranath Tagore zeigte äußerlich keine Trauer beim Verlust seiner drei Kinder, weil er sich schämte, vor aller Augen seinen Schmerz »zu erniedrigen«.
Igor Strawinsky verlor 1938 seine fast 30-jährige Tochter Ludmilla, deren Tragödie er hautnah am Krankenbett miterlebt hatte. Aber in seinem Konzert »Dumbarton Oaks«, das er gerade damals komponierte, findet sich keine Spur einer Trauerarbeit. Beim Tode bedeutender Persönlichkeiten schrieb er jedoch eine beachtliche Reihe von Elegien, von Rimsky-Korsakov bis Kennedy.
Thomas Mann ging 1948 sofort nach dem Freitod seines Sohnes Klaus zur »Tagesordnung« über und sagte keinen einzigen öffentlichen Auftritt ab. Offensichtlich wollte er sich nicht die Blöße geben, einem Fremden Einblick in sein innerstes Gefühlsleben zu gewähren. Die Trauer blieb seine Privatsphäre. Ihm war deutlich bewusst, was Platen so scharf und pessimistisch formuliert hat:
»Es liegt an eines Menschen Schmerz, an eines Menschen Wunde nichts ,
Es kehrt an das, was Kranke quält, sich ewig der Gesunde nichts!«
André Malraux verlor am 23. Mai 1961 bei einem Verkehrsunfall seine beiden einzigen Söhne Gauthier und Vincent. Wenige Tage darauf nahm er an einem offiziellen Empfang bei de Gaulle teil und führte als Kulturminister den amerikanischen Präsidenten Kennedy durch die Prunkräume von Versailles, ohne ein einziges Wort über seinen Verlust zu verlieren.
Vielleicht sollte man in diesem Zusammenhang auch ein prominentes Gegenbeispiel anführen: Joe Biden, der 46. Präsident der Vereinigten Staaten, kam immer wieder auf seine persönlichen Verluste zu sprechen, auf den frühen Tod seiner Frau und seiner Tochter, besonders auf den Tod seines erfolgreichen Sohnes Joseph Robinette Beau, der am 30. Mai 2015 an einem Hirntumor gestorben ist. Am Vorabend seiner Vereidigung, am 19. Januar 2021, würdigte er dessen Verdienste und fügte hinzu: »I only have one regret. Beau is not here. Because we should be introducing him as president.« Nur allzu gerne hätte er seinem Sohn die Präsidentschaft überlassen.

Die Gräfin von Nassau-Saarbrücken mit ihren drei Kindern .
Allerdings, in einer Gesellschaft, deren Wertmesser nur Glück, Schönheit und Erfolg gelten lassen, ist Trauer eine höchst unwillkommene Erscheinung. Ihre äußeren Zeichen werden als Störfaktor und Zumutung empfunden und müssen tunlichst in die Unsichtbarkeit verbannt werden. Wer dennoch Trauer bekundet, begibt sich ins Abseits der Isolation. Bei einem Großteil der Bevölkerung scheint die Fähigkeit zu trauern oder mitzuleiden völlig abhandengekommen zu sein. Für sie ist bereits der obligate alljährliche Friedhofsbesuch zu Allerseelen oder zum Totentag eine Belastung und ein leeres Ritual. Wie sollten sie echten Anteil am Schmerz anderer, fremder Menschen nehmen? Die Trauer gehört zu jenen einsamen Grenzerfahrungen, die man nur versteht, wenn man sie selbst durchleben muss.
Das Verhältnis des modernen Menschen zum Tod, auch wenn das Todesthema durch die grausigen Berichte des Bildschirms »enttabuisiert« scheint, bleibt höchst ambivalent, und meistens geradezu unaufrichtig. Jeder ist bereit einzusehen, dass der Tod der natürliche und unabwendbare Ausgang des Lebens ist. Dennoch versuchen alle, wie Freud scharfsinnig entlarvend formuliert, den Tod »totzuschweigen, denn im Unbewussten ist jeder von seiner Unsterblichkeit überzeugt« (Zeitgemäßes über Krieg und Tod, 1915).
Kleine Anthologie der trauernden Eltern
Die vorliegende Sammlung versucht, eine Reihe von authentischen Einzelschicksalen anhand von Dokumenten, seien es Tagebücher, Briefe, Gedichte, Romankapitel, Bildwerke oder musikalische Kompositionen, vorzustellen, die aus Anlass solch eines Verlustes entstanden sind. Es sind Berichte ohne Ausschmückung oder Wehleidigkeit, ohne psychologisierende Zergliederung oder Besserwisserei, rein faktographische Darstellungen, die für sich sprechen sollen. Jeder der chronologisch geordneten Artikel möchte gleichzeitig, obwohl er hauptsächlich auf den Verlust des Kindes und den Trauerprozess zentriert ist, auch ein knappes Lebensbild des Betroffenen vermitteln. Die Darstellung greift etwas weiter aus bei Persönlichkeiten, die zwar berühmt sind, deren Biographie aber beim Leser nicht ohne weiteres als bekannt vorausgesetzt werden kann.

Kinderfriedhof auf dem Berg Takao (Japan) .
Die Auswahl der Beispiele, die auf einer breiten Recherche beruht, wurde aus verschiedenen Epochen und Ländern des abendländischen Kulturkreises – Tagore ist eine Ausnahme – mit Schwerpunkt auf dem 19. und 20. Jahrhundert getroffen. Alle diese Fälle erschütterten das Leben der Eltern – Hofmannsthal starb zwei Tage nach dem Freitod seines Ältesten, Kaiserin Elisabeth trug Trauerkleidung bis ans Ende ihres Lebens – und wurden Anlass zu einer langen »Trauerarbeit«, ob die Trauernden nun tiefgläubige Christen waren wie Andres, Eichendorff und Rückert, oder überzeugte Atheisten wie Marx und Freud. In solch tragischen Situationen ist auch der Unterschied zwischen einem Sonnenkönig und einem Revolutionär nicht gewaltig; wenn die Axt an die Wurzeln gelegt wird, erweist sich fast jedes Vaterherz als weich und verwundbar.
Die sprachliche Vielfalt der Texte hat zur Folge, dass alle nichtdeutschen Texte in Übersetzungen aufgenommen wurden. Um dennoch einen Hauch des Originals zu vermitteln, schien es angebracht, auch eine Reihe von Kern-Zitaten in der Originalsprache einzustreuen (mit Übersetzung oder Umschreibung). Zudem bedient sich der Trauernde meist nur des schlichten Grundwortschatzes, weithergeholte Ausdrücke und Metaphern sind dem Gegenstand wenig angemessen.
Eine besondere Aussagekraft kommt dem Bildmaterial zu. Wer z.B. das große Familienportrait A. Manzonis mit seinen Kindern sieht, von denen sieben ihm im Tode vorausgingen, ermisst mit einem Blick das tragische Familienleben des gefeierten Dichters; die Aufzeichnung der »letzten Worte« Olga Janaceks, deren »Sprechmelodien« teilweise in die Oper »Jenufa« eingeflossen sind, vergegenwärtigt fast unerträglich grell die Agonie des Mädchens und die Verzweiflung des Vaters.
Vielleicht hilft es Eltern, die einen ähnlichen Verlust erlitten haben, zu erkennen, wie sich andere Menschen, sogenannte »berühmte« Menschen, ihre Schicksalsgenossen in der »Brüderschaft der vom Schmerze Gezeichneten« (Schweitzer), zu einem Ausdruck durchrangen, oft wieder neuen Halt gewannen oder sich wenigstens mit ihrem Leid abfanden. Für den verschonten oder »ungeprüften« Leser können diese Artikel ein Anlass sein, ein besseres Verständnis für die Lage und das vielleicht andersartige Benehmen der trauernden Eltern zu finden, ein Benehmen, das man ihnen leicht übel nimmt: ihre Scheu, ihr Schweigen, ihre latente Schwermut, ihr unfrohes Lachen, ihr geringes Interesse am Treiben der Welt, am Jahrmarkt der Eitelkeiten. Der neuerdings gebrauchte Ausdruck von »verwaisten Eltern« umschreibt wohl am nächsten, in Ermangelung einer adäquaten sprachlichen Bezeichnung, ihre seelische Verfassung. Das Buch möchte auch Brücken schlagen zwischen den zwei Welten, über den Abgrund hinweg, der die glücklichen Eltern von den einst auch glücklichen, aber jetzt trauernden Eltern trennt.
Читать дальше