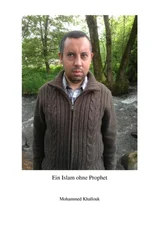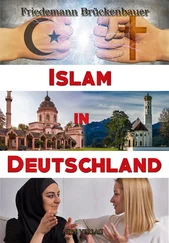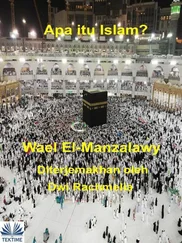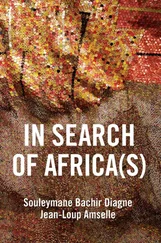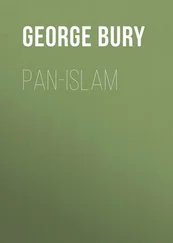Dialoge also mit Plotin, Platon, Aristoteles, heute mit Nietzsche, Bergson und anderen … Die Kapitel, die man lesen wird, stellen mehrere Dialoge dar, von denen manche im Traum stattfanden, andere waren Konfrontationen oder sogar richtige Gefechte. Sie sagen uns vor allem, dass die Philosophie im Islam nicht durch die Selbstverschlossenheit eines geistigen Universums gekennzeichnet ist, das abseits jenes Abenteuers stünde, das man als „westlich“ nur dann definieren kann, wenn man es von allem abschneidet, was nicht aus dem „Westen“ stammt und von dem es doch auch zehrt.
Dialoge auch deshalb, weil die Philosophie nicht „hervorgeht“, kein natürlicher Ausdruck weder einer Kultur noch einer Religion ist. Sie ist jenes oft lebhafte Gespräch, in dem Personen begriffen sind, die wissen, was freies Denken bedeutet und wert ist, und dies verlangt, sich von den unmittelbaren Bedeutungen frei zu machen, in denen uns die Kulturen und Religionen einschließen. Diese Personen tauschen sich also jenseits der Zeiten und Zugehörigkeiten aus: Die Gesellschaft der Philosophen weitet sich immer mehr aus.
Was bedeutet es für diese Dialoge, sich „im Islam“ zu verorten, das heißt von Gegenständen, Texten und Erzählungen zu sprechen, die Teil der muslimischen Tradition sind? Anders gesagt, handelt es sich noch um Philosophie, wenn man damit beginnt, den Gott des Monotheismus zu setzen, d. h. mit einer Offenbarung, die von ihm stammt und die man akzeptiert, und mit einer Menge an Glaubensinhalten, die sich aus dieser Akzeptanz ergeben? So wie der Heilige Augustinus oder Thomas von Aquin Philosophen und Christen sind, sind Avicenna, Averroes und andere, um die es auf den folgenden Seiten gehen wird, Philosophen und Muslime. Dass das nicht ohne Probleme vor sich geht, ist gewiss, doch im Islam philosophieren heißt, wie man sehen wird, gerade über die Texte und Erzählungen, die durch die Tradition gegeben sind, der Vernunft gemäß sprechen zu wollen, das heißt über sie zu sprechen, ohne sie jemals den Anforderungen der Verständlichkeit und der Mitteilbarkeit zu entziehen, die den philosophischen Dialog leiten. Dieser Wille beruht selbst wiederum auf der Überzeugung, dass es eine menschliche Weisheit gibt, die in höchstem Maße abseits jeglicher Offenbarung durch den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs bei göttlichen Personen – göttlich in dem Sinne, in dem man beispielsweise vom „göttlichen“ Platon spricht – gestrahlt hat, und dass diese Weisheit helfen muss, die Wahrheit der religiösen Bedeutungen philosophisch zu konstruieren.
Es kommt vor, dass die Missverständnisse im Hinblick auf die Bedeutung des Ausdrucks „Philosophieren im Islam“ bei denjenigen zur Ablehnung führen, die meinen, dass dieses Philosophieren zahlreichen „Ungläubigen“ ( infidèles ) einen zu großen Platz einräumt. Glücklicherweise kommt es öfter vor, dass man darin die Einladung sieht, sich zu fragen, was Treue ( fidelité ) ist, wem und in welchem Sinn man jemandem oder einer Sache die Treue halten kann; Treue ist nicht Versteifung gegen die Zeit und gegen den Unterschied, weit gefehlt, sie ist im Gegenteil Bewegung und Pluralismus. Auf den folgenden Seiten wird dieser Einladung forschend nachgegangen.
1. Ist es möglich, nicht zu philosophieren?
Im Jahr 632 unseres Zeitalters stirbt Mohammed in Medina. Er wurde zweiundsechzig Jahre alt. Mit vierzig Jahren, im Jahr 610, wurde er zum Propheten, als er mit seiner Mission, den Glauben an einen einzigen Gott zu verbreiten, erklärte, dass er der Träger einer Botschaft sei, Träger des ihm offenbarten Korans, des Wortes Gottes selbst. Aus diesem Wort ist trotz der Verfolgungen, der Verbannung, des erzwungenen Exils und der Versuche, ihn militärisch zu vernichten, eine Religion entstanden, der Islam, der darauf abzielte, die alten Stammesverbindungen aufzulösen und stattdessen eine Gemeinschaft zu errichten, die auf radikal anderen Regeln des individuellen und kollektiven Lebens gründet als das bisher Dagewesene. Der Koran wurde als Inspiration verstanden, aus der diese Gemeinschaft entstand und sich entwickelte. Doch das von Mohammed offenbarte Wort, in dem Gott sagt, wer er ist und welche Bedeutung seine Schöpfung hat, welchen Ursprung und Zweck der Mensch hat, bildet keine Abhandlung über das Regieren oder ein Rechtssystem. Man braucht übrigens nur einen Blick auf die Gestalt des Korantextes zu werfen – der 6236 Verse enthält (oder 6219, je nach Aufteilung), die unterschiedliche Themen behandeln, die wiederum nach ihrem Umfang in 114 Kapitel unterteilt sind, die nach dem Tod des Propheten von seinen engsten Vertrauten zusammengestellt wurden –, um sich davon zu überzeugen, dass man in diesen Versen, bei denen man von einer Erzählung zu einer Ermahnung, von einer Gesetzgebung zu mystischen Vergleichen übergeht, weder eine Abhandlung noch ein System finden kann. Dazu kommt, dass der Korantext, der sehr oft über sich selbst spricht, darauf hindeutet, dass manche seiner Stellen nichts Explizites haben für diejenigen, die sich an ihre bloß buchstäbliche Bedeutung halten wollen, sondern da sind, um diejenigen zum Denken zu bringen, die nachdenken können.
Mohammed brachte prophetische Klarheit in die Fragen, die entstehen konnten, solange er im Kreise seiner Gefährten lebte, die er selbst ausbildete, an der Spitze jener ersten muslimischen Gemeinschaft, deren Anführer er dreiundzwanzig Jahre lang war, in denen die Offenbarung sich in Versen enthüllte, die oft den Umständen geschuldet waren, um ihre Bedeutung zu erhellen, aber auch über sie hinaus gingen. „Wie soll man diese Koranstelle verstehen?“, fragte ein Gefährte. Mohammed machte es deutlich. Was soll man in dieser Situation tun? Er antwortete. Aber er hatte verboten, ihm Probleme reiner Spekulation vorzulegen, sich Situationen in einer Kasuistik auszudenken und zu fabrizieren, die sich selbst zum Gegenstand nimmt und somit von der Bewegung des Lebens löst, das allein die wirklichen Fragen aufwirft. Der Sinn dieses Verbotes ist klar: Man muss die Zukunft offen lassen und darf nicht versuchen, sich Möglichkeiten nur deshalb auszumalen, um sie zu erschöpfen und somit zu verschließen.
Der Tod des Propheten bedeutete gerade die beängstigende Erfahrung dieser Offenheit. Es blieben zwar seine Deklarationen, die manche gesammelt hatten, und die Taten, die er unter vielen Umständen gesetzt hatte; all das bildete seine Tradition, seinen Brauch: seine Sunna , wie der Araber sagt. Wenn man eine Entscheidung, eine Interpretation, eine Meinung bestätigen konnte, indem man auf einen Ausspruch des Propheten ( Hadith ) zurückgriff, war es, als habe dieser selbst gesprochen. Doch es musste auch einen Ausspruch geben, der auf den in Frage stehenden Fall anwendbar war, und dieser Hadith musste auch authentisch sein. (Als später die Wissenschaft der Traditionen, der Hadithe sich ausbildete, waren die Fragen, für die man Antworten finden musste, um zu entscheiden, ob ein Hadith gut etabliert sei oder nicht, von folgender Art: Welche mündliche Überlieferungskette besteht für diesen Hadith? Ist sie glaubwürdig? Bis zu welchem Punkt?) Und wenn es keinen Hadith gab? Und wenn mehrere Aussprüche, die auf den fraglichen Fall angewandt werden können, in unterschiedliche Richtungen führten? Der Botschaft des Propheten treu zu bleiben, indem man seine Sunna , seinen Brauch weiterführt und somit jede Erneuerung vermeidet, die eine Abweichung von dem Weg darstellt, den er vorgezeichnet hatte, war natürlich das, was es zu tun galt. Doch wenn das Leben selbst ohne Unterlass in Erneuerung begriffen war, wie galt es, diese Treue zu verstehen? Was verlangte sie unter den ständig sich erneuernden Umständen, die die Bewegung des Lebens mit sich bringt?
Der Prophet war noch nicht begraben, als die fürchterliche Erfahrung der Optionen, die sein Tod offenhielt, sich der Gemeinschaft, die er um den Koran und seine eigene Person zusammengeschweißt hatte, auferlegte. Hatte er, als er in seinen letzten Tagen krank gewesen war und seinen Freund und treuen Gefährten Abu Bakr gebeten hatte, die gemeinschaftlichen Gebete zu leiten, nicht damit anzeigen wollen, dass dieser sein Nachfolger ( Kalif ) an der Spitze der neuen Nation sein solle? Es sei denn, die zahlreichen Bezeugungen der Zuneigung gegenüber seinem Cousin, Adoptivsohn und Schwiegersohn Ali bedeuteten, dass ihm und seiner Nachkommenschaft mit der jüngsten Tochter des Propheten, Fatima, die Rolle des Imams (Führer) der Gläubigen zukomme? Hatte er nicht seine Beziehung zu ihm mit der zwischen Aaron und Moses verglichen? Diejenigen, die erklären, die Partei Alis zu bilden, die Schia Ali, anders gesagt, die Schiiten, standen somit in der Frage, wem es zukommt, die islamische Gemeinschaft zu leiten, denjenigen gegenüber, die entschieden, an ihre Spitze Abu Bakr zu stellen (von 632 bis 634), dann Umar (von 634 bis 644), einen anderen Freund und Gefährten des Propheten, dann Uthman (von 644 bis zu seiner Ermordung 656), ebenso ein Getreuer, der zwei Mal sein Schwiegersohn war, dann Ali selbst (von Uthmans Tod bis zu seiner eigenen Ermordung 662). Jene, die später daran festhielten, dass diese vier ersten Kalifen des Islam alle „rechtgeleitet“ ( raschidin ) auf dem Weg der Sunna des Propheten waren, nannten sich Sunniten . Die Hauptspaltung im Islam, diejenige zwischen den mehrheitlichen Sunniten und den minderheitlichen Schiiten, war also durch eine politische Frage, die auch zu einer theologischen werden sollte, entstanden, durch die Frage nach dem „Befehlshaber der Gläubigen“. Und doch hielt jede Partei die Frage durch die Treue zum Propheten und zur von ihm verkündeten Botschaft für gelöst. Man wollte, dass die Entscheidung der Diskussion, der Kontroverse, der Spekulation entzogen sei, dass sie sozusagen automatisch aus dem Koran und der Tradition folge. Die Treue erwies sich jedoch selbst als Gegenstand der Spekulation. Wie sollte man vor diesem Hintergrund nicht philosophieren?
Читать дальше