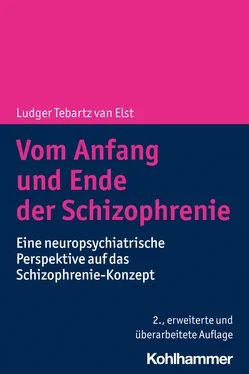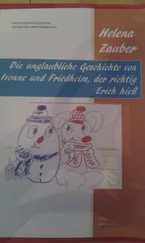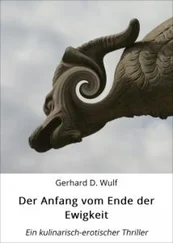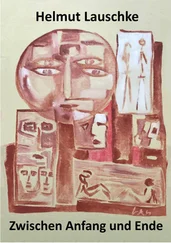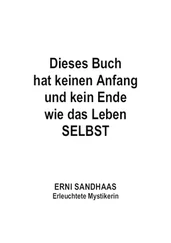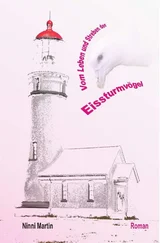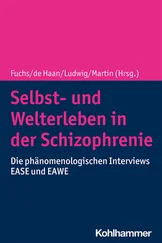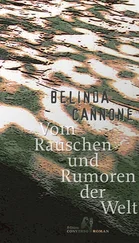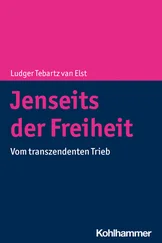Auf der Basis dieser grundlegenden medizintheoretischen Überlegungen wird dann der Frage nach der Ursächlichkeit schizophrener Symptome nachgegangen. Dabei wird das Wissen über die verschiedenen Kausalstränge, die das Entstehen schizophrener Phänomene begünstigen können, umfassend zusammengefasst und vorgestellt. Es werden die funktionelle Neuroanatomie höherer mentaler Leistungen und ihrer Störungen ebenso herausgearbeitet wie die klassische dopaminerge und glutamaterge Hypothese der Schizophrenie, bildgebende, genetische, aber auch umweltbedingte, psychoreaktive und persönlichkeitsstrukturelle Ursachen der schizophrenen Störungen. Gerade im Hinblick auf die genetischen Aspekte der Schizophrenien wird dabei verdeutlicht, dass genetische Ursachen schizophrener Syndrome sowohl im klassischen, kategorialen Sinne in Form monogenetischer Erkrankungen als auch aber eben deutlich häufiger im dimensionalen Sinne in Form von multigenetischen Normvarianten gegeben sind. Es ist dabei ein zentrales Anliegen dieses Buches, zu erklären und darauf hinzuweisen, dass es gerade bei multigenetischen Verursachungen problematisch ist, von Krankheiten im klassischen Sinne zu sprechen.
Im daran anschließenden 8. Kapitel des Buches werden neue neuropsychiatrische Entwicklungen auf dem Gebiet der Schizophrenie vorgestellt. Wie im gesamten Buch wird gerade auch hier anhand von zahlreichen Kasuistiken veranschaulicht, dass bei vielen Einzelfällen, bei denen noch vor 20 Jahren dem Wissensstand entsprechend zu Recht eine Schizophrenie diagnostiziert wurde, heute neuropsychiatrische Krankheitsdiagnosen im engeren Sinne möglich sind. So können – zumindest auf Einzelfallebene – Stoffwechselerkrankungen wie die Niemann-Pick-Typ C Erkrankung, immunologische Erkrankungen wie die limbischen Enzephalitiden oder die Hashimoto-Enzephalopathie oder paraepileptische schizophrene Störungen identifiziert und oft auch kausal behandelt werden. Gerade diese jüngsten Entwicklungen auf dem Gebiet der Neuropsychiatrie illustrieren dabei anschaulich, dass es sich bei der Schizophrenie um einen Sammelbegriff für zahlreiche, unterschiedlich verursachte, meist noch unverstandene, neuropsychiatrische Erkrankungen handelt.
In diesem Zusammenhang wird dann der Frage nachgegangen, ob gerade im multigenetischen Bereich, schizophrene Erlebensweisen nicht auch als Normvariante menschlichen Wahrnehmens und Erlebens verstanden werden sollten. Dafür spricht etwa die Tatsache, dass epidemiologischen Befunden zufolge 6–7 % der gesunden Allgemeinbevölkerung zumindest einmal im Leben schizophrene Symptome aufweisen, ohne dass nach psychiatrischen Kriterien eine psychische Störung diagnostiziert werden könnte.
Vor dem Hintergrund dieser Beobachtungen und Überlegungen wird dann im 9. Kapitel das Für und Wider der Schizophrenie gegeneinander abgewogen. Perspektivisch wird nach Abwägung der Vor- und Nachteile das Urteil vertreten, dass der Schizophrenie-Begriff und – viel wichtiger noch – das Schizophrenie-Konzept in den Köpfen aller Akteure mehr Nachteile haben als dass sie nutzen. Damit ist das übergeordnete Ziel dieses Buches ein Unbescheidenes, nämlich die Abschaffung des Begriffs und des Konzepts der Schizophrenie in den Köpfen der Leserinnen und Leser – zumindest für den Fall, dass meine Argumentation und Sichtweise überzeugen sollten. Umso wichtiger ist es mir, zu betonen, dass die meisten der hier vorgetragenen und entwickelten Gedanken nicht wirklich neu und exotisch sind, sondern dem Diskurs der Zeit entspringen, was in Kapitel 10 dargelegt wird.
2 Die Symptome und Verläufe der Schizophrenie
2.1 Schizophrenie in der Lebenswirklichkeit
Was ist die Schizophrenie in unserer Welt? Medizinische Begriffe haben in der alltäglichen Lebenswelt oft vielfältige Bedeutungen, die über den Kern der wissenschaftlichen Definition weit hinausreichen. Aber für kaum einen medizinischen Begriff gilt dies so sehr wie für den Schizophrenie-Begriff. Was bedeutet es in der alltäglichen Lebenswirklichkeit, eine Schizophreniediagnose zu bekommen?
Zunächst einmal ist eine Schizophrenie für viele Menschen eine große Angst. Denn hinter der bangen Frage »Bin ich verrückt?« verbirgt sich nicht nur eine Verunsicherung dem eigenen Körper gegenüber, die nicht wenige Leserinnen und Leser aus eigener Erfahrung kennen werden. 1 1 Wenn im Folgenden von Lesern, Patienten, Ärzten o. ä. die Rede ist, sind immer Leserinnen und Leser, Patientinnen und Patienten usw. gemeint. Um den Lesefluss des Textes aber nicht zu stören, wird der Einfachheit halber nur der Begriff Leser, Patient usw. gewählt werden. 2 http://www.psy-luxeuil.fr/article-schizophrenie-la-grande-insaisissable-116865765.html 3 https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f1683919430; Zugriff am 28.05.2021. (Übersetzung durch den Autor) 4 In deutschen und europäischen Sprachraum wird meist die ICD und nicht das DSM als Referenzsystem genutzt. 5 Diese Konzeption vom Ich entspricht weitgehend der Begriffsdefinition des »Subjekt« in früheren Textes (Tebartz van Elst 2003, S. 155). Hier soll aber beim Begriff des Ichs geblieben werden, um den Gedankengang nicht zu verkomplizieren. 6 Dieser Kasten wurde weitgehend einer anderen Buchpublikation des Autors entnommen (Tebartz van Elst 2018)
Die Verunsicherung über das Symptom reicht viel weiter als wenn ein Mensch mit übergroßem Durst sich sorgenvoll fragt: »Habe ich einen Diabetes?«. Denn auch wenn die Psyche im wissenschaftlichen und populären Denken der Postmoderne meist als körperliches Phänomen begriffen wird, so ist doch unbestreitbar, dass psychiatrische Diagnosen das Selbstbild, die eigene Identität, das Selbstwertgefühl und die Stellung des Betroffenen in der Gesellschaft viel weitreichender beeinflussen als somatische Diagnosen. Und so zielt die sorgenvolle Frage »Bin ich verrückt?« eben nicht nur auf das Symptom an sich, sondern auf das Unheil in der Gesellschaft, welches mit der offiziellen Diagnose einer Schizophrenie von vielen befürchtet wird – teilweise sicher zu Recht.
Darüber hinaus ist mit der Schizophreniediagnose auch eine Drohung verbunden. Denn es schwingt auch die Zuordnung mit: »Du bist verrückt!« Die Schizophreniediagnose steht wie kein anderer Begriff für das Verrückt-Sein in der gesellschaftlichen Wirklichkeit unserer Zeit. Die Epochen, in denen Menschen, die Stimmen hören, sich unter Umständen auch als auserwählt und begnadet begreifen durften – zumindest solange die übrigen kognitiven Funktionen intakt blieben –, sind lange vorbei. Die meisten Betroffenen haben den »Verrückheits-Begriff« selbst oft in alltäglichen Auseinandersetzungen als Vorwurf und Schimpfwort benutzt, nicht ahnend, dass er eines Tages auf sie zurückfallen würde.
Schließlich ist die Schizophrenie ein Stigma, ein Mal: »Der da, die da, ist verrückt! Von dem kann man nichts erwarten!« Menschen, die in den Gesellschaften unserer Zeit als schizophren markiert wurden, wird mit Misstrauen und Vorsicht begegnet. »Kann ich diesem Mann trauen?« »Muss ich vorsichtig sein?« »Kann ich dieser Frau meine Kinder anvertrauen, wenn sie doch eine Schizophrenie-Diagnose hat?« Solche Fragen beschäftigen Menschen, wenn sie anderen begegnen, von denen sie wissen, dass sie an einer Schizophrenie leiden.
Weitreichendere Folgen als die Stigmatisierung durch die Gesellschaft hat die Selbst-Stigmatisierung (Rüsch 2021), denn sie greift in das Binnen-Verhältnis, den Selbst-Bezug betroffener Menschen ein. Sie betrifft nicht die Beziehung zwischen Außenstehenden und der eigenen Person, sondern die Beziehung der Betroffenen zu sich selbst. »Kann ich mir trauen?« »Kann es sein, dass ich die Kontrolle über mein Leben, mein Denken, mein Handeln verliere?« »Bin ich noch in hinreichendem Ausmaß frei und zurechnungsfähig?« All diese Fragen könnten viele nicht-schizophrene Menschen sich mit guter Begründung stellen, denen es nie in den Sinn käme. Zu nennen sind hier etwa Menschen, die regelmäßig Alkohol trinken – und gelegentlich auch deutlich zu viel – Menschen, die einen Diabetes haben, ein hohes Herzinfarkt- oder Schlaganfallrisiko, Menschen, die Drogen nehmen usw. Keine dieser medizinischen Konstellationen ist aber auch nur im entferntesten Sinne in einem vergleichbaren Ausmaß mit dem Problem der Selbststigmatisierung behaftet, wie dies bei den Schizophrenien der Fall ist.
Читать дальше