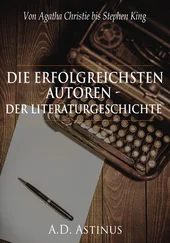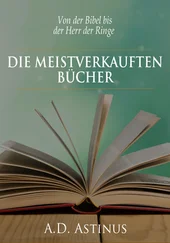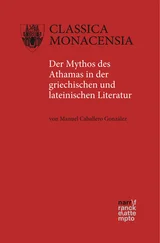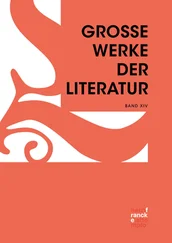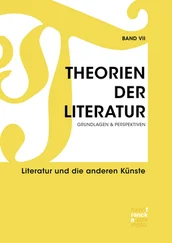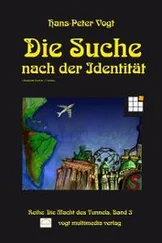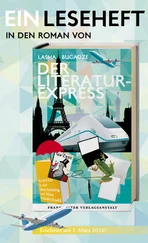Mars Klein argumentiert in diesem Kontext, dass Noppeney und dessen Französisch schreibende Kolleg:innen durch „die relative sprachliche Distanz des Französischen zum sprachlichen Alltag – Luxemburg ist ja ‚un faux pays francophone‘, Luxemburg ist richtiger ‚un pays francographe‘ oder besser noch ‚entre autre francographe‘“ zur Überzeugung gebracht worden seien, „in einer schwierigen sprachlichen Diaspora zu schreiben und – über den Weg der (phasenweise übertriebenen) Frankophilie – die räumliche und ideelle Distanz zu Frankreich überbrücken zu müssen.“28 Diese Frankophilie äußerte sich nicht zuletzt in einem Sprachpurismus, der vor allem in den Pages de la S.E.L.F. gepflegt wurde. In dieser Zeitschrift publizierte Marcel Noppeney die Rubrik Complexe d’Ésope , in der er seine Landsleute für den falschen Gebrauch von französischen Wörtern und Redewendungen kritisierte, ja bisweilen lächerlich machte. Diese Kritik verstand Noppeney als „intervention […] qui m’est dictée par le respect que Voltaire recommande d’avoir pour cette grande dame qu’est la langue française“.29 Das Verhältnis der Deutsch schreibenden Luxemburger Autor:innen zu ihrer Literatursprache gestaltete sich anders. Wenngleich auch sie sich um eine möglichst fehlerfreie Beherrschung des Deutschen bemühten, ließen sie jedoch auch Raum für einen eigenen, freien Umgang mit der Sprache. Anise Koltz, eine der bedeutendsten Luxemburger Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts und Organisatorin der Mondorfer Dichtertage, betonte viele Jahre später, dass Luxemburger Autor:innen „sowohl im Deutschen als auch im Französischen Worte zusammen[setzten], die ein Muttersprachler nie zusammensetzen würde“30 und dass dieses besondere Verhältnis zur Literatursprache zu einer gewissen Originalität führen könnte. Diese Ansicht vertrat auch Dieter Hasselblatt, als er anlässlich der Mondorfer Dichtertage 1966 über ein Hörspiel von Roger Manderscheid urteilte, „daß hier jemand in deutscher sprache etwas gesagt habe, was ein deutscher auf deutsch gar nicht hätte sagen können“31. Laut Hasselblatt bedienten sich die Deutsch schreibenden Luxemburger Autor:innen zwar der deutschen Sprache, doch sie könnten mit dieser anders, vielleicht freier umgehen als die Deutschen selbst.32 Während die frankophonen Luxemburger Autor:innen also durch ihren Sprachpurismus eine größtmögliche Nähe, ja eine Identität mit der französischen Literatur anstrebten, waren die Deutsch schreibenden Luxemburger Autor:innen eher daran interessiert, sich an dem engagierten Literaturverständnis ihrer ausländischen Kolleg:innen zu orientieren, dieses aber kreativ für die eigenen Bedürfnisse im Luxemburger Literatursystem umzusetzen.
Schließlich thematisierten einige Luxemburger Schriftsteller:innen ihr persönliches Verhältnis zu ihrer Luxemburger Nationalität und zur Literatursprache auch ganz direkt. Als Beispiele können hier die Autoren Edmond Dune für die französischsprachige und Georges Hausemer für die deutschsprachige Luxemburger Literatur dienen. Der Lyriker und Dramatiker Edmond Dune war als Sohn eines Luxemburgers und einer Belgierin Luxemburger Staatsbürger und nahm auch aktiv am Luxemburger Literaturleben teil, indem er beispielsweise die Mondorfer Dichtertage mitorganisierte und in Luxemburger Zeitschriften publizierte. Dennoch pflegte Dune ein sehr distanziertes Verhältnis zu Luxemburg und seiner Literatur. So liest man in einem Brief, den Dune in den 1960er Jahren an seinen französischen Freund Jean Vodaine schrieb: „Je ne veux pas qu’on me traite de poète luxembourgeois ! Tu devrais le savoir depuis le temps que tu me fréquentes.“33 Tatsächlich erwähnte Dune seine Staatsbürgerschaft fast nie, in Anthologien wurden seine Gedichte zum Teil unter der Rubrik „poètes français“ publiziert – und dies war auch genau das, was er anstrebte: in einer Reihe mit französischen Autoren zu stehen. Dune negierte aber nicht nur seine eigene Beziehung zum Großherzogtum, sondern darüber hinaus ganz generell die Existenz einer französischsprachigen Luxemburger Literatur. In einem Brief an seinen Luxemburger Kollegen Paul Palgen stellt Dune klar: „À mon sens, la littérature (luxembourgeoise) d’expression française n’existe pas.“34 Dune bezeichnet das Label „französischsprachige Luxemburger Literatur“ in diesem Brief als prätentiös, ja gar als Phantom. Die Idee einer spezifischen Luxemburger Literatur weist Dune kategorisch zurück. Dieser Negierung der Luxemburger Identität und dieser kompletten Identifizierung mit der Kultur Frankreichs, die durchaus auch für andere Luxemburger Autor:innen festgestellt werden kann, steht die Haltung einiger Deutsch schreibender Autor:innen gegenüber. Hier sei zunächst Roger Manderscheid genannt, der Anfang der 1980er Jahre in einem Interview über die deutschsprachige Luxemburger Literatur behauptete: „ich glaub schon daß wir als deutschschreibende Luxemburger einen eigenen, unverwechselbaren ton haben , der bis jetzt noch nicht entdeckt wurde“.35 Dass dieses Unverwechselbare auch in dem komplexen Verhältnis der Luxemburger Autor:innen zu ihren Literatursprachen begründet liegt – Literatursprachen, die damals nur selten identisch mit der luxemburgischen Muttersprache waren –, erläuterte der bereits zitierte und 2018 viel zu früh verstorbene Autor Georges Hausemer 1983 in einer Rede in Mannheim:
Demnach wandert der Luxemburger Autor, wie etwa die berühmte Katze um den heißen Brei, stetig am Rand der einen oder der anderen Weltliteratur umher, möchte eigentlich dazugehören und kann sich mit letzter Konsequenz doch nicht von der Scholle lösen, an der er zeitlebens klebt. Kann nicht und will eigentlich auch gar nicht. Wollen Sie nämlich einen deutschschreibenden Autor aus Luxemburg beleidigen, so behaupten Sie ganz einfach, er sei ein deutscher und nicht ein deutschsprachiger Schriftsteller. Diese – einige werden sagen: mimosenhafte – Einstellung hat tiefergehende Wurzeln, politische, historische Gründe, die auch meine Generation, die etwa die Mesalliance Luxemburgs mit dem Deutschen Reich nur vom Hörensagen kennt, nicht vollständig zu überwinden vermag.36
Hausemer beschreibt das Verhältnis der Luxemburger Schriftsteller:innen zur deutschen Sprache als ein zwiespältiges, als eines, das durch Nähe und Distanz zugleich bestimmt ist. Neben den historischen Gründen, die Hausemer nennt, gibt es sicherlich auch linguistische: Luxemburgisch ist – wenngleich es als eigenständige Sprache politisch anerkannt ist – ein moselfränkischer Dialekt. Diese Nähe erleichtert es vielen Luxemburger:innen, Deutsch zu erlernen und die Sprache einigermaßen gut zu beherrschen; gerade die Nähe ist es vielleicht aber auch, die eine klare Abgrenzung nötiger erscheinen lässt. Hausemer prägte in diesem Kontext den Begriff der „Stiefmuttersprache“.37 Was das Verhältnis der Französisch schreibenden Luxemburger Autor:innen zu Frankreich angeht, vermutete Hausemer in seiner Rede, dass es „in dieser ausgeglichenen Relation weniger Animositäten geben“38 dürfte. Mit Blick auf die Aussagen Edmond Dunes kann dies eigentlich nur als Euphemismus bezeichnet werden.
Eine solche Gegenüberstellung, wie sie in dem vorliegenden Beitrag vorgenommen wurde, kommt nicht ohne Verallgemeinerungen aus. Was hier beschrieben wurde, sind Tendenzen, die natürlich nicht für alle Luxemburger Autor:innen des Untersuchungszeitraums geltend gemacht werden können. Selbstverständlich gab es Ausnahmen, die nicht in das hier skizzierte Schema hineinpassen, wie die Französisch schreibenden engagierten Lyriker Phil Sarca (Jeannot Scheer) und René Welter. Darüber hinaus gab es auch damals schon Schriftsteller:innen, die mehrere Literatursprachen nutzten. Hier kann etwa die Dichterin Anise Koltz genannt werden, die auf Deutsch debütierte und sich erst ab den 1970er Jahren exklusiv der französischen Sprache widmete, ohne ihr Literaturverständnis dafür zu verändern. Dennoch sind die tendenziellen Unterschiede im Sprach- und Identitätsverständnis bei der Auseinandersetzung zwischen Deutsch und Französisch schreibenden Autor:innen der 1960er und 1980er Jahre nur allzu augenfällig. Davon ausgehend müsste das Verhältnis der Luxemburger Autor:innen zur eigenen kulturellen Identität – als Teil ihrer posture – eingehender und über einen längeren Zeitraum untersucht werden, um Veränderungen und Einschnitte beschreiben und typisieren zu können – beispielsweise aus einer komparatistischen Perspektive, im Vergleich mit anderen, kleinen und mehrsprachigen Literatursystemen Europas. Für viele junge Luxemburger Schriftsteller:innen des 21. Jahrhunderts scheinen die gewählten Schriftsprachen jedenfalls keine grundlegende Rolle mehr für ihr Literaturverständnis zu spielen. So schreibt Elise Schmitt mit Stürze aus unterschiedlichen Fallhöhen deutschsprachige Kurzgeschichten ohne direkten Luxemburg-Bezug, während Ian de Toffolis französischsprachige Dramentexte ihren soziokulturellen Entstehungsraum durchaus kritisch thematisieren (z.B. L’homme qui ne retrouvait plus son pays oder Tiamat ).39 Samuel Hamen zeigt, dass auf Luxemburgisch über Luxemburg erzählt werden kann, aber nicht muss (der Roman V wéi Vreckt, W wéi Vitesse steht hier dem beim Concours littéraire national 2019 ausgezeichneten und noch unveröffentlichten Roman I.L.E. gegenüber), und Jeff Schinker beweist mit dem Prosaband Sabotage , dass man in mehreren Literatursprachen zugleich (nicht nur) über Luxemburg schreiben kann. Solche Entwicklungen deuten darauf hin, dass nicht nur die gesellschaftliche, sondern auch die literarische Mehrsprachigkeit in stetem Wandel befindlich ist, was sich in der Sprachwahl von Autor:innen ebenso zeigt wie in ihren ästhetischen Positionierungen.
Читать дальше