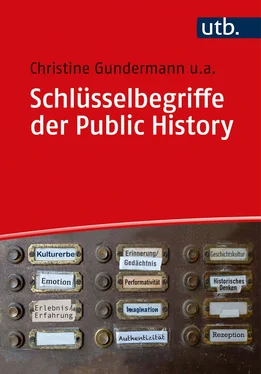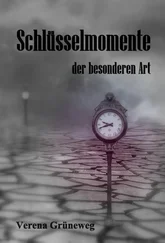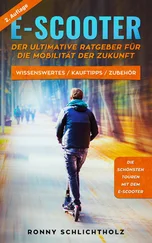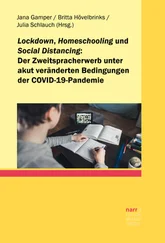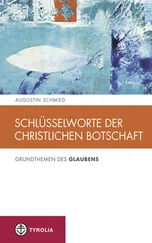Thorsten Logge - Schlüsselbegriffe der Public History
Здесь есть возможность читать онлайн «Thorsten Logge - Schlüsselbegriffe der Public History» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Schlüsselbegriffe der Public History
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Schlüsselbegriffe der Public History: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Schlüsselbegriffe der Public History»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Schlüsselbegriffe der Public History — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Schlüsselbegriffe der Public History», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Die begleitende Ausstellung mit der Lebensgeschichte des Künstlers, der selbst zu der Zeit in Kreuzberg wohnte und in dem Panorama seine eigenen visuellen Erinnerungen verarbeitet hat, authentifiziert das Panorama. Die gezeigten Fotos belegen das gezeigte Narrativ. Eine weitere Authentifizierung erfolgt mit einer konkreten Ortsbenennung. Die Besucher_innen blicken von der Sebastianstraße in Berlin-Kreuzberg auf die Mauer. Der Künstler zeigt das alternative Leben der Punks in dem bekannten Szene-Club SO 36, der bis heute existiert.
Dramatisierung durch Licht und Ton
Für die entsprechende Dramatisierung setzte der Künstler auf eine „diffuse[ ] Lichtstimmung“, 45die den Eindruck eines grauen Novembertags unterstützen soll. Die Besucher_innen sind in dem abgedunkelten Raum dem bunten Treiben und dem Straßenlärm am Checkpoint Charlie völlig entrückt. Ihre ganze Aufmerksamkeit ist auf das gelenkt, was sichtbar gemacht ist, das Panorama. Auch akustisch setzt der Künstler auf eine Dramatisierung durch eine von ihm selbst und Eric Babak komponierte und arrangierte, klassisch anmutende Begleitmusik. Durch den langsamen, getragenen Rhythmus sowie den Einsatz überwiegend tiefer Streichinstrumente erinnert die Musik an ein Requiem. Überlagert wird sie von der grellen und im Gegensatz zur Musik lautstarken Wiedergabe von originalen Tondokumenten aus der Zeit des geteilten Berlins. Zu hören sind beispielsweise Auszüge aus Reden von Walter Ulbricht und Erich Honecker. Interessanterweise stammen diese Tondokumente eben nicht aus dem Jahr 1980. An dieser Stelle wird die Illusion nicht konsequent umgesetzt. Dennoch gehören die geradezu ikonischen Soundquellen in das Gesamtensemble der Inszenierung, denn sie knüpfen an bei den Besucher_innen mutmaßlich vorhandene geschichtskulturelle Erwartungen an und stehen somit überzeugend für ein pastness -Gefühl (vgl. Kap. 11Rezeption).
Personalisierung
Die Strategie der Personalisierung findet sich in der sehr detailgetreuen Darstellung der Menschen, die auf einem Holzpodest stehen (ähnlich jenem, auf dem die Panorama-Besucher_innen selbst stehen), um einen Blick über die Mauer zu werfen. Zu sehen sind Kleinkinder mit ihren Eltern, weißhaarige Rentner_innen und Jugendliche. Somit ist das Angebot zur Identifikation mit den neugierigen Menschen des Jahres 1980 breit.
Zusammenfassend ist herauszustellen, dass Emotionen im Hinblick auf die skizzierten Erlebnisversprechen der Public History in zweifacher Hinsicht eine Schlüsselfunktion haben: Einerseits bieten entsprechende Geschichtsdarstellungen über die Thematisierung der Gefühle früherer Menschen einen anscheinend niedrigschwelligen Zugang zur Geschichte an. Hier können Emotionen Objekte der Darstellung und Vermittlung von Geschichte sein. Andererseits geht es um die positive emotionale Mobilisierung der Rezipient_innen. Dabei finden Emotionalisierungsstrategien Anwendung, die häufig die Unterschiede zwischen Emotionen auf der Objekt- und jenen auf der Subjektebene verwischen. So zielen die Darstellungsstrategien im Asisi-Panorama auf eine Illusion, die es den Besucher_innen erlauben soll, komplett in den Novembertag 1980 an der Berliner Mauer einzutauchen, um Geschichte mit allen Sinnen zu fühlen und damit vermeintlich auch zu erleben (vgl. Infobox Immersion in Kap. 5.3). Die Frage ist, welche Chance die Besucher_innen haben, aus dieser Illusion in ihre Gegenwart zurückzukommen, sich selbst zu diesem Erleben von Geschichte in Beziehung zu setzen, selbst zu fühlen, was sie daraus für sich mitnehmen, was diese Begegnung mit Geschichte für sie bedeutet.
Emotionale Überwältigung und der Beutelsbacher Konsens
Diese Ambivalenz der Emotionen ist mittlerweile Thema zahlreicher Tagungen oder Vernetzungstreffen, auf denen Akteur_innen der Public History offensiv die Bedeutung von Emotionen in der Begegnung vor allem mit der deutschen Diktaturgeschichte diskutieren. 46Insbesondere die Frage nach emotionaler Überwältigung und ihrer Zulässigkeit steht dabei zur Diskussion. Denn während einerseits das Bedürfnis in Museen, Gedenkstätten und sonstigen Orten der Geschichtsvermittlung groß ist, Interesse und Aufmerksamkeit zu wecken, wird andererseits immer wieder auf die Gefahr einer zu starken Emotionalisierung hingewiesen. Im Rahmen dieser Diskussion rückt der mittlerweile über 40-jährige Beutelsbacher Konsens in den Mittelpunkt des Interesses. Die Grundsätze dieses Konsenses wurden 1976 ursprünglich für die politische Bildung formuliert. Auch wenn er als Minimalkonsens galt, sollte mit den Prinzipien Kontroversität, Schüler_innenorientierung und Überwältigungsverbot eine politische Indoktrination der Lernenden wirkungsvoll verhindert werden. Interessanterweise erhielt dabei das Überwältigungsverbot im Kontext der Diskussion um Gedenkstättenarbeit eine zusätzliche Bedeutungsebene. Ursprünglich zielte es auf die Verwerfung solcher Formen oder Methoden der Vermittlung, die dazu geeignet schienen, „den Schüler – mit welchen Mitteln auch immer – im Sinne erwünschter Meinungen zu überrumpeln und damit an der ‚Gewinnung eines selbständigen Urteils‘ zu hindern“. 47Mittlerweile geht es hingegen nicht mehr vorrangig um ein argumentatives Überwältigen, sondern vor allem um eine emotionale Überwältigung. 48
Grenzen zwischen Emotionalisierung und emotionaler Überwältigung
Aus der obigen Theoretisierung von Emotionen auf der Objekt- und auf der Subjektebene ergeben sich klare Grenzen zwischen Emotionalisierung und emotionaler Überwältigung. Emotionalisierung ist die Mobilisierung der subjektiven Emotion der Rezipient_innen; die Emotionen verbleiben jeweils auf der Objekt- bzw. auf der Subjektebene, ohne sich zu vermischen. Das heißt, im Asisi-Panorama ist zwar die Normalität des Schreckens der Mauer dargestellt, die Besucher_innen von heute dürfen diesem „Grauen“ im Schatten der Mauer mit ihrer eigenen Neugierde oder Skepsis, vielleicht sogar Ablehnung oder auch Wut darüber begegnen, dass so etwas möglich war. Eine emotionale Überwältigung aber findet dann statt, wenn historische Emotionen heute nachgefühlt werden sollten, d. h. die Objektebene verlassen und auf die Beeinflussung individuellen Fühlens abzielen.
3.4Ein Plädoyer für Emotionen in der Public History
Emotionalisierungsstrategien transparent gestalten
Auf der Grundlage vorliegender Überlegungen ergeben sich zwei entscheidende Einwände gegen die emotionale Überwältigung: Erstens können historische Emotionen schon deshalb nicht nachgefühlt werden, weil sie sich im Laufe der Zeit verändern. Die Menschen der Jetztzeit wissen, dass die Mauer seit 30 Jahren nicht mehr existiert, dass die bewaffneten Grenzsoldaten niemandem mehr gefährlich werden können. Heutige Besucher_innen können, wann immer sie wollen, das Panorama verlassen und sich ganz dem Großstadttrubel am Checkpoint Charlie hingeben. Der zweite Einwand resultiert aus geschichtsdidaktischen Überlegungen. Die Begegnung mit der Vergangenheit kann dann identitätsbildend und handlungsorientiert sein, wenn sie das individuelle Erinnern und eigene Erfahrungen mit der und über die Zeit aufgreift und nicht schlichtweg nachzubilden versucht. Dies verweist noch einmal zurück auf die grundsätzliche Einsicht, dass die Auseinandersetzung mit Geschichte vielmehr eine Alteritäts- denn eine Identitätserfahrung ist. Vergangenheiten waren eben grundsätzlich anders als unsere Gegenwart, auch wenn sie im Geschichtserlebnis als vertraut und ähnlich präsentiert werden. Das bedeutet, dass die über Emotionen vermittelte Begegnung mit Geschichte durchaus sinnvolle Anreize schaffen kann, aber nur dann, wenn die Emotionen ganz klar auf der Objektebene bleiben und es den Menschen der heutigen Zeit möglich bleibt, (auf der Subjektebene) ihre eigenen, durchaus sehr unterschiedlichen Emotionen zu haben und zu thematisieren. Das bedeutet für öffentliche Präsentationen von Geschichte, dass die Strategien der Emotionalisierung transparent sein und dass mehrere verschiedene Narrative angeboten werden sollten. Diese ermöglichen es, visuelle und akustische Dramatisierungseffekte am Ende des Geschichtserlebnisses aufzulösen, und entlassen die Besucher_innen in die je eigene Gegenwart mit (emotionalen) Impulsen zum Weiterdenken.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Schlüsselbegriffe der Public History»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Schlüsselbegriffe der Public History» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Schlüsselbegriffe der Public History» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.