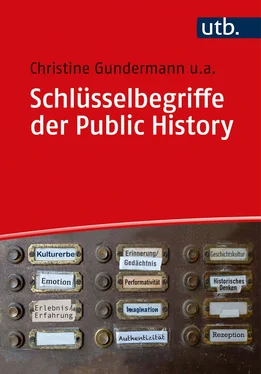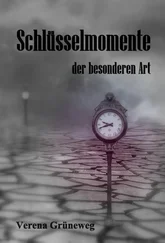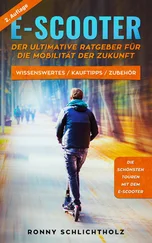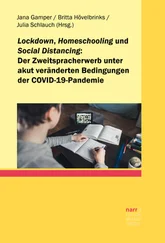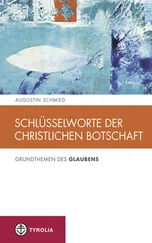Thorsten Logge - Schlüsselbegriffe der Public History
Здесь есть возможность читать онлайн «Thorsten Logge - Schlüsselbegriffe der Public History» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Schlüsselbegriffe der Public History
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Schlüsselbegriffe der Public History: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Schlüsselbegriffe der Public History»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Schlüsselbegriffe der Public History — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Schlüsselbegriffe der Public History», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Aktivierung und Blockierung von Emotionen sind Emotionsmanagement
Emotionen sind in der Auseinandersetzung mit Geschichte, egal in welchem institutionellen Rahmen, schon immer vorhanden. 31Geschichtsdarstellungen sollen traditionellerweise Kenntnisse vermitteln und Orientierungswissen bereitstellen. Um das leisten zu können, sollen sie Neugierde wecken können, möglichst spannend sein, Interesse herstellen, bestenfalls für historische Themen begeistern. Emotionen haben aber keinen klar bestimmbaren, systematischen Ort in der Begegnung mit Geschichte, der sich auf diese Darstellungs- und Aktivierungsebene begrenzen lässt. Alle beteiligten Personen bringen ihre Emotionen in die Begegnung mit Geschichte mit hinein. Damit verändert jede_r Einzelne die Atmosphäre im Klassenzimmer, in der Ausstellung, in der Gedenkstätte und beeinflusst den Prozess der Geschichtsaneignung. Dabei lässt sich der Umgang mit Emotionen unterscheiden einerseits in die bewusste Aktivierung von als positiv konnotierten Gefühlslagen wie Interesse, Neugierde oder Empathie. Andererseits werden als störend bewertete Emotionen wie Langeweile oder Ablehnung aus der Perspektive der Geschichtsmacher_innen gezielt blockiert, wohingegen Schüler_innen, die sich gezwungenermaßen mit Geschichte beschäftigen müssen, auch ablehnende Emotionen gezielt aktivieren können. Ob nun Aktivierung oder Blockierung, beides sind Formen des Emotionsmanagements.
Wilhelm Dilthey und die Gefühle als Erkenntnismethode
Die Erkenntnis, dass Emotionen bei der Auseinandersetzung mit Vergangenheit und der Erzeugung von Geschichte eine Rolle spielen, ist bei Weitem nicht neu. Wilhelm Dilthey, einer der Gründungsväter der modernen Geisteswissenschaften, kennzeichnete das geisteswissenschaftliche Verstehen im Gegensatz zum naturwissenschaftlichen Erklären als ein „Nachfühlen fremder Seelenzustände“. 32Damit wies Dilthey den Gefühlen im Verstehensprozess eine erkenntnistheoretische Bedeutung zu. Daniel Morat bezeichnet diesen Zugang daher folgerichtig als eine „Gefühlsmethode“. 33Dilthey arbeitete mit der Vorstellung einer grundsätzlichen Gleichartigkeit zwischen der_dem Verstehenden und dem_der Verstandenen, die ein „Hineinversetzen“ in und „Nachbilden“ von fremden Gefühlen und damit ein Nacherleben fremder Erfahrungen überhaupt ermöglicht.
Faszination der Emotionen und Angst vor Emotionen im vergangenen Geschichtsunterricht
Trotz dieser dezidiert geisteswissenschaftlichen, hermeneutischen „Gefühlsmethode“ waren Emotionen über viele Jahrzehnte aus dem Geschichtsunterricht regelrecht verbannt. Die Erklärung dafür liegt in der Geschichte des Unterrichtsfaches selbst. Geschichtsunterricht im wilhelminischen Kaiserreich, so der Didaktiker Bodo von Borries, verfolgte mit seinen „herkömmlichen Zielsetzungen“ unverhohlen „affirmativ-legitimatorische, ja manipulativ-indoktrinierende“ Absichten. „Kognitive Lernprozesse (Verständnis)“ seien damals „zum bloßen Vehikel des Emotionalen (Begeisterung und Liebe)“ insbesondere im Hinblick auf die Nation geworden. 34Emotionen galten aufgrund dieses Erbes, das über die Zeit des Nationalsozialismus hinauswirkte, als besonders problematisch für den Geschichtsunterricht. Das kumulierte in den 1970er Jahren in einen besonderen Rationalitätsschub im geschichtsdidaktischen Diskurs. Die Furcht vor einer unkalkulierbaren Wirkung der Emotionen resultierte in einer Dominanz kognitiver Lernprinzipien und -ziele gegenüber einem auch Emotionen adressierenden Zugang 35und in der Forderung nach einer „Kultivierung der Affekte“. 36
Emotionen im Geschichtsunterricht werden neu entdeckt
Zu Beginn der 1990er Jahre kam es in Form einer geschichtsdidaktischen Tagung über Emotionen im Unterricht zu einem ersten Versuch, Emotionen wieder in den Lernprozess zu integrieren. 37Die Motivation zur Organisation einer solchen Tagung entstand aus der Einsicht, dass Emotionen in der historisch-politischen Bildung jahrelang vernachlässigt worden waren. Obwohl die Tagung einen Wendepunkt markieren sollte, hatte sie zunächst nur begrenzte Auswirkungen auf geschichtsdidaktische Konzepte oder gar auf Lernpläne. Erst mit dem emotional turn in der Geschichtswissenschaft fanden auch die Emotionen wieder Eingang in die Debatten um historisches Lernen, vor allem auch an außerschulischen Lernorten. 38
Der heutige geschichtsdidaktische Umgang mit Emotionen verweist auf gegensätzliche Perspektiven und Erwartungen an die Einbeziehung von Emotionen in den Lernprozess. Einerseits gibt es Formate, die auf ein Nachbilden, Nachfühlen vergangener Emotionen setzen (so wie im Mauer-Panorama) oder die emotionalen Reaktionen der Lernenden mit berücksichtigen (insbesondere wenn es darum geht, die Geschichte von gewaltsamen Geschehnissen bis hin zum Massenmord zu vermitteln). Andererseits bestehen auch Bedenken hinsichtlich dieser Praktiken, die gezielt auf das Fühlen der Lernenden ausgerichtet sind, gerade weil diese zu sehr an historische Beispiele intentionaler Emotionalisierung erinnern. Daher gilt es, vertieft danach zu fragen, wie sich in der Begegnung mit Geschichte die Emotionen auf der Subjektebene zu denen auf der Objektebene verhalten.
Vergangenheit wird von Vermittlungsinstanzen erkennbar gemacht
So grundlegend die Dilthey’sche Definition des Verstehens als „Gefühlsmethode“ ist, verweist sie doch auf enge Grenzen insbesondere für das spezifisch historische Verstehen und damit für die historische Bildung. Denn um der Vergangenheit habhaft zu werden, braucht es Vermittlungsinstanzen, die vergangene Lebenszusammenhänge sicht- und verstehbar machen. 2000 Jahre alte Fundamente erzählen nicht von sich aus ihre Geschichte. Dafür braucht es die Markierung der Fundamente als historisch bedeutsam durch Absperrungen und eventuell durch vorsichtige Rekonstruktion, man benötigt Erklärtexte oder -videos zum Alltagsleben in der antiken Stadt oder zu religiösen Ritualen, um die Fundamente in einen historischen Zusammenhang zu bringen. Die Wirkung dieser verschiedenen medialen Vermittlungsinstanzen liegt in ihrem Vermögen, Vorstellungsbilder entstehen zu lassen und sie mit einer besonderen Glaubwürdigkeit zu versehen, an der entlang die Betrachter_innen konsistente Vergangenheitsbilder entwickeln können. Aber selbst wenn 100 Besucher_innen dieselben Fundamente sehen und dieselben Informationen und Bilder vermittelt bekommen, liegt es an jeder_m Einzelnen, diese mit eigenem Wissen und vorhandenen Vorstellungsbildern zu verknüpfen und daraus eine Geschichte zu entwickeln (vgl. Kap. 9Historische Imagination).
Diese Geschichtsaneignung als Fremd- oder Identitätserfahrung
Überlegungen verweisen zum einen auf das Individuelle einer jeden Rezeption und Rekonstruktion des Vergangenen, zum anderen auf gesellschaftliche Deutungsmuster, die festlegen, was aus der Vergangenheit wert ist, sichtbar gemacht zu werden, und welche Geschichte anhand dieses Sichtbar-Gemachten erzählt werden soll. Die Frage ist nur, unter welchen Vorzeichen die Sichtbarmachung der Vergangenheit stattfindet. Sollen die Besucher_innen erkennen, wie anders das alltägliche Leben in einer antiken Stadt war, oder sollen sie Parallelen zu ihrem eigenen Leben sehen? Ist die Begegnung mit der Vergangenheit dementsprechend eine Alteritäts- oder eine Identitätserfahrung? Das hängt entschieden von der Art und dem Einsatz der Vermittlungsinstanzen ab. Um beim Beispiel der Ausgrabungen zu bleiben, besteht einerseits die Möglichkeit, die Fundamente minimal zu restaurieren und sie mit entsprechenden Informationstexten zu versehen. Andererseits ermöglicht es moderne Technik, die Besucher_innen mit Ton, Videoinstallation oder gar unter Zuhilfenahme von Augmented-Reality-Technik auf eine Zeitreise mitzunehmen und die Geschichte ‚hautnah miterlebbar‘ zu machen.
Ein Nachfühlen historischer Emotionen ist nicht möglich
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Schlüsselbegriffe der Public History»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Schlüsselbegriffe der Public History» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Schlüsselbegriffe der Public History» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.