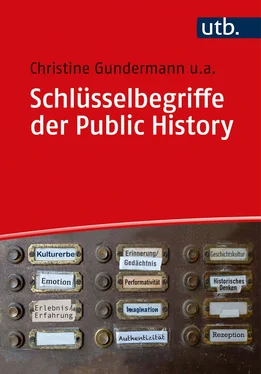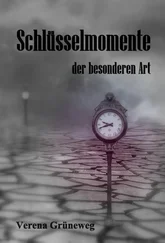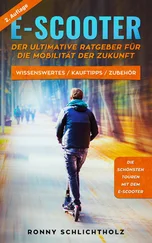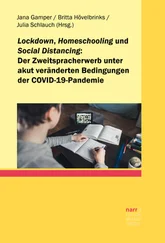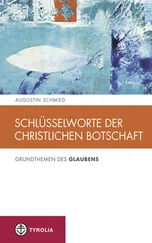Thorsten Logge - Schlüsselbegriffe der Public History
Здесь есть возможность читать онлайн «Thorsten Logge - Schlüsselbegriffe der Public History» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Schlüsselbegriffe der Public History
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Schlüsselbegriffe der Public History: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Schlüsselbegriffe der Public History»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Schlüsselbegriffe der Public History — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Schlüsselbegriffe der Public History», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Doch wie bereits dargestellt, ergibt sich aus der Perspektive der Emotionsgeschichte ein erheblicher Einwand gegen die Begegnung mit Geschichte als Identitätserfahrung. Denn ein Nachfühlen historischer Emotionen ist nicht möglich, eben weil sich Emotionen im Laufe der Zeit ganz grundlegend ändern können. Eine Annährung im Sinn des analogen Fühlens ist denkbar, aber nicht die Zeitreise in das Herz und in den Kopf der Menschen in längst vergangenen Zeiten. Wir als Menschen der Jetztzeit teilen nicht den „Erfahrungsraum und den Erwartungshorizont“ jener Menschen, um hier prägnante historische Kategorien von Reinhart Koselleck aufzugreifen. 39Um auf das Beispiel des Heimwehs zurückzukommen: Aus unserem heutigen Verständnis von Heimweh fehlt uns zum Mitfühlen ein Verständnis davon, dass Heimweh im 17. und 18. Jahrhundert als Krankheit für den Tod zahlreicher Söldner verantwortlich gemacht wurde. Wie könnten wir die Entscheidung eines führenden Offiziers nachvollziehen, seine Soldaten bei den ersten Anzeichen von Heimweh unverzüglich nach Hause zu schicken?
Historisches Lernen als Alteritätserfahrung
Es gibt einen zweiten dezidiert geschichtsdidaktischen Einwand gegen das Nachfühlen historischer Emotionen. Historisches Lernen ist diesem Einwand zufolge die Erfahrung des zeitlich, kulturell und geografisch Anderen, des Fremden, es ist eine Alteritätserfahrung. Die Aufforderung, etwas nachzuerleben, nachzufühlen, was Menschen in der Vergangenheit gedacht und gefühlt haben, baut jedoch auf die Illusion des Gleichartigen, der Identitätserfahrung. Wenn die Besucher_innen im Asisi-Panorama den erhöhten Blick über die Mauer haben, begeben sie sich in die Perspektive der Westberliner_innen im Jahr 1980. Doch ihr Blick auf die grauen Wohnblöcke Ost-Berlins heute ist weit weniger von bangen Fragen begleitet als derjenige der Zeitgenoss_innen. Damals lag in dem Blick über die Mauer vielleicht die Sorge um geliebte Angehörige, die Hoffnung darauf, einen Blick auf sie erhaschen zu können, oder einfach nur die Erleichterung darüber, auf dieser Seite der Mauer zu stehen. Den Besucher_innen heute wird vorgespielt, dass sie das sehen könnten, was die Menschen damals von solchen Beobachtungsposten aus sahen; oberflächlich mag das vielleicht stimmen, aber die Bedeutungen, Gedanken und Gefühle, die dem Sehen unterlegt sind oder mit ihm einhergehen, unterscheiden sich zwischen damals und heute.
Wilhelm Dilthey legte trotz solcher Einschränkungen, die mit der „Gefühlsmethode“ des historischen Verstehens verbunden sind, dennoch eine wichtige Spur für die Verortung von Emotionen in Lehr-Lern-Prozessen, in dem es um geisteswissenschaftliche Themen geht, nämlich die der „seelischen Struktur“ von Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Erinnerung und Gedenken. Nimmt man ernst, dass geisteswissenschaftliche Fächer in unserer Lebenswelt vom hermeneutischen Verstehen abhängen, müssen Emotionen zwangsläufig eine zentrale Bedeutung in der Begegnung mit Geschichte und damit dem historischen Lernen zuerkannt werden.
Gefühle blockieren die Auseinandersetzung mit Geschichte
Das Fühlen ist jedoch nicht ein automatischer Erfolgsfaktor für eine intensive und nachhaltige Begegnung mit Geschichte. Es kann auch blockierend wirken. Das zeigen die Herausforderungen an heutigen Gedenk- und Erinnerungsstätten. Lernende kommen an diese Orte und versuchen, den im entsprechenden Kontext erwarteten Emotionen zu entsprechen, eine ‚Choreografie der Emotionen nachzutanzen‘, wie Gedenkstättenpädagog_innen beobachten. 40Auffallend ist das vor allem bei Themen aus der Diktatur- und Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts. Betroffenheit, Empathie, Mitgefühl oder Trauer gehören zu der emotionalen Melange, die das gesellschaftspolitische Gedenken und Erinnern an die Opfer einfordert. Den Lernenden kann aber genau das fremd sein; vielleicht würden sie sich diesen Themen lieber mit Neugierde, Wut oder vielleicht auch emotional distanziert nähern. Im Sinne des emotionalen Lernens ist es wichtig, auch diese Gefühle zuzulassen und didaktisch aufzufangen und nicht von vornherein gesellschaftlich normiertes Fühlen zu erwarten; denn gerade solche an sie gerichteten Erwartungen können bei die Lernenden emotional überfordern und zu Abwehrreaktionen führen.
3.3.3Emotionalisierungen
Emotionalisierung erfolgt, wenn Emotionen der Objekt- und der Subjektebene miteinander vermischt werden
Das oben hergeleitete Verständnis von Emotionen auf der Objekt- und auf der Subjektebene verdeutlicht die Unterschiede und Grenzen zwischen diesen beiden Ebenen. In der konkreten Praxis aber bleiben Emotionen nicht jeweils auf ihrer Subjekt- oder Objektebene und damit voneinander unterscheidbar, wie der Hinweis auf das gesellschaftlich normierte Fühlen bereits verdeutlicht hat. Auch die Erlebnisangebote zur Geschichte versprechen ihren Besucher_innen das Nachempfinden vergangener Gefühle. 41In diesen Fällen, in denen die Emotionen von Menschen früherer Zeiten durch einen gezielten Einsatz von Medien und die Wahl entsprechender Narrative und Verhaltensaufforderungen wiedererlebbar gemacht werden sollen, kann man von Emotionalisierung sprechen. Spezifisch für Emotionalisierung ist, dass die Emotionen auf der Objektebene mit denen auf der Subjektebene vermischt werden und keine klare Trennung mehr möglich ist.
Emotionalisierungsstrategien analysieren
Die Aufgabe einer kritischen Public History ist es, einerseits die Strategien der Emotionalisierung zu erkennen und ein Bewusstsein dafür herzustellen, dass dieses Abzielen auf besondere emotionale Reaktionen (im Sinne des Nachfühlens) problematisch ist. Andererseits sollte darüber nachgedacht werden, an welcher Stelle Emotionen zielführend und produktiv in der Begegnung mit Geschichte wirken können. Dafür braucht es ein Instrumentarium, mithilfe dessen die Praktiken und Strategien der Emotionalisierung möglichst umfassend beschrieben und in Hinblick auf ihre Wirkung analysiert werden können. Insbesondere gilt es dabei in den Blick zu nehmen, wie die konstatierte Vermischung von Emotionen auf der Objekt- und auf der Subjektebene zustande kommt. Als Kategorien der Analyse bieten sich dafür an: Visualisierung, Narrativierung, Authentifizierung, Dramatisierung und Personalisierung. 42An jede dieser einzelnen Kategorien lassen sich erstens Fragen in Bezug auf Emotionen auf der Objekt- und auf der Subjektebene stellen. Zweitens geht es dann darum herauszustellen, wie diese beiden Ebenen durch die jeweiligen Praktiken konkret miteinander verbunden werden.
Visualisierung
Hinsichtlich des Asisi-Panoramas liegt es zunächst auf der Hand, die Mittel der Visualisierung genauer zu untersuchen: Was genau stellt das Panorama dar, in welchen Perspektiven, mit welchen visuellen Mitteln wird die Bildaussage unterstützt? Welche Mal- und Darstellungstechniken benutzte der Künstler, was war seine Absicht dabei, genau diesen Blick auf die Mauer darzustellen, was die intendierte Botschaft? Sinnvoll ist auch immer die Frage danach, was nicht zu sehen ist, wie in dem Mauer-Panorama die Menschen, die in Ost-Berlin lebten. Worauf verweist diese Darstellungsperspektive?
Narrativierung durch Authentizität
Die Narrativierung findet für das Geschichtspanorama vor allem in der Bewerbung statt. Die Webseite preist das emotionale Erleben dieser „perfekten Illusion“ an. „Erleben Sie den Alltag im Schatten der Berliner Mauer in einem einzigartigen Panorama“, heißt es dort, und weiter: „Sie erleben auf beeindruckende und einmalige Weise, wie alltäglich und zugleich grausam das Leben im Schatten der Mauer war“. 43Zusätzlich gibt es dem eigentlichen Panorama vorgelagert einen Raum, der zum einen die Entstehung des Panoramas und die Geschichte von Yadegar Asisi erzählt und zum anderen zahlreiche zeithistorische Fotos der Berliner Mauer zeigt und kommentiert. Mit diesen Informationen und historischen Bildern im Kopf wird den Besucher_innen eine Deutung der Geschichte mit auf dem Weg gegeben, mit der sie das Mauer-Panorama ansehen. Nicht zu vernachlässigen ist das gesamte Erlebnisensemble am Checkpoint Charlie, die Darsteller in ihren US-Army-Uniformen vor dem Grenzhäuschen, die Schilder, die die ehemalige Sektorengrenze markieren. Die Narrativierung zielt insbesondere auf eine besonders starke emotionale Grundierung der Geschichtsbegegnung. Daraus macht der Künstler selbst keinen Hehl und dafür nutzt er die „perfekte Illusion“, die das Medium Panorama ermöglicht. Das „grausame Leben im Schatten der Mauer“ soll nachfühlbar sein, die Besucher_innen sollen mit dem Gefühl nach Hause gehen, wirklich im Jahr 1980 an der Mauer gestanden zu haben. 44Das lässt ihnen kaum mehr die Möglichkeit eigener Sinnbildung oder subjektiven Fühlens, das vielleicht weniger von der intendierten Botschaft vom „grausamen Leben“ beeinflusst ist, sondern vielmehr von der Einsicht, dass auch das alternative Leben in den besetzten Häusern im Schatten der Mauer nicht sonderlich bunt oder aufregend war.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Schlüsselbegriffe der Public History»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Schlüsselbegriffe der Public History» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Schlüsselbegriffe der Public History» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.