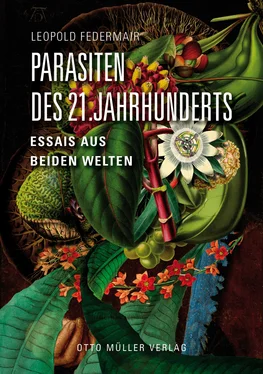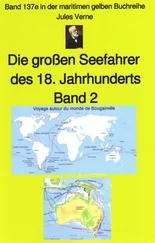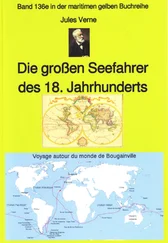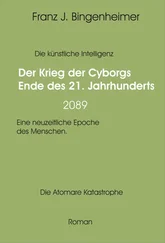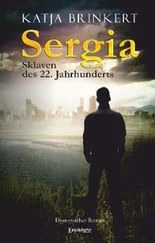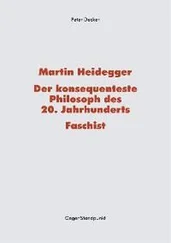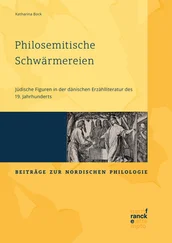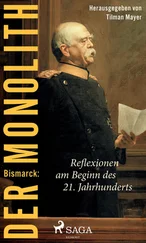Ich habe mich nie mit den Grundlagen der Statistik beschäftigt und verspüre auch jetzt, in Zeiten der Pandemie, da die Infektions- und Sterblichkeitskurven ins Kraut schießen, nicht die geringste Lust dazu, aber wie so viele klappere auch ich seit dreißig Jahren am Computer herum und tummele mich seit fünfzehn oder zwanzig Jahren in virtuellen Welten, und so sagt mir mein digitales Gefühl, daß das Denken meines maschinell-personalen Gegenübers, das in all den Jahren wirklich viel besser und umfassender geworden ist und sich unaufhaltsam perfektioniert, im wesentlichen ein mathematisch-statistisches ist, auch dann, wenn auf der Benutzeroberfläche gar keine Zahlen erscheinen. Daran bin ich gewöhnt, an das Denken meines ewigen Gegenübers – oder muß ich sagen: meiner Geistesprothese? –, an seine immer häufigeren Einflüsterungen und Einmischungen, zum Beispiel wie meine Rechtschreibung in diesem Text hier auszusehen habe oder wie der oder jener fremdsprachige Text zu übersetzen sei; ja, er nimmt mir dieses Denken neuerdings sogar ab und erledigt die Korrekturen, die Umwandlungen selbst, und in Zukunft vielleicht auch die Entwürfe, die ganze Schreibarbeit, ich muß nur noch das Thema entscheiden und ein paar Wünsche hinsichtlich subjektiver Färbungen äußern. Will ich das? Nein, ich will es nicht, aber ich vermute, daß die meisten es bequem finden werden. 18Ich will diese mich und uns selbst betreffende Automatisierung vermeiden, auch im Hinblick auf eine allgemeine Gesetzgebung, denn das mathematisch-statistisch-korrelationale Denken scheint mir für unsere menschlichen Zwecke bei weitem nicht ausreichend, letzten Endes zu primitiv, reduktiv, vereinfachend bei aller scheinbaren Komplexität.
Wo ich mich erinnere , d. h. auswähle im Wechselspiel mit dem nicht immer endgültigen, oft provisorischen Vergessen, speichert die Maschine, ohne auszuwählen: allenfalls kann ich nachträglich etwas löschen – und muß höllisch achtgeben, nicht zuviel oder das Falsche zu löschen – bzw. eine Kopie anzufertigen. Der Computer speichert oder kopiert, es ist dasselbe, er speichert-kopiert einfach ALLES. 19Und in den riesigen Heuhaufen, die er mit der Zeit anhäuft, findet er alles wieder, jede Stecknadel, jede kleinste Kleinigkeit. Der Search-and-find-Professional „erinnert“ sich unverzüglich an ALLES, oder genauer, an die Summe der Details. Und zwar ebenfalls auf Knopfdruck, Mausklick, durch Feld- oder Kreisberührung eines meiner Finger. Super! Und dann, noch besser: Die Maschine kann gleichzeitiges (bzw. zeitloses) Vorkommen von Daten in unterschiedlichen Dateien eruieren, man braucht nur zwei Suchstränge, oft endlos lange, spielt keine Rolle, miteinander zu kombinieren, zu kreuzen. Schnittmengen! Korrelationen! Was korreliert womit? Bildungsniveau mit Geburtenrate. Ach, das haben wir längst gewußt? Einfach durch Erfahrung – intelligente Maschinen bekommen auch „Erfahrungen“ eingespeichert! –, durch Fragenstellen, durch den Gebrauch des Verstandes sind wir zu demselben, vielleicht besseren, weil sinn- und wertvollen Resultat gekommen. Allerdings sind die Rechner schneller. Und genauer. Sie spucken Zahlen aus. Ohne Umschweife stellt ein Programm fest, daß die Zahl der Personen, die in einem Schwimmbecken ertrinken, mit der Zahl der Filme korreliert, in denen Nicolas Cage auftritt. Und daß die Scheidungsrate im US-Bundesstaat Maine vergleichbar ist mit dem Jahreskonsum von Margarine in diesem Staat. Und daß der Verzehr von Hühnerfleisch eine ähnliche Kurve aufweist wie die Einfuhr von Erdöl in die USA. Eine Fülle von Scherzen, erstellt von einem Harvard-Absolventen, der diese und zahllose andere Korrelationen auf seiner Homepage und schließlich in einem (durchaus überflüssigen) Buch kundgetan hat. Ist Nicolas Cage Schuld am Ertrinken im Swimmingpool? Halten Ehen länger, wenn Margarine vermieden wird? Werden die Hühner aussterben, wenn das Erdöl endgültig versiegt? Ach ja, Korrelationen sind noch lange keine Kausal- oder sonstigen Zusammenhänge. Dazu braucht es mehr, zum Beispiel Urteilsvermögen und Umsichtigkeit. Nicht nur Ausdauer, auch Spontaneität. Muße. Intuition.
Drei Leistungen, die ich der statistischen Intelligenz zugeordnet habe: speichern, suchen, korrelieren. Dazu kommt eine vierte: Wiederholungen bzw. Ähnlichkeiten – unvollkommene Wiederholungen – in einer großen Datenmenge – dem Heuhaufen – orten, d. h. identifizieren (die Selbigkeit feststellen). Diese viel beachtete und beanspruchte Kompetenz hat zur Konsequenz, daß mir und Millionen anderer Bürger (alias User, Nutzer, Kunden, Könige) unentwegt Vorschläge gemacht werden, Entscheidungs-, Handlungs- und Kaufvorschläge, in Summe also Vorschläge, mein Leben zu gestalten, meinen Stil, meine Vorlieben, mein Milieu, meine Gewohnheiten zu festigen, kaum je: zu erneuern oder zu ändern, sondern zu bewahren. Die personalisierenden Algorithmen der Werbung und des Internetshoppings, der Suchmaschinen und Schreibprogramme, der Newsfeeds und Kommunikationsplattformen machen den Personalcomputer oder das Smartphone zur anleitenden, den Nutzer überwachenden, kontrollierenden, ihm ent-sprechenden, aber längst nicht mehr nur „dienenden“ Allzweckmaschine. Die personalisierenden Algorithmen der Werbung und des Internetshoppings sind ihrer Natur gemäß konservativ, sie fordern die Trägheit der Kunden, nicht ihre Neugier, ihren Neuerungsgeist – Innovationen werden unter solchen Bedingungen allenfalls schleichend durchgesetzt, im Gewand des Fast-Gleichen präsentiert. Das Grundprinzip der statistischen Intelligenz führt zwangsläufig zur Anhäufung von geistigen wie materiellen Einheiten, letztlich zur Überhäufung der Einzelnen, da täglich, stündlich, im Sekundentakt in dieselben Kerben geschlagen wird, bei der Werbung ebenso wie bei den Meinungen und der Information. Filter, Blasen, Echoräume allenthalben in dieser anderen, unwirklichen Welt und im Bewußtsein, das sie modelliert (falls usermind noch den Namen „Bewußtsein“ verdient). 20Wunderbar! Die digitale Intelligenz hat sich in meiner langjährigen Gebrauchserfahrung ( user experience 21) als Speicher-Such-Kopier-Wiederholungsmaschine erwiesen und bewährt. Copy & Paste, das ist des Pudels Kern. Nur das Suchen, wenn es ein sinnvolles, zielgerichtetes sein soll, macht den digital natives Probleme. Surfendes „Suchen“ folgt dem Modell des Shoppens, man schaut hierhin und dorthin und wundert sich am Ende, was man alles zusammengekauft hat. In Bezug auf Zielrichtung und Konzentration könnten die Eingeborenen noch was lernen. Normalerweise kopieren sie irgendwas, das nächstliegende, und das nächste, das nächste. Kein Überblick! Kein Sinn. Kein Wald vor lauter Bäumen.
Aber alles sehr nützlich und praktisch.
And yet, and yet …
Die durch neurowissenschaftliche Forschung immer genauer nachgewiesene Unfreiheit des Menschen und aller anderen Naturwesen ist eines der Steckenpferde des Historikers Yuval Harari, der nun konsequenterweise in geschichtlichen Abläufen die eine lückenlose Wirkung deterministischer Gesetze sehen müßte, die der Geschichte im großen wie im kleinen ihre wechselnde Gestalt aufprägen müßten (zumindest müßte der Historiker versuchen , dies zu tun). Wir glauben frei zu handeln, aber tatsächlich sind wir in jedem Augenblick nur ein Spielball innerer und äußerer Zwänge. Deshalb wäre es besser, so Harari ironisch (?), uns gleich von Algorithmen lenken zu lassen, die uns aufgrund ihrer in Windeseile durchgeführten Berechnungen klar und deutlich sagen können, was gut für uns ist und was nicht, bei Einkäufen genauso wie bei politischen Wahlen, auf der Partner- wie auf der Finanzbörse. Algorithmen, digitale Filter, sogenannte Feeds sind im Grunde genommen Identitätsmaschinen, die immer das Selbe – das Identische – wiederholen und Abwandlungen nur in kleinster Dosierung zulassen. Zu befürchten steht, daß auch bei solchen Lebensprogrammen nur der statistische Konservativismus zum Tragen kommt und die ewige Wiederholung des Gleichen promoviert wird, nicht etwa offene Lebensmodelle, wie einige Soziologen der Spätmoderne unterstellen. Voraussetzung dafür ist allerdings, daß wir vollständig vernetzt sind und der Algorithmus auf eine dementsprechend große Zahl von Daten zugreifen kann; bei politischen Wahlen müßte der Rechner z. B. vorhersagen können, wie sich das Klima in den nächsten fünfzig Jahren entwickeln wird. Aber egal, auf alle Fälle geht der Algorithmus geschickter, eilfertiger und letztlich klüger mit den Daten um als wir selbst. Beim handelnden oder sich leiten lassenden menschlichen Subjekt wird die Erkenntnis der Unfreiheit zusammen mit der eingeschliffenen Erwartung, das Smartphone wisse ohnehin alles besser, und anderen Faktoren – wie Wohlstand, lückenloses, ermüdendes Erziehungssystem, regelmäßige Evaluierung, Stress permanenter Leistungsnachweise – die Trägheit weiter verstärken und zementieren. Nein, wir müssen uns unseres Verstandes nicht mehr bedienen: Das ist schlicht und einfach nicht notwendig für eine adäquate Lebensgestaltung.
Читать дальше