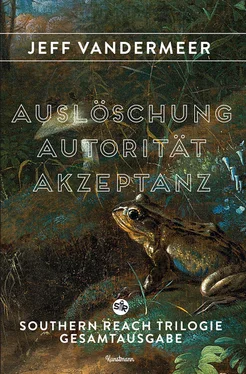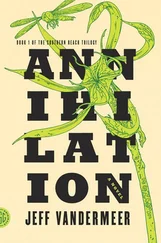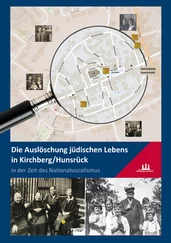Und dann erklang das Stöhnen so nah, wie ich es noch nie gehört hatte, begleitet von einem lauten Bersten. Ich blieb stehen, stellte mich auf die Zehenspitzen und ließ das Licht der Taschenlampe über das Schilf zur Linken gleiten, gerade rechtzeitig, um es in einer breiten Welle brechen zu sehen, die sich rechtwinklig auf den Pfad zubewegte und schnell näherkam. Das Röhricht wurde so schnell entwurzelt, als wäre eine Mähmaschine im Einsatz. Das Ding versuchte, mich auf der Flanke zu umgehen, doch das helle Leuchten, das von ihm ausging, hielt meine Panik in Schach.
Einen Augenblick lang zögerte ich. Ein Teil von mir wollte das Lebewesen sehen, das ich so viele Tage nur gehört hatte. Waren es die Reste der Wissenschaftlerin in mir, die sich ein letztes Mal formierten und an mein Denkvermögen appellierten, wo es doch um nichts anderes als das reine Überleben ging?
Doch wenn es so war, dann konnte sich die Wissenschaftlerin nicht durchsetzen.
Ich rannte. Ich war überrascht, wie schnell ich rennen konnte – ich war noch nie so schnell gerannt. In den schwarzen schilfgesäumten Tunnel hinein, dessen Rohre von rechts und links in meinen Weg ragten, was mir völlig egal war, denn das Leuchten trieb mich vorwärts. Um an der Bestie vorbeizukommen, bevor sie mir den Weg abschnitt. Ich spürte das Dröhnen ihrer Tritte, mit denen sie sich durch das splitternde Röhricht Bahn brach, und das Stöhnen hatte einen erwartungsvoll suchenden Unterton bekommen, dessen Eindringlichkeit mir den Magen umdrehte.
Aus der Dunkelheit zu meiner Linken schien etwas ungeheuer Massiges auf mich loszustürmen, die Ahnung einer gequälten, bleichen Fratze, die von einem schwerblütigen Körper getrieben wurde. Es raste auf einen Punkt zu, der vor mir lag, aber mir blieb nichts anderes, als es kommen zu sehen und mich wie ein Sprinter über die Ziellinie zu stürzen und somit an ihm vorbei und frei zu sein.
Aber es kam schnell, viel zu schnell. Mir war klar, dass ich es nicht schaffen würde, es war einfach nicht zu schaffen, nicht bei diesem Winkel, aber ich wollte es jetzt wissen.
Dann kam der entscheidende Augenblick. Ich schien auf gleicher Höhe mit seinem heißen Atem zu sein, und selbst im Laufen noch schrie ich auf und zuckte zusammen. Aber dann war der Weg vor mir frei, und von rechts hinter mir hörte ich einen schrillen Klagelaut, ich fühlte, wie etwas plötzlich diesen Raum ausfüllte , versuchte, abzubremsen und die Richtung zu ändern und trotzdem von seinem eigenen Schwung in das Schilf auf der anderen Seite des Weg gerissen wurde. Eine schon wehmütige Klage, die mit aller Einsamkeit dieses Ortes nach mir rief. Und rief, und rief, mich anflehte, zurückzukommen, um es in seiner Gänze zu sehen, seine Existenz anzuerkennen.
Ich schaute nicht zurück. Ich rannte einfach weiter.
Irgendwann hörte ich schwer atmend auf zu rennen. Auf wackeligen Knien stolperte ich weiter, bis der Pfad den Wald erreichte, so weit, bis ich eine große Eiche fand, die ich erklettern konnte und dort eine ungemütliche Nacht verkeilt in einer Astgabelung verbrachte. Wenn dieses stöhnende Wesen mir bis hierhin gefolgt wäre, ich hätte nicht gewusst, was ich hätte tun sollen. Ich konnte es immer noch hören, aber offenbar in großer Entfernung. Ich wollte nicht mehr daran denken, aber ich konnte nicht aufhören, daran zu denken.
Ich hatte einen unruhigen Schlaf, aus dem ich immer wieder aufschreckte, und hielt ein wachsames Auge auf den Boden gerichtet. Einmal blieb etwas Großes am Fuß des Baumes stehen und schnüffelte, zog dann aber seiner Wege. Dann hatte ich den Eindruck von etwas weiter entfernten Schemen, aber das war es auch schon. Sie schienen einen Augenblick inne zu halten, phosphoreszierende Augen, die in der Dunkelheit schwammen, aber ich empfand sie nicht als Bedrohung. Ich hielt das Tagebuch meines Mannes wie einen Talisman an meine Brust gedrückt, aber weigerte mich noch immer, hineinzuschauen. Meine Angst vor dem, was ich dort lesen mochte, war inzwischen noch größer.
Irgendwann vor Sonnenaufgang wachte ich auf und sah, dass mein »Leuchten« sprichwörtlich geworden war: In der Dunkelheit strahlte meine Haut leicht phosphoreszierend, ich versuchte, meine Hände in den Ärmeln zu verstecken und zog den Kragen hoch, um so wenig sichtbar wie möglich zu sein, und ließ mich wieder in den Schlaf treiben. Ein Teil von mir wollte immer weiter schlafen, durch alles hindurch, was vielleicht noch passieren mochte.
Aber inzwischen war mir eines wieder eingefallen: wo ich die Maske, die abgestreifte, schon einmal gesehen hatte. Es war das Gesicht des Psychologen der elften Expedition, ein Mann, den ich nur aus Befragungen nach seiner Rückkehr über die Grenze kannte. Ein Mann, der mit ruhiger, ja gelassener Stimme gesagt hatte: »Es war sehr schön, ausgesprochen friedlich in Area X. Wir haben nichts Ungewöhnliches bemerkt. Überhaupt nichts Ungewöhnliches.« Und dann hatte er unbestimmt gelächelt.
Ich fing langsam an zu verstehen, dass der Tod hier nicht das gleiche war wie auf der anderen Seite der Grenze.
Während ich am nächsten Morgen in den Teil von Area X kam, wo der Weg einen steilen Hang empor führte, auf dessen beiden Seiten die sumpfigen schwarzen Gewässer mit den trügerischen, gleichsam toten Zypressenstümpfen übersät sind, hallte in meinem Kopf immer noch das Stöhnen dieses Lebewesens wider. Das Wasser erstickte jedes Geräusch, und seine reglose Oberfläche reflektierte nichts als graue Flechten und Äste. Ich liebte diesen Teil des Wegs wie keinen anderen. Hier war diese Welt auf eine Art wach, die mit einem Gefühl friedlicher Einsamkeit einherging. Die Stille lud geradezu dazu ein, die eigene Wachsamkeit schleifen zu lassen, und war gleichzeitig eine Warnung, nicht allzu sorglos zu werden. Das Basislager war nur noch eine Meile entfernt, und das Licht und die durch das hohe Gras summenden Insekten hatten mich träge gemacht. Ich war auch schon dabei, mir zurechtzulegen, was ich der Vermesserin sagen, was ich ihr erzählen und was ich lieber für mich behalten wollte.
Mein inneres Leuchten flackerte auf und gab mir so die Zeit, einen halben Schritt nach rechts zu machen.
Der erste Schuss schlug in der linken Schulter ein, anstatt mein Herz zu treffen, und der Stoß warf mich zur Seite und nach hinten. Der zweite Schuss riss meine linke Seite auf, er holte mich nicht von Füßen aber führte dazu, dass ich ins Trudeln geriet und stolperte. Während ich in der folgenden Stille den Hang hinab kollerte fing es in meinen Ohren an zu dröhnen. Ich lag am Fuß des Hügels, die Luft aus der Lunge gepresst, die Hand des ausgestreckten Arms hing im Wasser, den anderen hatte ich unter mir begraben. Der Schmerz in meiner linken Seite fühlte sich zunächst so an, als würde mich jemand mit einem Schlachtermesser aufschneiden und dann wieder zusammennähen. Er reduzierte sich wie durch eine zelluläre Verschwörung aber schnell zu einem dumpfen Pochen, die Schusswunde fingen an sich anzufühlen, als würden winzige Tierchen in mir hin und her wuseln.
Es waren nur ein paar Sekunden vergangen. Ich wusste, dass ich hier wegmusste. Glücklicherweise hatte ich meine Waffe im Holster stecken, sonst wäre sie weggeflogen. Jetzt zog ich sie heraus. Ich hatte das Zielfernrohr gesehen, ein winziger Kreis im hohen Gras, das mir verriet, wer diesen Hinterhalt gelegt hatte. Die Vermesserin war beim Militär gewesen, und sie war gut, aber sie konnte nicht wissen, dass mein »Leuchten« mich beschützte, dass der Schock mich nicht übermannt, dass die Wunde mich nicht starr vor Schmerzen gemacht hatte.
Ich rollte mich auf den Bauch und wollte am Ufer entlang kriechen.
Dann hörte ich die Stimme der Vermesserin von der anderen Seite der Böschung: »Wo ist die Psychologin? Was hast du mit ihr gemacht?«
Ich machte den Fehler, ihr die Wahrheit zu sagen.
Читать дальше