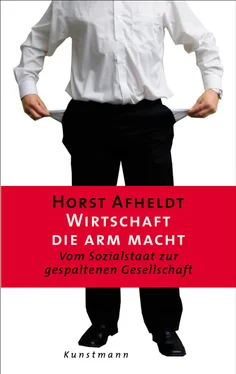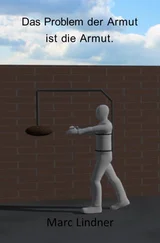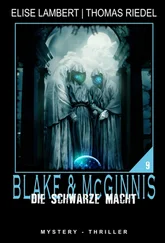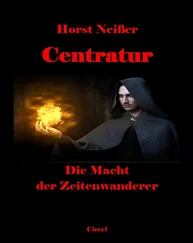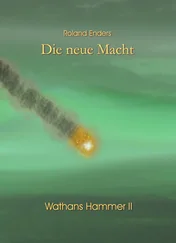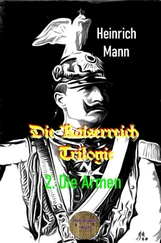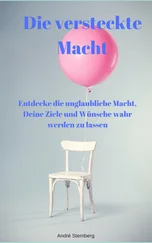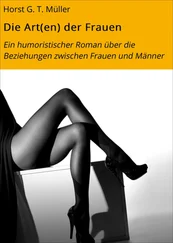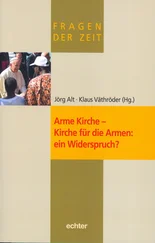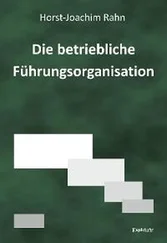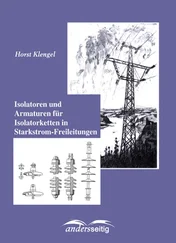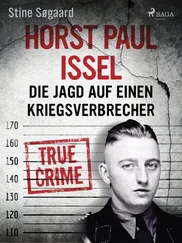Mehr Wachstum als das, was erzielt wurde, war nicht zu erreichen – und wird nach allen Erfahrungen in allen Industrienationen aller Voraussicht nach auch in der Zukunft nicht zu erreichen sein. Weniger ist allerdings sehr wohl möglich. Wenn die Nachfrage nachhaltig absinkt, gibt es auch weniger Gewinne und weniger Investitionen. Dauerhaft sinkende Masseneinkommen – aus welchen Gründen auch immer – führen so zu einer Wirtschaftsentwicklung deutlich unter der Linie, sie vereiteln die zur Korrektur notwendigen Phasen übernormalen Wachstums.
Der Traum vom ewigen Wachstum – ein Alptraum?
Stetiges exponentielles Wachstum mit den jährlichen Wachstumsraten der ersten Nachkriegsperiode ist also eine Fata Morgana. Aber ein solches Wachstum hätte ohnedies zu vollständig unsinnigen Folgen geführt. Wirtschaftlich und ökologisch. Hätte jede deutsche Familie vielleicht ein von Straßen und Plätzen startfähiges kleines Privatflugzeug 21in der Garage haben sollen, um dem hoffnungslosen Lastwagenstau zu entgehen? In »Wohlstand für niemand?« schrieb ich 1993: 22
» … der feste Glaube an exponentielles Wachstum war bis weit in die 70er Jahre unantastbare Bedingung dafür, in der wissenschaftlichen Diskussion der Ökonomen ernstgenommen zu werden. 23Und aus diesem Glauben wurden für Politik, Technik und Umwelt folgenschwere Entscheidungen abgeleitet. Wenn die Wirtschaft exponentiell wachsen sollte, dann mußte z.B. nach der damals herrschenden Lehre auch der Energieverbrauch exponentiell wachsen. 24Denn, so lautete ein weiterer Glaubenssatz: Energieverbrauch und Wirtschaftswachstum sind fest aneinander gekoppelt. Noch 1978 erwarteten daher die Institute DIW und RWI sowie das Energiewissenschaftliche Institut der Universität Köln bei einem exponentiellen Wirtschaftswachstum von 3,2–4% jährlich ein Wachstum des Stromverbrauchs zwischen 4,2% und 5,6%. Diese Schätzungen wurden dann dem damaligen Energieprogramm der Bundesregierung zugrunde gelegt.
Die Schätzungen der frühen 70er Jahre lagen noch höher. So beruhte das Kernenergieprogramm der sozialliberalen Koalition auf der Annahme, der Stromverbrauch müsse jährlich um 7% steigen. Was bedeutet hätte, daß er sich bis 1985 auf das 15fache, bis 2000 auf das 42fache und bis 2030 auf das 319fache hätte steigern müssen. Der bekannte Physiker Alwin A. Weinberg berechnete damals den Energiebedarf der Welt und kam zu dem Resultat: Wenn die Weltbevölkerung sich auf einem Niveau von 15–20 Milliarden Menschen stabilisiert, kann ihr Energie- und Rohstoffbedarf gedeckt werden, wenn jährlich 1000 Kernkraftwerke auf- und nach 30-jähriger Betriebsdauer abgebaut werden. 25Wenn man sich spaßeshalber vorstellt, daß dann jeden Tag in der Welt drei Kernkraftwerke hätten gebaut und abgerissen werden müssen, wird der Unsinn solcher Annahmen andauernden exponentiellen Wachstums offensichtlich.« 26
Doch dieses ewige Wirtschaftswachstum findet nicht statt. Es gibt offensichtlich innere, ökonomische Grenzen des Wachstums. Die Horrorvorstellung des Club of Rome, der der Wirtschaft ökologische Grenzen des Wachstums entgegenhielt, war – zum Glück – ein Trugbild.
Auf mehr als das bisherige lineare Wachstum zu setzen heißt deshalb, auf Wunder zu hoffen. Die Wirtschaftspolitik einer Nation auf ein Wunder zu gründen, widerspricht so evident der wirtschaftlichen Erfahrung, dass zumindest von grober Fahrlässigkeit gesprochen werden muss.
Aber selbst wenn es dieses »Wachstumswunder« gäbe, würden die Probleme unserer Volkswirtschaft dadurch nicht gelöst. Denn nicht nur das ewige Wachstum, sondern auch die Umsetzung von Wirtschaftswachstum in »Wohlstand für alle« entpuppte sich als Fata Morgana.
Warten auf Wachstum für Arbeitsplätze
ist Warten auf Godot
Arbeitslosigkeit, Pleite der öffentlichen Hand und schnell wachsende Ungleichheit kennzeichnen die Krise des »Sozialstaats BRD« zum Jahrtausendbeginn. Das Aufbrechen verkrusteter Strukturen am Arbeitsmarkt, Steuersenkungen und allgemein weniger Pessimismus sollen die Wirtschaft ankurbeln, den Aufschwung bringen. Aufschwung schafft neues Wirtschaftswachstum und damit Arbeitsplätze. Wer glaubt das etwa nicht – wo es doch jeden Tag in den Zeitungen steht?
Nur: Selbst die Verdopplung des Sozialprodukts von Anfang der 70er Jahre bis zur Jahrtausendwende war mit zunehmender Arbeitslosigkeit, öffentlicher Armut und wachsender Ungleichheit verbunden. 1993 schrieb ich in »Wohlstand für niemand?«:
»Seit mehr als zwei Jahren erinnert das Stück, das Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsjournalismus aufführen, auffallend an Becketts Godot. Da wird ausgeschaut und ausgeschaut, der Aufschwung angekündigt, immer wieder sieht man einen Silberstreif im beginnenden Wirtschaftsaufschwung in den USA. Hoffen, die zentralen Probleme Abwanderung von Industrie, Arbeitslosigkeit und Staatsverschuldung würden sich durch eine Konjunkturbesserung lösen, wird so zum Warten auf Godot – und der kam bekanntlich nie.« 27
Daran hat sich nichts geändert. Meinhard Miegel 2002:
»Die Politik … hofft …, dass hohe Wachstumsraten irgendwann das Beschäftigungsproblem lösen werden.
Diese Hoffnung ist vergeblich. Ihr fehlt jede Grundlage. Sie ist wie das Warten auf Godot – er kommt nie. Schon der gedankliche Ansatz ist falsch. Arbeit entsteht nicht durch Wachstum, sondern Wachstum durch Arbeit. Das ist zahllose Male festgestellt worden, hat aber im öffentlichen Bewusstsein kaum Spuren hinterlassen.« 28
Warum aber ist diese Hoffnung vergebens? Viele Ursachen kommen hier zusammen, unabänderliche und, bei politischem Willen und politischer Gestaltungsmacht, veränderliche.
Unabänderlich: Steigende Arbeitsproduktivität
entwertet den Faktor Arbeit
Steigende Arbeitsproduktivität, also höhere Produktion je Arbeitsstunde, ist die Grundlage des gewachsenen Wohlstands der Industrienationen. Ohne sie lägen die Löhne heute noch bei wenigen Euro je Stunde. Doch sie hat eine Kehrseite, die sich immer mehr in den Vordergrund schiebt: Je mehr ein Arbeiter pro Stunde produziert, desto weniger Arbeitsstunden braucht er für dieselbe Warenmenge. Gelingt es nicht, den Absatz ebenso schnell zu steigern, wie die Arbeitsproduktivität wächst, braucht man weniger Arbeitsstunden – letztlich also weniger Arbeiter.
Im internationalen Vergleich ist der Kapitaleinsatz in Deutschland besonders hoch. Der Kapitaleinsatz stieg (preisbereinigt) von 1950 bis 2000 pro Erwerbstätigenstunde auf das Siebenfache. 29Hier liegt eine Wurzel für die nicht durch »Wachstum« zu behebende Arbeitslosigkeit.
Miegel bringt die jedermann zugänglichen Fakten meisterlich auf den Punkt:
»Bei einem 25-jährigen jahresdurchschnittlichen Wachstum von real 5,4% schrumpfte das Arbeitsvolumen pro Kopf der westdeutschen Bevölkerung jährlich um gut ein Prozent. Da darf wohl gefragt werden, wie viel Wachstum denn von Nöten ist, um unter den konkreten Bedingungen Deutschlands die Arbeitsmenge stabil zu halten oder gar anschwellen zu lassen. Im dritten Jahrhundertquartal hätte es jährlich annähernd bei sieben Prozent liegen müssen, was einer Verdoppelung der Güter- und Dienstleistungsmenge in zehn Jahren und deren Zunahme auf mehr als das Fünffache in 25 Jahren entspricht.« 30
Bringen Steuersenkungen Arbeitsplätze?
Das neoliberale Standardargument für Steuersenkungen zum Zwecke möglichst hoher Gewinne ist der Glaube an die »Angebotspolitik«. Angebotspolitik setzt mit ihren Maßnahmen zur Erreichung gesamtwirtschaftlicher Ziele wie Inflationsbekämpfung und Wachstum auf der Angebotsseite der Wirtschaft an. Wenn Waren oder Dienstleistungen produziert werden, schlägt sich das angeblich in entsprechendem Einkommen nieder, das nach Jean Baptiste Say zu einer kaufkräftigen Nachfrage führe. Nur: Dieser Effekt verschwindet, wenn die Löhne durch den Weltmarktdruck nicht mehr mit der Produktion, dem Sozialprodukt, steigen und darüber hinaus der Faktor Arbeit, in dem die Löhne steigen sollen, durch Kapital ersetzt wird. Und das geschieht immer schneller, je mehr alte Anlagen durch Neuinvestitionen ersetzt werden.
Читать дальше