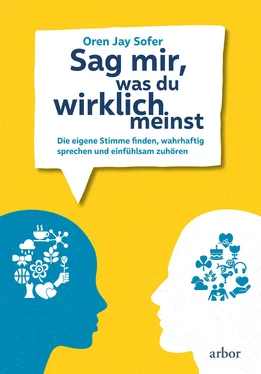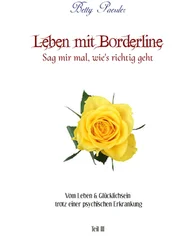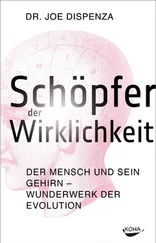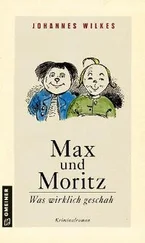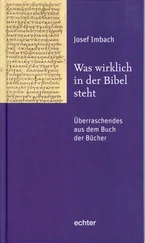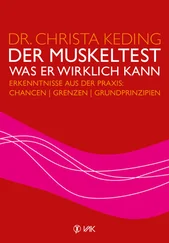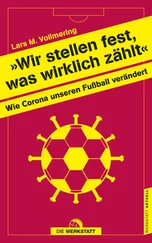3Rosenberg, Marshall B.: Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens, Paderborn: Junfermann, 12., überarbeitete und erweiterte Auflage 2016 (2001) (orig. Nonviolent Communication. A Language of Life, Encinitas, CA: PuddleDancer Press, 3rd Edition 2015 [1999]).
4Rosenberg, Marshall B., zitiert nach Teilnehmern einer Sitzung während eines Workshops über GfK und sozialen Wandel, Schweiz, Juni 2005.
5Siehe die Definition im Glossar. Ein Bürger der Vereinigten Staaten zu sein bringt beispielsweise in den USA wie auch in vielen anderen Ländern der Welt bestimmte Privilegien mit sich. Weiß, männlich, gebildet oder körperlich unversehrt und so weiter zu sein hat in unserer derzeitigen Gesellschaft ebenfalls bestimmte Vorteile. Vgl. McIntosh, Peggy: »White Privilege: Unpacking the Invisible Knapsack«, National SEED Project, 1989, https://nationalseedproject.org/Key-SEED-Texts/white-privilege-unpacking-the-invisible-knapsack, abgerufen am 19. 3. 2021; Kasthan, Miki: »You’re Not a Bad Person: How Facing Privilege Can Be Liberating«, The Fearless Heart , 26. 11. 2016, http://thefearlessheart.org/youre-not-a-bad-person-how-facing-privilege-can-be-liberating, abgerufen am 15. 3. 2021. Zu den Themen »Privilegien und Macht im Kontext der Gewaltfreien Kommunikation« vgl. Manning, Roxy, und Skinner, Janey: »NVC – Changing Consciousness, Relationships & Systems«, BayNVC, http://baynvc.org/nvc-changing-consciousness/, abgerufen am 12. 4. 2018.
Teil I
Der erste Schritt
Mit Präsenz beginnen
Gelingende Kommunikation beruht auf unserer Fähigkeit, präsent zu sein. Offenes und ehrliches Sprechen, tiefes Zuhören und das Navigieren durch die unvermeidlichen Drehungen und Wendungen eines Gesprächs erfordern ein hohes Maß an Selbstgewahrsein. Um zu sagen, was wir meinen, müssen wir zuerst einmal wissen, was wir meinen. Und um zu wissen, was wir meinen, müssen wir nach innen lauschen und herausfinden, was unsere Wahrheit ist.
Der erste Schritt der achtsamen Kommunikation besteht darin, mit Präsenz zu beginnen, also möglichst voll und ganz da zu sein. Wenn wir nicht da sind, sind wir wahrscheinlich im Autopilotmodus. Und in diesem Modus ist es weniger wahrscheinlich, dass wir uns an die Methoden erinnern, die wir gelernt haben, aus unseren besten Intentionen heraus sprechen und Zugang zu unserer Weisheit haben.
Mit Präsenz zu beginnen ist eine tiefe Praxis mit vielen Dimensionen. In Teil I erkunden wir diese erste Grundlage gelingender Kommunikation: unsere Fähigkeit, präsent zu sein. Wir betrachten die Natur der menschlichen Kommunikation, welche zentrale Rolle sie in unserem Leben einnimmt und welche Möglichkeiten wir haben, in uns selbst und in Gesprächen bewusster zu werden.
1
Das Zentrum unseres Lebens
»Sprache ist sehr mächtig. Sprache beschreibt die Realität nicht nur. Sprache erschafft die Realität, die sie beschreibt.«
Desmond Tutu
Wir kommen auf diese Welt verletzlich, vollkommen abhängig und bestens darauf vorbereitet, sprechen zu lernen. Von dem Moment unserer Geburt an steht Kommunikation im Zentrum unseres Lebens.
Ein Menschenkind wird mit dem Potenzial geboren, jede der rund siebentausend Sprachen auf dieser Welt zu lernen. In den ersten Wochen und Monaten haben wir jedoch nur zwei Mittel zur Verfügung, um unsere Bedürfnisse auszudrücken: Weinen und Lächeln. Das ist die Ausgangsbasis für unsere Gehirnentwicklung. Die Neuronen sind darauf angelegt, die menschliche Sprache nach Rhythmus, Klang, Ton und Lautstärke zu unterscheiden. Und in diesem frühen Alter lernen wir sehr schnell – unabhängig davon, in welche Sprache die Umstände (oder das Schicksal) uns hineinfallen lassen.
Mittels dieses Systems aus Klängen, Worten und Grammatik lernen wir, unsere Gefühle auszudrücken, um das zu bitten, was wir brauchen, und das zu bekommen, was wir wollen. Schließlich, wenn alles gut läuft, lernen wir, zu lesen und komplexere soziale Signale einzusetzen; wir lernen Metaphern, Idiome und Humor. Und all dies lernen wir durch Zuhören, Nachfragen, Beobachten und Wiederholen.
Wenn wir mithilfe der Sprache unseren Platz in der Menschenfamilie einnehmen, greifen wir ganz natürlich jene Kommunikationsmuster auf, die nun mal in unserer jeweiligen Herkunftsfamilie, ethnischen Gruppe, sozialen Schicht, Geschlechtszugehörigkeit, Gesellschaft und dominanten Kultur vorherrschen. Manche von uns lernen, dass es nicht sicher ist, Bedürfnisse auszudrücken, und versuchen dann zu bekommen, was sie brauchen, indem sie sich um andere kümmern. Andere lernen, gewaltsam zu bekommen, was sie wollen; also setzen sie sich durch und versuchen, als die Stärksten oder Klügsten dazustehen. Wieder andere lernen, dass ihre Bedürfnisse von der Gesellschaft nicht geschätzt werden, und werden dann innerlich hart und schneiden sich von ihrer Verletzlichkeit ab. Und manchmal lernen wir zum Glück auch, dass es Raum gibt, um das zu bitten, was wir brauchen, und dabei mit den anderen in Verbindung zu bleiben und gemeinsam eine Lösung zu finden.
Die meisten Menschen vereinen mehrere dieser Strategien, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen, doch egal, was wir gelernt haben, wir alle haben eine Kommunikationsschulung durchlaufen, wenn auch zumeist eine unbewusste. Der Kontext unseres sozialen Umfeldes und kulturellen Milieus bestimmt den Rahmen und prägt unsere Überzeugungen, und unsere Lebenserfahrung bestätigt und verstärkt diese. Zumindest geschieht dies so lange, bis etwas in unserem Inneren wach wird und sagt: »Das geht so einfach nicht!« Diese Erkenntnis mag durch eine gescheiterte Beziehung oder eine schwierige Ehe befördert werden, durch einen Streit, der in dem Verlust einer Freundschaft endet, oder durch ständige Kommunikationsprobleme bei der Arbeit, durch das Ringen ums Überleben in einem System, das nicht darauf angelegt ist, unsere menschlichen Bedürfnisse zu erfüllen, durch die missliche Lage unserer Welt – oder einfach dadurch, dass wir die Tyrannei der Stimme in unserem eigenen Kopf satthaben.
Die gute Nachricht bei alldem lautet: Da Sprache etwas Erlerntes ist, da unsere Kommunikationsmuster und die emotionalen Gewohnheiten, die sie am Laufen halten, angelernt sind, können sie auch verlernt und neu gelernt werden. Wir können lernen, auf eine neue Weise zu sprechen und zuzuhören, die dem Leben dient, das wir führen wollen, und der Gesellschaft, die wir schaffen wollen, zuträglicher ist.6 Wir können lernen, unsere Stimme zu finden, zu sagen, was wir meinen, und eine tiefere Art des Zuhörens entdecken.
Mein Weg aus der Sprachlosigkeit
Ich erreichte einen Wendepunkt, als ich Anfang zwanzig war. Nach so einigen gescheiterten Beziehungen, verlorenen Freundschaften und der Scheidung meiner Eltern wandte ich mich der buddhistischen Meditation zu, um Ordnung in mein inneres Chaos zu bringen. Nach dem College lebte und arbeitete ich in der Insight Meditation Society im ländlichen Massachusetts. Die buddhistischen Lehren halfen mir, besser klarzukommen und reifer zu werden. Und doch bemerkte ich, dass Qualitäten wie Klarheit, Güte und Mitgefühl, die ich so stark empfand, während ich meditierte, sich meist schnellstens in Luft auflösten, wenn es beispielsweise einen Konflikt mit einem Kollegen gab. Und noch weniger zugänglich waren sie mir, wenn ich mit meiner Familie sprach.
Ich erinnere mich an einen besonders wüsten Streit mit meinem älteren Bruder, der damit endete, dass ich, an der Grenze meiner Frustrationstoleranz angelangt, einen Stuhl nahm und ihn auf den Boden im Wohnzimmer meiner Großmutter schmetterte. Dramatisch, ich weiß – aber so war es.
Erst als ich an einem Kommunikationstraining für die Mitarbeiter des Meditationszentrums teilnahm, wurde mir klar, dass ich meine Sprechgewohnheiten genauer studieren und verbessern konnte. Nach diesem ersten halbtägigen Seminar hatte ich angebissen. Ich belegte einen achtwöchigen Kurs in einem nahegelegenen Städtchen, und es dauerte nicht allzu lange, bis ich auf Dr. Marshall B. Rosenberg stieß.
Читать дальше