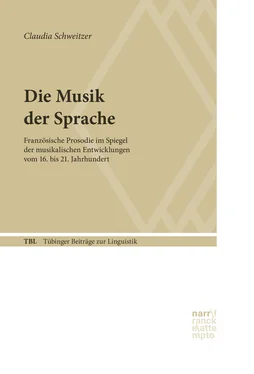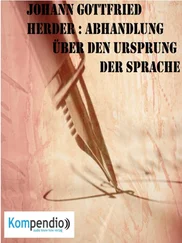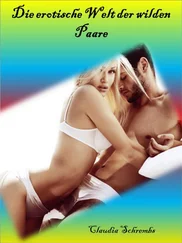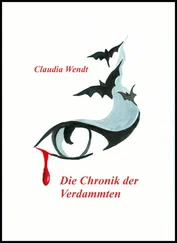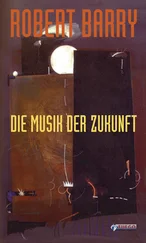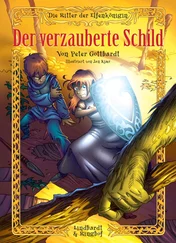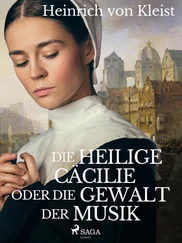Im Gegensatz zu unserem heutigen Notensystem haben die Noten in der Renaissance keine absoluten Werte: Das sogenannte Mensurzeichen (vgl. Bsp. 11), das an der Stelle des heutigen Taktzeichens1 steht, bestimmt das Verhältnis der Notenwerte untereinander. In der Komposition können die verschiedenen Abschnitte und sogar unterschiedliche Stimmen in einem einzigen Abschnitt mit unterschiedlichen Mensuren notiert sein. Einziges verbindendes Element ist in diesem Fall der Tactus , ein gemeinsamer Grundschlag. Trotz Mehrstimmigkeit ist der Höreindruck linear. Strukturbildendes Element ist neben der Klausel2 vor allem die gemeinsame Atmung der Sänger.
Eine wichtige Gattung bildet im 15. und 16. Jahrhundert die Chanson, ein mehrstimmiges, weltliches, in französischer Sprache gesungenes „Lied“.3 Besonders in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zeichnen sich viele Chansons durch eine syllabische Textverteilung und einen durchgehend homorhythmischen Satz aus: Alle Stimmen singen zur gleichen Zeit denselben Text. Dies Verfahren ist nicht nur der Textverständlichkeit, sondern auch der neuen Verbindung von Text und Musik zuträglich. Der Theoretiker Pontus de TyardTyard, Pontus de (1555) unterstreicht ebenso wie Pierre de RonsardRonsard, Pierre de das (neu-) platonische Ideal einer engen und klar geregelten Verbindung von Wort und Musik. Die Präzision der Verse RonsardRonsard, Pierre des, die, wie oben geschildert, metrische Regeln und Varietas miteinander in Einklang bringen, erleichtert die Vertonung des Textes mit einer Musik, die durch die Regelmäßigkeit des Phrasenbaus und durch die Schlichtheit der Satzstruktur die als wichtig erachteten prosodischen Elemente perfekt widerspiegelt.4
Die gute, richtige und natürliche Ordnung der Dinge ist ein wichtiges Thema für die Autoren der Renaissance. Die Rhetorik von Louis de LesclacheLesclache, Louis de (1648) beispielsweise ist laut Michel Le Guern (Lesclache, 2012 [1648]) von einer wahren Ordnungsbesessenheit durchzogen. Diese zeigt sich im dem folgenden, dem 9. Kapitel des 2. Teils entnommenen Zitat: „Alle Dinge haben ihre Ordnung. Alle Handlungen werden in der richtigen Reihenfolge ausgeführt. Es ist offensichtlich, dass die Ordnung uns das perfekte Wissen aller Dinge gibt.“1
Die Quantität, das heißt die Länge der Silben, ist einer dieser von der Natur gegebenen, die Welt ordnenden und Zugang zur wahren Erkenntnis der Dinge ermöglichenden Faktoren. Sie stellt ein die Disziplinen verbindendes Element dar. Neben Poeten und Musikern beschäftigen sich auch die Grammatiker mit diesem Thema. Wenn der französische Vers auf der Anzahl der Silben beruht, so heißt dies nicht, dass die französische Sprache in den Augen der Theoretiker nicht über unterschiedliche Quantitäten verfüge.2 Oft wird Silbenlänge mit Akzentuierung gleichgesetzt – eine Intuition, die zwar nicht grundsätzlich falsch, aber doch bei Weitem nicht vollständig ist (vgl. Kapitel 6). Der Akzent, den Myriam Suzanne RionRion, Myriam Suzanne in der Poesie RonsardRonsard, Pierre des durch die Häufigkeit der Reime identifiziert hat (siehe oben), entsteht in der Vokalmusik der Renaissance durch die den gleichmäßigen Melodiefluss unterbrechenden langen Noten oder durch die Verwendung bestimmter, das Phrasenende ankündigender Formeln (der Klauseln).
In der Renaissance hat die Verbindung von Sprache und Musik eine theoretisch-philosophische Grundlage. Sie ist von der Antikenrezeption der Autoren bestimmt und manifestiert sich vorwiegend in den Parametern Rhythmus (Quantität) und Klangqualität. Poesie, Musik und Philosophie vereinen sich in dem gemeinsamen Ziel der Erkenntnis, das heißt insbesondere der Kenntnis des Universums und der Erhebung der Seele zu einem Zustand vollkommener Ruhe (His & Vignes, 2010: 255).
2.3 Der französische Barock: Eine musikalische Deklamation
Musik und Deklamation
Die für die Renaissance so typische Linearität der Komposition steht im Zentrum der großen Umwälzungen, die das Barockzeitalter mit sich bringt. Die moderne Takthierarchie mit konsequenter Betonung der ersten Zählzeit jedes Taktes (und entsprechenden Nebenbetonungen) entwickelt sich, und in der Vokalmusik ist eine Tendenz zu monodischen Kompositionen, das heißt zum Sologesang, spürbar. Im Unterschied zu Italien verläuft diese Entwicklung in Frankreich nicht über die Gattung der Oper.1 Dieses neue Kompositionsgenre konnte hier nur schwer Fuß fassen. Der Übergang zu einer neuen Ästhetik vollzieht sich in kleinen Formen wie die der (von der Theorie der musique mesurée à l’antique beeinflussten) Chanson und des Air de Cour . Neben den mehrstimmigen, homorhythmischen Kompositionsformen (vgl. Bsp. 13) entsteht eine neue Gattung, die ebenfalls in Strophenform verfasst, aber für eine Solostimme mit Lautenbegleitung komponiert ist. Diese Form ermöglicht eine sorgfältige Textbehandlung und einen expressiven Gesang, kurz gesagt, eine wahrhafte Deklamation des Textes. Die Beherrschung der Deklamationskunst wird denn auch unabdingbar für jeden barocken Komponisten und Sänger.2
Rhythmisch gesehen entspricht die lange Silbe einer langen Note. Die betonte Silbe des Taktes befindet sich zudem normalerweise auf dem ersten, betonten Taktschlag. Takthierarchie und ein neues, harmonisches Denken geben der Musik nunmehr eine zusätzliche, vertikale Ausrichtung. Darüber hinaus spiegeln melodische Konturen und Phrasierung des Gesangs diejenigen der Rede wider (vgl. Schweitzer, 2018: 332–334). Die Musik ist der Poesie untergeordnet, und gemäß diesem Ideal muss das Klangmaterial der gesprochenen Sprache genau in präzise musikalische Rhythmen, Intervalle, Figuren und Klangfarben umgewandelt werden. Die Musik kann somit als natürliche Nachahmung der gesprochenen Sprache verstanden werden. Durch diesen Kunstgriff erhält die Musik eine semantische Funktion. Sie kann nicht nur Geräusche der Natur (zum Beispiel Vogelgesang) oder natürliche Phänomene (wie das Hinaufsteigen einer Treppe durch eine aufsteigende Tonfolge) imitieren, sondern Musik wird zu einer eigenen Sprache, wenn sie direkt nach den Prinzipien der gesprochenen Sprache moduliert wird.
Mehr noch als im deutschen Sprachraum, in dem die musikalische Rhetorik einen wichtigen Platz einnimmt,3 wird vom französischen Komponisten verlangt, mit den Regeln der musikalischen Kunst dieselben Gedanken und Gefühle wie ein Redner auszudrücken.
Sprachtheoretische Grundlagen
Das dazu nötige Handwerkszeug findet sich in den Grammatiken, die Silbenlänge (Quantität) und Akzent des Französischen erklären,1 sowie in den Texten zur Rhetorik, die Fragen der rhythmischen Gestaltung, Atmung und Stimmgebung behandeln.2 Die Autoren unterscheiden dabei noch nicht zwischen Vokal- und Silbenlänge. Gemäß der Prämisse, dass ein Konsonant allein nicht klingen – und damit keine Zeit beanspruchen – kann, resultiert die Silbenlänge automatisch aus der Vokallänge (vgl. Fournier, 2007). Ein wichtiger Moment ist die Definition des Akzents als einem zu zwei sprachlichen Disziplinen gehörenden Phänomen: Antoine ArnauldArnauld, Antoine und Claude LancelotLancelot, Claude unterscheiden in der Grammaire générale et raisonnée (1660: 17) einen dem Bereich der Grammatik angehörenden Akzent (ein fester Wortakzent, „naturel, & de grammaire“) von dem rhetorischen Akzent (ein flexibler, dem Ausdruck dienender Akzent, „de Rhetorique“, vgl. Kapitel 6). Das unterschiedliche Zusammenspiel dieser beiden Akzente charakterisiert die verschiedenen Sprachen.
Zwei Jahre später formulieren Antoine ArnauldArnauld, Antoine und Pierre Nicole in der Logique ou L’art de penser von 1662 die Rolle der Stimme, der Gestik und der Mimik für das Verständnis und den Ausdruck eines Satzes.3 Damit nähern sich die beiden Disziplinen, Grammatik und Rhetorik, einander an.
Читать дальше