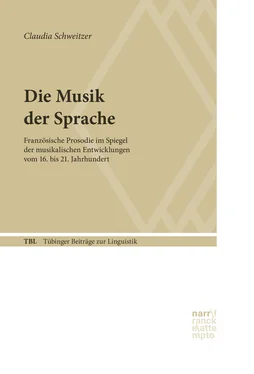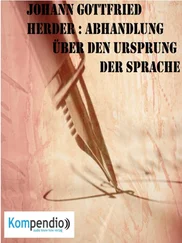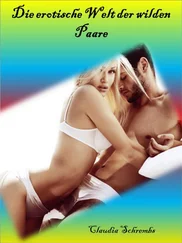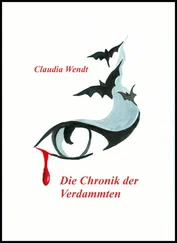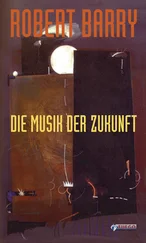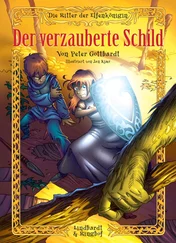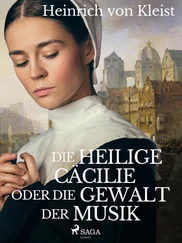Pierre-Paul DorfeuilleDorfeuille, Pierre-Paul Gobet, dit (1799/1800: 9) rät dem zukünftigen Akteur „d’observer la scène du monde“. Diese Weltbühne stellt für den Lernbegierigen die beste Schule der Passionen und des menschlichen Herzens dar. Ihr Studium kann ihm helfen, zu lernen, wie er dem Publikum gefallen und, vor allem, dessen Herz zum Klingen bringen kann.
2.5 Die Romantik: Traumwelten und wissenschaftliche Genauigkeit
Trennung von Kunst und Wissenschaft
Mit Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelt sich eine neue Kunstästhetik. Die Schreckensherrschaft Robespierres und die Napoleonischen Kriege veranlassen die Romantiker, die die gewaltigen politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen der Aufklärung anlasten, zu einer heftigen Kritik an der vernunftbetonten Welt ihrer Vorfahren. Naturbegeisterung und Faszination für das Irrationale und Fremde, aber auch Vergangene, kennzeichnen die Künstler. Die das Herz ansprechenden Künste und die die Vernunft proklamierenden Wissenschaften gehen fortan getrennte Wege.
Eine der Folgen dieser Trennung ist zunächst eine ästhetische Aufwertung der Künste, die für viele Romantiker beinahe ein Religionsersatz, ein Zufluchtsort vor der ernüchternden Gegenwart, wird. Der Künstler wird zum ausführenden Organ seines Genies: Ihm obliegt es, das Schöne im Kunstwerk spürbar zu machen. Die Musik wird im Rahmen der Schönen Künste in einem Atemzug mit Poesie, bildender Kunst und Architektur behandelt:
Schön im Kunstwerk ist nur, was der Künstler darin hineinlegt. Es ist das eigentliche Ergebnis seiner Anstrengung und die Bestätigung seines Erfolgs. Wann immer ein von einem beliebigen – körperlichen, seelischen oder geistigen – Eindruck zutiefst getroffener Künstler diesen Eindruck mithilfe eines beliebigen Verfahrens – Gedicht, Musik, Statue, Gemälde, Gebäude – so zum Ausdruck bringt, dass er in die Seele des Betrachters oder des Hörers dringt, ist das Kunstwerk schön, und zwar nach Maßgabe der Intelligenz, die es voraussetzt, der Tiefe des Eindrucks, den es ausdrückt, und der Ausdruckskraft, die ihm vermittelt wird. Das Zusammentreffen dieser Bedingungen bildet den vollständigen Ausdruck des Schönen. (VéronVéron, Eugène, 1878 [2010])
Die Begabung oder das „Genie“ für die musikalische Komposition definiert der Komponist Anton ReichaReicha, Antoine (1814:1) mit vier Eigenschaften:
1 Eine große Kunstleidenschaft (das heißt, die Leidenschaft für die Musik),
2 Das Bedürfnis zu schaffen, und das Geschaffene zu präsentieren,
3 Die Begabung, Ideen zu konzipieren und auszuführen, und
4 Eine ausgeprägte Sensibilität und Urteilskraft für die (musikalische) Kunst.
Diese Eigenschaften sind naturgegeben und können nicht durch das Studium von Lehrwerken der Poetik, Rhetorik oder Komposition ersetzt werden, die allerdings unentbehrlich sind, um das vorhandene Talent zu entwickeln.
Die Ausdruckskraft der Melodie
Poetik, Rhetorik und Musik werden hier in einem Atemzug genannt und Anton ReichaReicha, Antoine (1814) empfiehlt das Studium seines Werkes ausdrücklich allen lyrischen Poeten, um zu begreifen, dass der Rhythmus das die Poesie und die Musik verbindende Element bildet. Der poetische Rhythmus des Textes ist nunmehr der Melodie übergeordnet.1 Damit rückt auch die ausdrucksstarke und empfindsame Melodiebildung ins Zentrum der Überlegungen und ReichaReicha, Antoine zeigt sich verwundert, dass diese bislang so wenig studiert worden sei.2
Charles Darwin führt die Überlegungen RousseauRousseau, Jean-Jacquess zu einer ursprünglichen Verbindung von Sprache und Gesang weiter aus und erklärt nicht nur, dass „musikalische Laute eine der Grundlagen für die Entwicklung der Sprache abgeben“ (Darwin, 1875: 317), sondern unterstreicht auch die Nähe der melodischen Ausdruckskraft von Sprech-und Gesangsstimme:
Der leidenschaftliche Redner, Barde3 oder Musiker hat, wenn er mit seinen abwechselnden Tönen und Cadenzen4 die stärksten Gemüthserregungen in seinen Hörern erregt, wohl kaum eine Ahnung davon, dass er dieselben Mittel benutzt, durch welche in einer äußerst entfernt zurückliegenden Periode seine halbmenschlichen Vorfahren ineinander die glühenden Leidenschaften während ihrer gegenseitigen Bewerbung und Rivalität erregten. (Darwin, 1875: 318)
Die Rolle der den Gesang imitierenden Sprechstimme wird hier deutlich hervorgehoben: Die Musik der Sprache übermittelt einen Sinn.
In diesem Zusammenhang gewinnt die Einteilung und Gestaltung der Phrasen in der Musik einen wichtigen Platz. Poeten und Grammatiker beobachten für verschiedene Satzzeichen bestimmte melodische Schlussfloskeln und Pausenlängen, und bei den Musikern bildet die Phrasierungskunst ein nunmehr wichtiges Studienobjekt. Schauspieler, Schauspielerinnen, Sänger und Sängerinnen müssen lernen, ihre Atmung genau der Struktur der Komposition anzupassen und immer genügend Luft zur Verfügung zu haben, um die jeweilige Phrase bis zum Ende gut gestalten zu können (vgl. Bsp. 17).
Louis DubrocaDubroca, Louis (1802: 321) unterscheidet generell die repos de la respiration (die Atempausen) von den repos des objets (den inhaltsbestimmten Pausen). Vor allem die zweite Kategorie kann studiert und systematisiert werden. Das Komma erlaubt nur eine fast unmerkliche Atempause und markiert einen kleinen Abschnitt im Verlauf des Satzes. Vor dem Semikolon markiert die Stimme einen leichten melodischen Abfall und die anschließende Pause muss sehr kurz sein. Melodieabfall und Pause sind ausgeprägter für den Doppelpunkt und extrem deutlich nach dem Punkt (1802: 322–325).
Die musikalische Konnotation ist noch deutlicher bei Louis Becq de Fouquères:
Die vollkommene Kadenz entspricht einer Rückkehr der Stimme zum Grundton der Tonleiter und man findet sie im Allgemeinen am Ende eines Satzes. Für Ohr und Verstand bildet sie eine endgültige Ruhepause. Die Rückkehr der Stimme zu einem mit dem Grundton harmonischen Ton der Tonleiter wird als unvollkommene Kadenz bezeichnet. Sie steht am Ende von Satzteilen und bedeutet für Ohr und Geist eine relative Ruhepause. (Becq de Fouquères, 1881)1
Das musikalische Vokabular ist mehr als eindeutig (und erschwert heutigen, musiktheoretisch vielleicht weniger gebildeten Lesern und Leserinnen beinahe die Lektüre):
Der Grundton der Tonleiter ist der für die Tonart namengebende Ton („C“ in „C-Dur“, usw.).
Die vollkommene Kadenz besteht in der Harmonielehre aus der Akkordfolge Dominante und Tonika. Die Tonika, das heißt die Grundtonart des Stückes, erscheint dabei mit dem Grundton in der Melodiestimme.
Die unvollkommene Kadenz besteht ebenfalls aus der Akkordfolge Dominante und Tonika, allerdings endet die Melodie nicht auf dem Grundton, sondern auf einem der anderen Töne des Tonikaakkords.
Die zum Grundton harmonischen Töne entsprechen den Tönen des Grundakkords (der Tonika) des Stückes.
Wenn man die musikalische Terminologie in eine leichter verständliche Sprache übersetzen möchte, so könnte die obige Passage wie folgt lauten (vgl. auch Bsp. 18):
Die für das Satzende typische Tonlage erlaubt der Stimme eine vollkommene Entspannung. Der Hörer (oder die Hörerin) versteht dadurch, dass der Satz hier zu Ende ist. Die für das Ende eines Satzabschnitts typische Tonlage erlaubt der Stimme zwar keine vollkommene, aber doch eine relative Entspannung. Der Hörer (oder die Hörerin) versteht dadurch, dass der Satz hier noch nicht zu Ende ist.
Wissenschaft und die „Lehre vom Schönen“
Auf Seiten der Wissenschaft nimmt die Erforschung der Töne ebenfalls eine wichtige Rolle ein. In seiner Lehre von den Tonempfindungen (1863) sucht Hermann von Helmholtz (1821–1894) eine wissenschaftliche Begründung für das Wesen des „Schönen“ in einer dem Hörer und der Hörerin unbewussten realen Vernunftmäßigkeit (das heißt konkret, die Rolle der Frequenzen und verschiedenen Obertöne).
Читать дальше