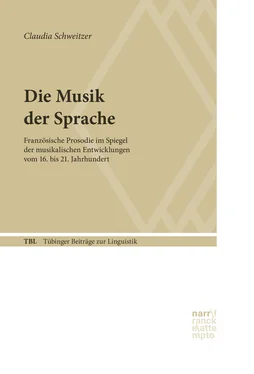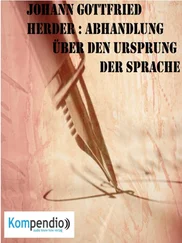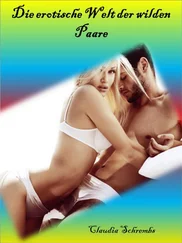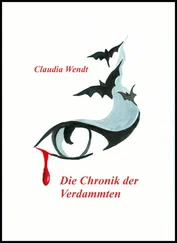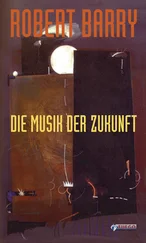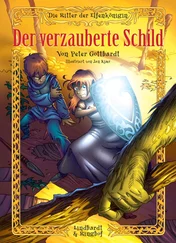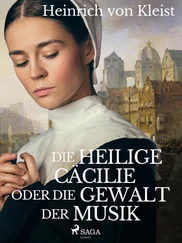Claudia Schweitzer - Die Musik der Sprache
Здесь есть возможность читать онлайн «Claudia Schweitzer - Die Musik der Sprache» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Die Musik der Sprache
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Die Musik der Sprache: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Die Musik der Sprache»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Dieser Band zeigt erstmals, wie in Frankreich seit dem 16. Jahrhundert prosodisches Wissen konstruiert wurde und welche Rolle dabei die Musik spielt. Die aufgezeigten theoretischen Grundlagen werden durch konkrete Beispiele verschiedener Jahrhunderte und Disziplinen (Linguistik, Poesie, Musik) verdeutlicht.
Die Musik der Sprache — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Die Musik der Sprache», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Die zur Studie der durch die Stimme ausgedrückten Emotion untersuchten Parameter entsprechen – wieder einmal – der „Musik der Sprache“, und der gewählte Ansatz erhält eine sinnvolle Begründung durch die Arbeiten im Bereich der Kognitionswissenschaft. Laut Brück et al. (2013: 265-266) scheint die Verarbeitung der emotionalen Prosodie im Gehirn einen doppelten Weg von der Signalaufnahme bis zur Verhaltenskontrolle einzuschlagen: Die explizite Sprachverarbeitung erfolgt in den frontalen Hirnregionen in drei Schritten, von denen jeder eine spezifische Aufmerksamkeitsfokussierung erfordert:
1 Die spezifischen akustischen Merkmale der emotionalen Prosodie werden herausgefiltert,
2 Die emotionalen Inhalte werden durch die Integration prosodischer Informationen der analysierten Aussage und anderer Kommunikationskanäle sowie durch Abgleich mit Assoziationen kompatibler Gedächtnisinhalte identifiziert,
3 Art und Ausprägung verschiedener, im analysierten Signal enthaltener Emotionen werden evaluiert.
Gleichzeitig werden die impliziten Signale auf einem schnelleren Weg, der Induktion emotionaler Reaktionen, in den limbischen und paralimbischen zerebralen Strukturen verarbeitet. Eine forcierte, den expliziten Sprachinhalten gewidmete Aufmerksamkeit kann allerdings die limbischen, emotionalen Strukturen hemmen „und somit zu einer Unterdrückung impliziter Verarbeitungsprozesse führen“ (Brück et al., 2013: 266). In diesem Zusammenhang ist interessant, dass das limbische System, das die impliziten Signale der emotionalen Prosodie verarbeitet, in besonderer Weise durch Musik angeregt wird. Wie Emmanuel BigandBigand, Emmanuel und Suzanne Filipic (2008) zeigen konnten, erfolgen die kognitiven Reaktionen, die emotionellen Antworten auf musikalische Ereignisse entsprechen, normalerweise unverzüglich, von der ersten Hunderstelsekunde der Wahrnehmung an, und dies bei musikalisch gebildeten oder unbedarften Versuchspersonen sowie für bekannte oder unbekannte musikalische Werke gleichermaßen.4 Die These, dass wir auf die Intonation der Sprechstimme wie auf eine fröhliche, traurige, melancholische oder anregende Melodie reagieren, und dass damit Melodien oder Intonationskurven stilisiert werden können, die automatisch und unbewusst bestimmten Emotionen zugeordnet werden, ist von Forschern wie Iván FónagyFónagy, Ivan untersucht worden.
1.3 Notation von Prosodie und Musik
Stilisierte Intonationskurven wie die oben von Bänzinger et al. angesprochenen, werden heute in Form von Diagrammen dargestellt. Bei diesen Autoren sind die beiden Diagrammachsen den Parametern Tonhöhe (y-Achse) und zeitlicher Verlauf (x-Achse) zugeordnet. Die einzelnen Punktwerte sind mit einer durchgängigen Linie derart verbunden, dass eine Kurve entsteht, die an eine melodische, in einer Partitur notierte melodische Linienführung erinnert (in der man sich ebenfalls die Notenköpfe durch eine Linie verbunden vorstellt), und in der die fünf Notenlinien vertikal den Tonhöhen entsprechen und horizontal den zeitlichen Verlauf wiedergeben. Dies ist nicht etwa ein ausschließlich auf moderne Gewohnheiten zurückgehender Eindruck eines Betrachters oder einer Betrachterin des 21. Jahrhunderts: Die Möglichkeiten der musikalischen Notation faszinierten die französischen Sprachtheoretiker bereits seit Langem. Besonders in den Bereichen Intonation und Melodie bildete die musikalische Partitur jahrhundertelang ein dankbares Medium für die Visualisierung von Höreindrücken, deren Vorteil zweifellos war, dass ein großer Teil der Bevölkerung (zumindest derjenige, der auch in der Lage war, Grammatiken und phonetische Texte zu lesen) sie beherrschte und zu entziffern verstand. Heutige Leser, Leserinnen, Forschern und Forscherinnen sind hier gegenüber den Zeitgenossen und Zeitgenossinnen der Autoren vergangener Jahrhunderte im Nachteil: Die jeweils gewählte Darstellung erschließt sich oft nur dann vollständig, wenn man die Notationsgewohnheiten der jeweiligen musikalischen Epoche und die dort vorherrschende Musikästhetik gut kennt.
Verwendung einer traditionellen Partitur
Zum Thema Intonation können zwei Notationsstränge unterschieden werden. Der Erste verwendet eine tatsächliche Partitur mit fünf Notenlinien, Noten mit Köpfen und Hälsen (oder notenähnlichen Figuren), sowie mit einem Notenschlüssel. Letzterer ermöglicht durch die Angabe realer Bezugstöne die Bestimmung der jeweiligen Tonhöhe und der Stimmlage der sprechenden Person.1 Rhythmische Details sind dabei, je nach Autor, mehr oder weniger relevant.
Ein bekanntes Beispiel für diesen Typ bilden – für das Französische – die Transkriptionen von Iván FónagyFónagy, Ivan und Klara MagdicsMagdics, Klara (1963). Tonhöhen und –dauer sind hier so in einem traditionellen Notensystem notiert, dass ein direkter melodischer Vergleich von Sprache und Vokalmusik möglich wird. Jeder Silbe entspricht eine genau festgelegte Note. Die gewählten Notenwerte (hauptsächlich Achtel und Sechzehntel) entsprechen nach dem heutigen Code einem schnellen Grundtempo. Dieses Tempo ist zu Beginn des Notenbeispiels durch eine Metronomangabe genau spezifiziert. Akzentzeichen ( > ) markieren die hervorgehobenen Silben (vgl. Bsp. 2).
Die Notationsmethode von Félix KahnKahn, Félix übernimmt Elemente, wie sie die Komponisten zeitgenössischer Musik vorsehen, um die gewünschten Details so genau wie möglich unter Beibehaltung der grundsätzlichen Elemente des traditionellen Notensystems zu notieren (vgl. Bsp. 3). KahnKahn, Félix verwendet ein System mit fünf Linien, verzichtet aber auf einen Notenschlüssel. Jeder Silbe des zunächst in normaler Orthographie sowie in einer zweiten Reihe in Lautschrift notierten Textes sind ein oder, bei Bedarf, mehrere notenkopfähnliche schwarz ausgefüllte Kreise zugeordnet. Die unterschiedliche Größe dieser Kreise gibt eine minimale Längung (großer Kreis) oder Kürzung (kleiner Kreis) im Verhältnis zur mittleren Dauer eines Klanges (mittlerer Kreis, wie eine gewöhnliche Viertelnote) an. Ein + (höher) oder ein – (tiefer) Zeichen vor der Note dient zur Angabe der Tonhöhe in Vierteltongenauigkeit.2 Die notierte Tonhöhe entspricht so genau wie möglich der reellen Frequenz des Vokals zum Zeitpunkt seiner höchsten Intensität.3
Auch wenn die musikalischen Beispiele, die Louis MeigretMeigret, Louis in seiner Grammatik von 1530 wählt (vgl. Bsp. 4), scheinbar eine analoge Lesart erlauben, so haben doch verschiedene neuere Studien gezeigt, dass sich die von ihm gewählte Notationsform nur auf der Basis der in der Renaissance üblichen Notation musikalischer Werke verstehen lässt.4 Nur zwei Tonhöhen alternieren in jedem Beispiel. Die jeweils höhere Note wird heute unterschiedlich entweder als melodischer Akzent interpretiert (eine Lesart, die dem Notenbeispiel eine direkte visuelle Abbildungskraft zuspricht), oder aber, globaler, als Akzent, der durch verschiedene Parameter (Tonhöhe, -dauer und Intensität) realisiert werden kann. Die den späteren Taktstrichen entsprechenden Längsbalken in den Notenbeispielen MeigretMeigret, Louiss zeigen bei dem Grammatiker noch keine metrischen Betonungsmuster an, sondern teilen den unterlegten Text in grammatikalische Einheiten (wie „Les Constantineopoliteins“, „en sa conservation“). Die verschiedenen gewählten Schlüssel bringen möglicherweise durch eine abweichende Grundtonhöhe einen emotionalen Hintergrund zum Ausdruck und haben damit eine semantische Funktion (Schweitzer, 2022).
Wenn die kleinen (schnellen) Notenwerte bei Ivan FónagyFónagy, Ivan und Klara MagdicsMagdics, Klara – und auch per Assoziation an die Viertelnote bei Félix KahnKahn, Félix – für heutige Leser und Leserinnen ein schnelles Tempo assoziieren, so ist dies bei dem (einzigen), von MeigretMeigret, Louis gewählten Wert, die der heutigen Halben Note ähnelnden Minima, nicht unbedingt der Fall. Die Renaissance verwendet als Basis die sogenannte notation blanche , das heißt weiße, nicht geschwärzte Notenköpfe (vgl. Bsp. 5). Von ca. 1485 bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts ist die Semibrevis der rhythmische Bezugswert. Wenn sie im Aussehen auch an unsere heutige Ganze Note erinnert, so entspricht das mit ihr verbundene Tempogefühl eher dem einer Viertelnote. Die Minima (die im Aussehen an die heutige Halbe Note erinnert) ist damit bereits ein schneller Notenwert (und vergleichbar mit der Achtelnote in moderner Notation).5 Der Blick in die 42 den Amours von Pierre de RonsardRonsard, Pierre de in den Ausgaben von 1552 und 1553 angefügten Vertonungen verschiedener Komponisten6 zeigt, dass trotz der selbstverständlichen Verwendung verschiedener Notenwerte in allen Kompositionen die Minima oder Halbe Note als Basisnotenwert für das Gerüst gewählt ist. Semiminima (Viertel) entsprechen kurzen ornamentalen Melismen, und Semibrevis (Ganze Noten) Kadenzen und Zielnoten. MeigretMeigret, Louis verwendet hier denselben „Notationscode“ wie die Komponisten, die mit den Autoren der im Jahre 1570 gegründeten Académie de poésie et de musique zusammenarbeiteten (vgl. Bsp. 6).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Die Musik der Sprache»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Die Musik der Sprache» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Die Musik der Sprache» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.