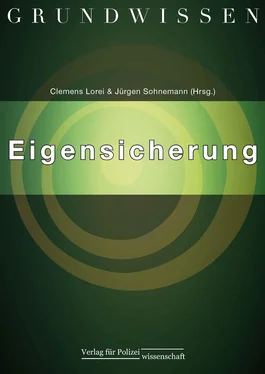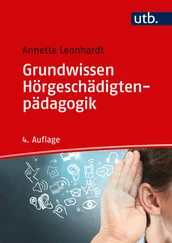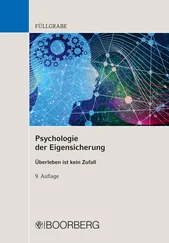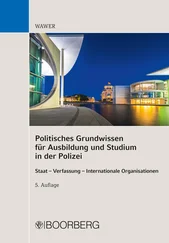„Entschleunigung“ der Kommunikation durch bewusste Temporeduzierung
Einsatzlagen sind häufig geprägt durch hektisches Sprechen der Personen am Einsatzort. Diese Hektik überträgt sich auch auf das eigene Einsatzhandeln. Dieser Dynamik kann mit einer bewussten Reduzierung der Sprechgeschwindigkeit entgegengewirkt werden. Die bewusste Reduzierung der Sprechgeschwindigkeit wirkt sich positiv auf die eigene Denkzeit aus und verhindert bzw. reduziert eigene Verhaltensfehler. Möglich ist dies jedoch nur in Einsastzlagen, die es möglich machen, diese Technik anzuwenden.
Teamarbeit
Eine gute Arbeit im Team am Einsatzort ist eine grundlegende Voraussetzung, um Stressbelastungen aufgrund der Informationsfülle von Einsätzen entgegen wirken zu können. In der Teamarbeit besteht die Möglichkeit, Ressourcen zu schonen und sich kurz aus der direkten Interaktion mit dem polizeilichen Gegenüber zurückzuziehen, um neue Energie zu sammeln. (Wechsel der Positionen im Team). Eine klare Aufgabenteilung im Team kann auch unter widrigen Umständen helfen, den Stresseinfluss zu begrenzen. Problematisch bleibt hier anzumerken, dass aufgrund der veränderten Schichtmodelle klare Teamstrukturen verloren gehen können, die für Einsatzsituationen eine große Bedeutung haben. Die individuelle Planbarkeit eines bedarfsorientierten Schichtmodells ist auf der anderen Seite wieder positiv für die Begrenzung der belastenden Alltagseinflüsse zu bewerten. Somit findet grundsätzlich ein Austausch von Belastungen statt und vermutete Nachteile können eventuell wieder ausgeglichen werden.
Kurzfristige wie langfristige Schutzfaktoren Vor- und Nachbereitung von Einsätzen
Die Vor- und Nachbereitung von Einsätzen ist fester Bestandteil im Leitfaden 371, besser bekannt als das Einsatzmodell. Die Vor- und Nachbereitung ist vergleichbar mit der Planung der eigenen Urlaubsreise. (Urlaubsvorbereitung, Urlaub genießen und die Nachbereitung des Aufenthaltes wie Bilder entwickeln lassen etc.). Die detaillierte Vor- und Nachbereitung würde zu einer Erleichterung und Entlastung in der Einsatzbewältigung führen, auch wenn sich die Lage anders entwickelt. Zum Dienstbeginn und Dienstende wäre es von Vorteil, wenn Polizeibeamte ein festes Ritual entwickeln würden. Somit ist gewährleistet, dass alle Maßnahmen auch bei Stress optimal ablaufen. Die Fahrt zum Einsatzort ist ein guter Zeitraum, in dem man den zu erwartenden Einsatz besprechen kann. Dabei sollten Polizeibeamte auch ihrem „Können“ und der eigenen „Intuition“ vertrauen. Nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz. Werden Einsätze gut nachbereitet, sind Polizeibeamte für den nächsten Einsatz gut vorbereitet. Auch das mildert die Einsatzbelastung und stärkt die eigene Wahrnehmung für das eigene Können. Die Vor- und Nachbereitung von Einsätzen kann bereits dem Coping zugeordnet werden.
Coping (englisch to Cope with = bewältigen, überwinden, kämpfen mit)
Der Begriff Coping wurde durch Lazarus (1981) geprägt und bedeutet so viel wie die Bewältigung von Stress. 10Er hat dabei zwischen dem problemorientierten und emotionsorientierten Coping unterschieden. Als dritte Möglichkeit ist auch das bewertungsorientierte Coping in diese Betrachtung einzubeziehen.
Beim problemorientierten Coping zielt das gesamte Verhalten auf die meist zukünftige Lösung eines Problems. Bei Einsätzen beispielsweise versuchen die eingesetzten Beamten, möglichst viele Informationen zu generieren. Somit können sie problemorientierter Sachverhalte betrachten und auch die Eigensicherung veränderten Situation anpassen. Ähnliche Einsätze sind in der Zukunft durch die entwickelten Lösungsmöglichkeiten besser zu bewältigen. Dies wird im Polizeiberuf bei Einsätzen täglich durchgeführt und schult die eigene Wahrnehmung von Gefahrensituationen.
Das emotionsorientierte Coping beinhaltet die Linderung von Belastungssymptomen. Durch Selbstgespräche und Kanalisierungen durch Ablenkungen sollen Lösungsstrategien entwickelt werden. Weiterhin kann man selber Spannungen reduzieren, beispielsweise durch Rauchen, Essen & Trinken oder Sport. Die Verdrängung von Problemen und der Wunschgedanke, dass alles gut werden wird, werden ebenfalls hierunter zusammengefasst. Das problem- und emotionsorientierte Coping kann auch immer zusammen stattfinden und baut nicht aufeinander auf.
Das bewertungsorientierte Coping ist die Konsequenz aus der primären und sekundären Bewertung der Belastung. Durch die ständige Interaktion zwischen der primären und sekundären Bewertung wird im Idealfall die Belastung eher als Herausforderung denn als Belastung angesehen. (Reininger, Gorzka, 2011)
Langfristige Schutzfaktoren Rationalisierung
Belastende Ereignisse (schwere Verkehrsunfälle, Tote, Schwerverletzte) lassen sich mit der nötigen Berufserfahrung „aus einer gewissen „professionellen Distanz“…“ (Krampl, 2007, S. 14) betrachten, um die eigene Anteilnahme und das eigene emotionale Miterleben in Grenzen zu halten. Die Gefahr bei der Rationalisierung besteht in der Verdrängung persönlicher Belastungen, die im Einsatz erlebt worden sind. Die nötige emotionale Distanz von der Verdrängung zu differenzieren, ist für persönlich betroffene Kollegen und Kolleginnen häufig nicht so leicht. Es sollten daher nach Einsatzende weitere Nachbesprechungen und Hilfsangebote wahrgenommen werden. Hierbei sind die polizeilichen Beratungsstellen nicht außer Acht zu lassen. Ihre Wichtigkeit und Kompetenz gewinnt bei den Dienststellen und Polizeibeamten immer mehr Akzeptanz und Bedeutung. Wo Polizeibeamte sich früher eher als „schwach, unzulänglich und nicht belastbar gesehen haben, nehmen heute immer mehr Beamte die Hilfs- und Präventionsangebote in Anspruch. Das Thema der dienstlichen Belastung ist kein Tabu-Thema mehr.
Eigene Kompetenzerwartung und Erfahrung durch Einsatz und Training
Die Bewältigung unterschiedlicher Einsätze und den daraus resultierenden Erfahrungen führt zu einem positiven Selbstbild. Es entwickelt sich ein positives Selbstverständnis und der Eindruck, mit belastenden Situationen gut umgehen zu können. Zusätzlich wächst auch das Vertrauen zu Kollegen und den vorhandenen Einsatzmitteln, wie beispielsweise die Schutzweste, die nicht nur in Nachtschichten getragen werden sollte. Auch ein gutes theoretisches Grundlagenwissen hilft, Kompetenzen schneller zu entwickeln und diese auch nach außen auszustrahlen. Des Weiteren ist vorbereitendes Training in objektiver und subjektiver Hinsicht von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung der Handlungskompetenz
Kompetenzgewinn durch Training
Schulungen und Fortbildungen bieten die Grundlage und das Fundament für jedes Einsatzhandeln. Es kommt zur Ausbildung von Kompetenzen und Handlungsalternativen, die im Realeinsatz benötigt und nicht erst herausgebildet werden können. Es müssen Automatismen in Form von grundsätzlichen Grundlagentrainings gelehrt werden, um in einer Einsatzsituation bestehen zu können. Dabei ist der sichere Umgang mit Einsatzmitteln und das Bewusstsein der Einsetzbarkeit unter Stress ein wichtiges vorbereitendes Element, um auch Einsätze unter Stress bewältigen zu können. Hier sollten folgende Unterweisungsmethoden aus der Trainingslehre angewendet werden:
• Vom Leichten zum Schweren
• Vom Bekannten zum Unbekannten
• Vom Einfachen zum Komplexen
Dies zeigen auch die mit Studierenden der Polizeiakademie Niedersachsen durchgeführten Untersuchungen zur Bewältigung von polizeilichen Hochstressphasen, die in meiner Dissertation zum Ausdruck kommen werden. Durch intensive realistisch nachgestellte Szenarien unter Hochstress mit im Vorfeld durchgeführten Grundlagentrainings können implizite Lernprozesse angeregt werden, die auch in Extremsituationen noch eine Handlungskompetenz möglich machen. 11Im Idealfall entsteht eine Handlungsroutine bei der Bewältigung von Extremsituationen (zur Bedeutung gedächtnispsychologischer Grundlagen für die polizeiliche Tätigkeit vgl. auch Heubrock, 2010).
Читать дальше