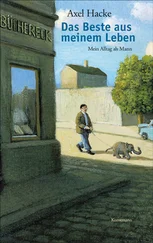„Na gut. Und wann? Wann schlagen wir los?“
„Ich hab das mal ausgerechnet. Wenn unsere Leute mitmachen, dann gehen wir folgendermaßen vor: Jetzt haben wir Mitte Juli, korrekt?“, begann Machmed.
„Korrekt.“
„Dann bereiten wir jetzt alles vor, und ab August wird gebaut. Auf den Grundstücken, die wir gekauft haben, legen wir geheime Waffenlager an.“
„Und wo kriegen wir die Waffen her? Das kriegen die doch spitz, wenn wir hier massenhaft Schusswaffen kaufen.“
„Zhorik hat da einen Kumpel, der würde dir seine eigene Mutter verkaufen, der stellt keine Fragen. Den hauen wir an.“
„Leute gibt’s …“
„Und weil sie solche Idioten sind, haben sie hier nichts zu suchen. Wir schalten sie aus … Jetzt hab ich den Faden verloren, Mann … Ab Herbst holen wir uns dann neue Leute aus der alten Heimat. Mit den Bauarbeiten müssen wir uns nicht groß aufhalten, die sind ja nur zur Tarnung.“
„Logisch.“
„Mehr ist es nicht. Und die Macht übernehmen wir, wenn die Leute hier so abhängen, dass sie auf alles scheißen.“
„Wann wäre das?“
„Neujahr. Am 1. Januar gegen fünf Uhr morgens schwärmen wir in kleinen Einheiten zu den wichtigsten strategischen Punkten aus.“
„Eine echte Revolte!“ Raschid war vor Freude ganz aus dem Häuschen.
„Genau. Stück für Stück geht die Macht in der Stadt auf uns über. Hast du mal ausgerechnet, wie viele bewaffnete Männer man braucht, um am 1. Januar morgens den Bahnhof zu besetzen? Ganze fünf! Wir entwaffnen die Polizei und die Wachleute, und schon gehört der Bahnhof uns. So machen wir es auch mit den Busbahnhöfen, der Stadtverwaltung und so weiter. Aber als erstes sind die Netze dran. Eine Stunde vor der großen Attacke besetzen wir die Büros der Mobilfunkanbieter und kappen das Festnetz. Am ersten Januar früh merkt keiner, dass die Stadt uns gehört. Und diejenigen, die es merken, können sich nicht wehren.“
„Zuerst das Internet! Wenn du diesen Ukrainern das Internet abschaltest, sind sie hilflos wie Katzenbabys.“
„Bist du sicher?“
„Absolut sicher. Kriegst du mit, was bei denen los ist? Die haben sich irgendwie total aufgegeben. Ein paar Kommentare und Likes in den sozialen Netzwerken, das ist alles. Richtigen Widerstand können die nicht leisten. Trenn sie vom Netz, und sie wissen gar nichts mehr mit sich anzufangen. Es lohnt sich für sie nicht mehr, sich zu wehren. Und das nutzen wir aus, mein Lieber.“
„Gut, dann fangen wir mit dem Internet an. Was jetzt? Ich rufe heute noch ein paar von den wichtigen Leuten an, dann setzen wir uns in den nächsten Tagen mal zusammen und besprechen alles.“
„Die Sache läuft, Alter!“
„Na dann: Prost!“
Die Umstürzler erhoben die Gläser mit dem kalt gewordenen Tee und stießen auf den Erfolg ihrer Idee an. Sie leerten ihre Gläser auf ex und knallten sie auf den Tisch.
Es war das erste Warnsignal, das in der juliheißen, erschöpften Stadt natürlich niemand hörte.
Wohnung 14
Gerhard Freis Jugendjahre
Wer Gerhard Frei war, weiß heute niemand mehr. Vor über sechzig Jahren war der Name hier in der Stadt in aller Munde.
Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches kam Frei wie Tausende andere Deutsche als Kriegsgefangener hierher zu uns und musste auf dem Bau arbeiten. Er war kurz vor Berlin gefangengenommen worden. Erst als er von der Kapitulation erfuhr, streckte er die Waffen, und seit er in Gefangenschaft war, verhielt er sich still und fügsam.
Äußerlich wirkte er nicht älter als fünfunddreißig und sah gut aus, deswegen hatte die Frau, die die Gefangenen registrierte und ihnen die Arbeiten zuteilte, ein besonderes Auge auf ihn.
Gerhard Frei saß aufrecht vor ihr und wippte leicht mit dem Stuhl. Ein großer, schlanker Blondschopf. Er lächelte freundlich und schwieg. Nur seine grauen, müden Augen schauten kühl durch die Brille. Die Frau sah ihn an, kurz blieb ihr Blick an dem kindlich blonden Strubbelkopf hängen. Sie musste an Wassyl denken, ihren Mann, der 1941 eingezogen und bei der Befreiung von Kiew als Kanonenfutter geopfert worden war, und seufzte. Ende November hatte man ihr die Gefallenenmeldung überstellt und ihr – pünktlich zum Jahrestag der Oktoberrevolution – zur Einnahme Kiews gratuliert. Für sie war das kein Trost, sie begriff die Symbolkraft und die historische Bedeutung dieser militärischen Operation nicht, vielleicht weil Wassyl wirklich ein Teil von ihr gewesen war, der obere Teil, um genau zu sein. Wassyl hatte sie immer angehalten, Kopf und Herz gleichermaßen zu gebrauchen. Jetzt war Wassyl tot, ein MG-Schütze hatte ihn in den kalten Dnipro befördert, und seitdem fühlte sie sich wie amputiert, als wäre sie nur ein halber Mensch, als fehlte ihr die obere Hälfte. Sie konnte keine Lust mehr empfinden außer auf Essen und auf einen Mann.
„Sag mal, …“ – sie stockte, weil sie den deutschen Namen des Gefangenen nicht so schnell herausbrachte – „Gerhard, warst du vielleicht gerade in Kiew, als unsere Armee die Stadt befreit hat?“
Frei schaute sie noch konzentrierter an. Er konnte kein Ukrainisch, außer „Kiew“ und seinem Namen hatte er nichts verstanden. Er schwieg und überlegte, was sie wohl von ihm wollte. Vorsichtshalber schüttelte er den Kopf.
‚War er also nicht‘, dachte sie und seufzte noch einmal. Dann vertiefte sie sich in seine Papiere.
Die nächsten Minuten vergingen unter dem gleichmäßigen Ticken der Wanduhr und dem Rascheln der Seiten. Plötzlich stutzte die Frau. Als sie den seltsamen Vermerk sah, runzelte sie die Stirn, rieb sie. Zog die Augenbrauen hoch. Blätterte ein paar Seiten zurück, las etwas nach, sprang zum Ende der Unterlagen, dann wieder zum Anfang, presste ihre Finger gegen die pulsierenden Schläfen und las alles noch einmal ganz aufmerksam durch.
Das Ergebnis missfiel ihr, sie schaute Frei verunsichert an. Der Gefangene saß immer noch aufrecht und wippte leicht mit dem Stuhl, um seinen Mund spielte ein feines Lächeln.
„Walera!“ – die Frau nahm das Glöckchen, das neben ihr auf dem Tisch stand – „Walera, kannst du mal kurz kommen?“
Im Nebenraum polterten Schritte, einige Sekunden später wurde die Tür aufgerissen, und Walera, der Übersetzer, kam herein.
„Was gibt‘s, Genossin Mykytenko?“, ratterte er nur halb korrekt, aber in aufrechter Haltung.
„Komm mal her und sieh dir das an“, rief sie und winkte ihn mit einer Hand heran, während sie mit der anderen auf den Stapel Dokumente wies, der vor ihr lag.
Walera beugte sich über den Tisch und starrte auf die Stelle, auf die die Frau getippt hatte. Dann durchforstete er, wie Mykytenko eben, den gesamten Ordner und schaute sie verwirrt an:
„Völlig verrückt. Sicher ein Irrtum oder ein Witz.“
„Jetzt frag ihn doch, Walera, na, mach schon!“
Walera richtete sich auf, und während er vor dem Stuhl, auf dem der Gefangene saß, auf und ab lief, bediente er sich der deutschen Sprache. Allerdings sprach er Frei nicht direkt an, sondern schleuderte die Wörter und Sätze einfach in den Raum:
„Wie heißen Sie?“
„Gerhard Frei.“
„Geburtsort?“
„Köln.“
„Geburtsjahr?“
„1611“, antwortete Frei gelassen und lächelte bissig.
„Bringen Sie da auch nichts durcheinander?“, hakte Walera nach.
„1611“, wiederholte der Gefangene laut und deutlich und räkelte sich, dass seine Gelenke knackten.
„Wissen Sie, welches Jahr wir jetzt haben?“
„Ja, natürlich“, sagte der Deutsche und lächelte weiter.
Walera drehte sich zu seiner Chefin um und sagte:
„Der Deutsche hier behauptet, fast 350 Jahre alt zu sein. Angeblich wurde er Anfang des 17. Jahrhunderts geboren.“ Um seine Worte zu bekräftigen, tippte Walera mit dem Finger auf das Datum, das Genossin Mykytenko stutzig gemacht hatte.
Читать дальше