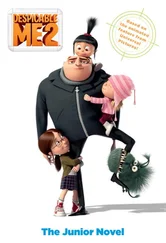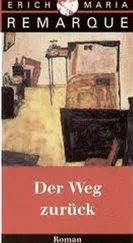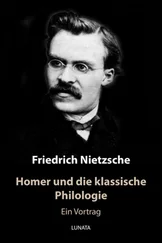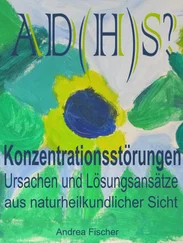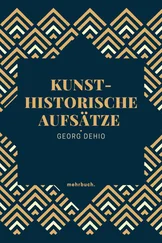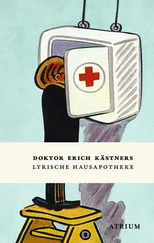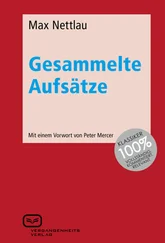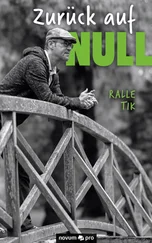… tellus … partimque figuras/rettulit antiquas ( Met . 1, 436);
… se mentitis superos celasse figuris (ib. 5, 326);
sunt quibus in plures ius est transire figuras (ib. 8, 730);
… artificem simulatoremque figurae/Morphea (ib. 11, 634);
ex alias alias reparat natura figuras (ib. 15, 253);
animam … in varias doceo migrare figuras (ib. 15, 172);
lympha figuras/datque capitque novas (ib. 15, 308).
Auch das Bild vom Siegel ist aufs schönste vertreten:
Utque novis facilis signatur cera figuris
Nec manet ut fuerat nec formas servat easdem,
Sed tamen ipsa eadem est … (ib. 15 , 169ss).
Ferner findet sich schon recht deutlich bei ihm figura figura als «Abbild», etwa fast . 9, 278 globusimmensi parva figura poli , oder Her . 14, 97 und Pont . 2, 8, 64; als «Buchstabe», wie schon übrigens bei VarroVarro, ducere consuescat multas manus una figuras ( ars , 3,493); schließlich als Stellung im Liebesspiel: Venerem iungunt per mille figuras . Ars , 2, 679. Überall erscheint bei ihm figura bewegt, wandelbar, vielfältig und zu Täuschung geneigt. Sehr kunstvoll verwendet das Wort auch der Dichter der Astronomica , ManiliusManilius, bei dem figura , außer in den schon erwähnten Bedeutungen, als «Sternbild» und als «Konstellation» (neben signum signum und forma ) erscheint. Als «Traumbild» trifft man es bei LucanLukan und bei StatiusStatius.
Sehr verschieden hiervon, und auch von dem, was uns die RhetorikerRhetorik zeigen werden, ist das Bild bei dem Architekten VitruvVitruv. Bei ihm ist figura figura die architektonische und die plastische Gestalt, allenfalls die Nachbildung davon oder der Grundriß; von Täuschung und Verwandlung ist bei ihm nichts zu spüren, und figurata similitudine , 7, heißt in seiner Sprache keineswegs «durch Vortäuschung», sondern «durch formende Herstellung einer Ähnlichkeit». Oft heißt figura «Grundriß», «Plan» ( modice picta operis futuri figura , 1, 2, 2), und universae figurae species oder auch summa figuratio figuratio ist die Gesamtgestalt eines Gebäudes oder eines Menschen (er vergleicht gern beides unter dem Gesichtspunkt der Symmetrie). Trotz gelegentlicher mathematischer Verwendung hat figura (und auch fingere fingere ) bei ihm und den anderen zeitgenössischen Fachschriftstellern eine sehr fest plastisch-sinnliche Bedeutung; so bei FestusFestus p. 98 crustulum cymbi figura ,14 bei CelsusCelsus venter reddit mollia , figurata (2, 5, 5), bei ColumellaColumella ficos comprimunt in figuram stellarum floscularumque (12, 5, 5). Weit großzügiger geht es auch in dieser Einzelheit bei dem älteren PliniusPlinius (älterer) zu, der ja einer anderen Gesellschafts- und Bildungsschicht angehörte; alle Abstufungen des Gestalt- und Artbegriffs sind vertreten. Ausgezeichnet läßt sich bei ihm, in dem bemerkenswerten Anfang des 35. Buches, wo er den Verfall der Porträtmalerei beklagt, der Übergang von Gestalt zu Porträt beobachten: Imaginum quidem pictura, qua maxime similes in aevum propagantur figurae …, und etwas später, wenn er von den durch Porträts illustrierten Büchern spricht, deren Herstellungstechnik VarroVarro erfunden hatte: imaginum amorem flagrasse quondam testes sunt … et Marcus Varro … insertis … septingentorum illustrium … imaginibus: non passus intercidere figuras, aut vetustatem aevi contra homines valere, inventor muneris etiam diis invidiosi, quando immortalitatem non solum dedit, verum etiam in omnes terras misit, ut praesentes esse ubique credi passent.
Aus der juristischen Literatur des 1. Jahrhunderts sind einige wenige Stellen belegt, die figura figura als «leere äußere Form», ja als «Anschein» zeigen: Dig. 28, 5, 70 non solum figuras sed vim quoque condicionis continere (ProculusProculus) und Dig. 50, 16, 116 Mihi Labeo videtur verborum figuram sequi, Proculus mentem (JavolenusJavolenus).
Das Bedeutendste aber und Folgenreichste, was für die Entwicklung des Wortes im 1. Jahrhundert geschah, war die Ausbildung des rhetorischenRhetorik Figurbegriffes, deren Niederschlag wir im 9. Buch QuintiliansQuintilian besitzen. Die Sache ist älter, sie ist griechisch, und sie war, wie wir oben feststellten, schon von CiceroCicero latinisiert worden; doch CiceroCicero brauchte dafür das Wort figura figura noch nicht, und überdies scheint in der Zwischenzeit die unablässige Diskussion über rhetorische FragenRhetorische Frage die Figuraltechnik noch sehr verfeinert zu haben. Wann für die Sache zuerst das Wort verwendet wurde, ist nicht genau zu bestimmen, wahrscheinlich schon bald nach CiceroCicero, wie sich aus einem bei GelliusGellius 9, 10, 5 erhaltenen Buchtitel ( de figuris sententiarum ) von Annaeus CornutusCornutus, A. und aus den Bemerkungen und Anspielungen bei beiden SenecaSeneca (Philosoph)Seneca (pater)15 und dem jüngeren PliniusPlinius (jüngerer) vermuten läßt. Es lag ja nahe, da der griechische Ausdruck σχῆμασχῆμα war. Man muß überhaupt annehmen, daß der wissenschaftstechnische Gebrauch des Wortes schon früher und reicher entwickelt worden ist, als die erhaltenen Schriften es bezeugen; daß zum Beispiel von den Figuren des SyllogismusSyllogismus (die σχῆματα συλλογισμοῦ stammen von AristotelesAristoteles selbst) im Lateinischen schon weit früher gesprochen wurde als bei BoethiusBoethius oder in dem pseudo-augustinischen Kategorienbuche.
Im letzten Abschnitt des 8. und im 9. Buche der Institutio oratoria also gibt QuintilianQuintilian eine eingehende Darstellung der TropenTropenFiguren- und FigurenlehreFigurenlehre, die einerseits, wie es scheint, eine zusammenfassende Auseinandersetzung mit früheren Meinungen und Arbeiten darstellt, andrerseits für die späteren Bemühungen um den Gegenstand grundlegend wurde. Er scheidet die Tropen von den Figuren; Tropus ist der engere Begriff und bezieht sich nur auf die uneigentliche Bedeutung von Worten und Redewendungen; Figur hingegen ist jede Formung der Rede, die vom gewöhnlichen und nächstliegenden Gebrauch abweicht. Es handelt sich bei der Figur nicht darum, Worte statt anderer Worte zu setzen, wie bei allen TropenTropenFiguren; es lassen sich auch aus Worten in ihrer eigentlichen Bedeutung und Anordnung Figuren bilden. Im Grunde sei jede Rede eine Formung, eine Figur, man brauche das Wort aber nur für poetisch oder rhetorischRhetorik besonders ausgebildete Formungen, und so unterscheide man einfache ( carens figuris , ἀσχματιστόςἀσχματιτός (carens figuris)) und figürliche ( figuratus , ἐσχηματσμένοςἐσχηματισμένος) Redeweisen. Die Unterscheidung zwischen Tropus und Figur gelingt nur mühsam. QuintilianQuintilian selbst schwankt häufig, zu welchem der beiden eine Redeform zu rechnen sei; der spätere Sprachgebrauch hat sich vielfach dafür entschieden, figura figura als den Oberbegriff anzusehen, der den Tropus miteinschließt und also jede uneigentliche oder mittelbare Ausdrucksweise als figürlich zu bezeichnen. Als Tropen nennt und beschreibt er die MetapherMetapher, die SynekdocheSynekdoche ( mucronem pro gladio; puppim pro navi ), die MetonymieMetonymie (Mars für den Krieg, VergilVergil für VergilsVergil Werke), die AntonomasieAntonomasie (der Pelide für Achill) und vieles Ähnliche; die Figuren teilt er in solche, die den Inhalt, und solche, die die Worte betreffen ( figurae sententiarum und verborum figura figurae verborum, figurae sententiarum ). Als figurae sententiarum zählt er auf: die rhetorische FrageRhetorische Frage, mit der dazu selbstgegebenen Antwort; die verschiedenen Arten der Vorwegnahme von Einwänden ( prolepsis Prolepsis ); das scheinbare Ins-Vertrauen-Ziehen der Richter oder Hörer oder sogar des Gegners; die ProsopopöeProsopopöe, in der man andere Personen, etwa den Gegner, oder Personifikationen wie das Vaterland selbst sprechen läßt; die feierliche ApostropheApostrophe; die konkretisierende Ausmalung eines Vorgangs, evidentia evidentia oder illustratio illustratio ; die verschiedenen Formen der IronieIronie; die AposiopeseAposiopese oder obticentia obticentia oder interruptio interruptio , bei der man etwas «hinunterschluckt»; die gespielte Reue über etwas, was man gesagt hat; und vieles in der gleichen Art; vor allem aber diejenige Figur, die man damals als die wichtigste ansah, die den Namen Figur vor allem zu verdienen schien: die versteckte AnspielungAnspielung (versteckte) in ihren verschiedenen Formen. Man hatte eine raffinierte Technik ausgebildet, etwas auszudrücken oder zu insinuieren, ohne es auszusprechen, und zwar natürlich etwas, was aus politischen oder aus taktischen Gründen oder einfach um der größeren Wirkung willen verborgen oder wenigstens unausgesprochen bleiben sollte. QuintilianQuintilian beschreibt, welch große Bedeutung die Übung in dieser Technik in den Rhetorenschulen besaß und daß man eigens Fälle konstruierte, die controversiae figuratae controversiae figuratae , um sich darin zu vervollkommnen und auszuzeichnen. Als Wortfiguren schließlich nennt er absichtliche SoloecismenSoloecismus, rhetorische WiederholungenWiederholung (rhetorisch), AntithesenAntithese, GleichklängeGleichklang, Auslassungen eines Wortes, AsyndetonAsyndeton, KlimaxKlimax und einiges Verwandte.
Читать дальше