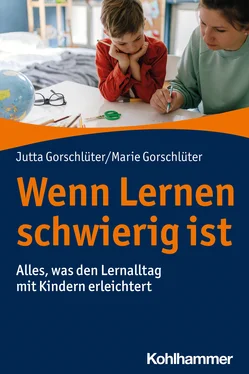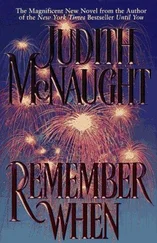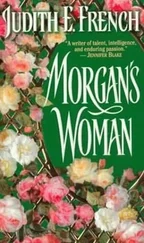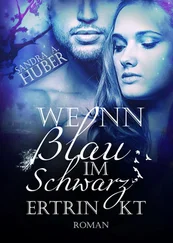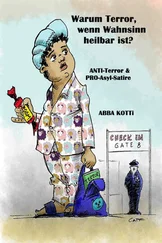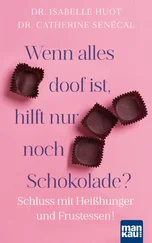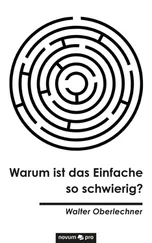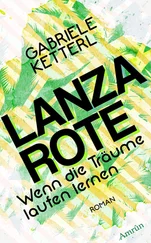Ich wurde als Referentin eingeladen, zum Thema »Wenn Lernen nicht so einfach ist« zu sprechen. Anwesend waren ca. 100 Personen, die alle als Schulsozialpädagogen/innen in der Schuleingangsphase Kinder unterstützen und begleiten. D.h., die Kinder, die von ihnen betreut werden, sind in der Regel zwischen 6 und 8 Jahre alt. Die Veranstalter baten die Teilnehmer, interessante und wichtige Unterlagen oder Materialien aus ihrer Arbeit mitzubringen und diese für alle zugänglich auf einer langen Tischreihe auszulegen.
Das Resultat waren 90 % Arbeitsblätter, Kopiervorlagen, Hefte, Fachliteratur und nur maximal 5–10 % Materialien zum Spielen, Begreifen und Ausprobieren.
Mein Fazit und meine Bitte an die Teilnehmer lautete daher: Bei der nächsten Veranstaltung 90 % spielerisches Material, Dinge zum Begreifen und weniger Arbeitsblätter.
Dazu ein Beispiel: Um die Uhrzeit zu lernen, gibt es zig Arbeitsblätter, in denen Kinder die Zeiger einzeichnen sollen, um so die Uhrzeit zu lernen. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich in den letzten 40 Jahren irgendwo in meinem Alltag Zeiger in Uhren auf dem Papier einzeichnen musste. Spannender wäre es, eine Uhr in der Hand zu haben und damit experimentieren zu lassen, dann Zeiten einzustellen usw. Oder: Jedes Kind der Klasse bringt von Zuhause eine Uhr mit, um gemeinsam die Vielfalt an Uhren zu vergleichen.
Es gibt leider tausende Beispiele, bei denen Arbeitsblätter als eine Art Beschäftigungstherapie eingesetzt werden.
Mein 9-jähriger Schüler kommt aus der Schule und erzählt mir, dass die Lehrerin ihm einen Zettel mitgegeben hat. Auf dem steht: Max beherrscht das Thema Adjektive noch nicht! Aber stimmt das wirklich? Ich äußere den Verdacht, dass er viel mehr über Adjektive weiß, als er glaubt. Er guckt mich erstaunt an. »Und – soll ich es dir beweisen?«, frage ich ihn. Klar will er das und ist sofort voll bei der Sache, als wir beginnen, durch den Raum zu gehen, ich auf einen Gegenstand zeige und jedes Mal frage: Wie ist der Tisch? Wie ist das Sofa? Wie ist die Scheibe? Wie ist das Buch? Max fällt immer was ein. Und ja – es sind Adjektive. Dann tauschen wir die Rollen, denn er soll ja auch noch neue Adjektive hören und ich benutze ausgefallene Adjektive, die ich sehr betone. Wunderschöne Wörter wie: außergewöhnlich, interessant, beeindruckend, und sieh da: etliche tolle Adjektive gelten nicht nur für Gegenstände, sondern auch für ihn: bewegungsfreudig, freundlich, zuvorkommend, interessiert, phantasievoll. Die Hürde, die wir jetzt noch nehmen müssen, ist die, wie wir uns dieses schwierige Wort »Adjektiv« nun merken können. Ich erzähle ihm von einem Lied und singe es ihm vor: (Melodie: Hänschen klein)
Adjektiv – groß und klein,
wie kann eine Sache sein?
breit und schmal, dunkel, hell,
langsam oder schnell!
Adjektiv – groß und klein,
wie kann eine Sache sein?
leicht und schwer, hoch und tief
gerade oder schief.
Plötzlich fällt Max etwas auf: In dem Wort »Adjektiv« ist ja akustisch ein Adjektiv enthalten, nämlich »tief«. Das war selbst mir noch nicht aufgefallen. Zwischendurch hatte ich einen Blick auf die Arbeitsblätter geworfen, um zu sehen, worauf sich die Aussage der Lehrerin bezog. Da ging es um zwei Aspekte: Einmal um Gegensatzpaare und dann um die Steigerung von Adjektiven. Ich nehme zuerst einmal einen Ball und stelle mich Max gegenüber auf. »Ok«, sage ich, »ich fange mal mit dem wichtigen Adjektiv ›tief‹ an. Was würdest du sagen, was passt zu tief?« Max antwortet spontan: »Hoch.« »Aha«, sage ich, »du hast das Gegenteil genannt. Jetzt bist du dran! Nenn mir ein ›Adjektiv‹, und ich sage das Gegenteil.« Dabei fliegt der Ball hin und her. Ich zeige ihm vor jedem Wurf kurz das entsprechende Wort auf dem Arbeitsblatt »Gegensatzpaare« dazu. Adjektive kennt er nun, Gegensatzpaare kennt er. Und nun, die dritte Hürde … kann er Adjektive steigern?
Ich stelle einen Stuhl verkehrt herum an den Tisch, so dass die Lehne den Tisch berührt. »Jetzt möchte ich sehen, ob du Adjektive steigern kannst. Dafür ziehst du am besten deine Schuhe aus und steigst mal auf den Stuhl und dann auf den Tisch.« Da dies schon ungewöhnlich ist, ist Max sofort bereit und wirkt gespannt. Erst auf den Stuhl, dann auf den Tisch und dann darf er auf der anderen Seite herunterspringen. Und dann machen wir das Ganze mit Adjektiven und intuitiv steigert Max die Adjektive, die ich ihm vorsage. Vor dem Stuhl stehend »schnell«, auf dem Stuhl »schneller« und auf dem Tisch »am schnellsten«, und mit Begeisterung springt er vom Tisch und stellt sich erwartungsvoll wieder vor den Stuhl und wartet auf das nächste Adjektiv, das ich ihm nenne. Nach 20 Adjektiven beenden wir das Spiel.

Das Beispiel von Max zeigt, dass eine andere, spielerische und bewegungsreiche Herangehensweise nicht selten der Schlüssel zu einem Lernerfolg ist. Mit etwas Kreativität ließe sich so etwas ebenfalls auf Kleingruppen- oder Klassengrößen übertragen.
Inhaltlich müsste außerdem das Curriculum an den Schulen meines Erachtens deutlich grundsaniert werden, eine Diät zum »Abspecken« wäre hier sicherlich angebracht und sinnvoll und würde mehr Spielraum für andere Lernaktivitäten bieten. Das Abspecken betrifft nicht nur die Arbeitsblätter, sondern auch Begrifflichkeiten. Schauen Sie sich die folgende buntgemischte Liste an! Es sind Begrifflichkeiten oder Handlungsanweisungen, die in den ersten vier Schuljahren an den Grundschulen in Deutschland zum Standard gehören:
Division, Faktor, Addition, Subtraktion, Minuend, Subtrahend, Quersumme, Präteritum, Präsens, Futur, Perfekt, Multiplikation, Artikel, Verben, Anlaute, Sichtwortschatz, Endlaut, Wortgrenze, Adjektiv, konjugieren, Konsonanten, Gegensatzpaare, Nomen, schriftlich rechnen, lautierend lesen, halbschriftlich rechnen, überschlagen, Produkt, mathematische Körper, Subjekt, Prädikat, Objekt, Divisor, Dividend, Differenz, Quotient, Stellenwert, uvm.
Es stellt sich die Frage, wo in unserem Alltag diese Wörter von Bedeutung sind. Muss ich als 9-Jähriger all diese Wörter wirklich wissen? Kann ich mein Leben dann besser meistern? Wie viel Bedeutung messen wir dem bei? Oder haben Sie sich schon mal gefragt, welche schulischen Inhalte, die sie als Kind früher gelernt haben, für ihr heutiges Leben relevant sind und bisher waren? Wäre es nicht ausreichend, in den ersten Schuljahren weitgehend die deutschen Bezeichnungen zu benutzen und erst ab der 5. Klasse Fachausdrücke einzuführen?
Ich telefonierte vor einigen Tagen mit meiner Freundin und erzählte ihr von meiner Einschätzung dieses Themas und dass ich viele dieser Begrifflichkeiten wie »Adjektive«, »Gegensatzpaare« etc. für überflüssig hielte. Als ich endete, lachte sie und sagte: »Sehr interessant, aber ich weiß weder genau was Adjektive sind, noch was das andere Wort bedeutet, von dem du gesprochen hast.«
All dies muss ein lauter Aufruf sein, unser Bildungssystem zu überdenken. Bildung sollte stark machen – aber tut unsere Bildung das? Oder ist sie verschüttet unter einem riesigen Berg von Heften, Arbeitsblättern und alltagsfernen Begrifflichkeiten? Die Rettung naht angeblich in Form der Digitalisierung. Ich zweifle sehr daran. Denkt man an die vielen Schüler, die den Großteil des Tages in der Schule verbringen und lustlos darauf getrimmt werden zu funktionieren, dann kann auch das nicht gut gehen.
Und noch immer gibt es Tausende von Schülern, die jedes Jahr ohne einen Abschluss die Schule verlassen. Das alleine wäre gar nicht so schlimm, würden nicht vielen auch die grundlegenden Fähigkeiten des Lesens und Schreibens am Ende ihrer Schullaufbahn noch fehlen.
Читать дальше