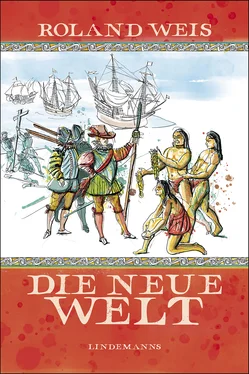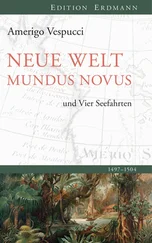Izu machte sich nichts vor. Seine Geisterwelt war eine Schimäre, ein Fantasiegebilde, befüllt mit einem Bestiarium guter, böser, rätselhafter und furchteinflößender Wesen. Bei diesem Baum jedoch bedurfte es keiner Täuschung. Der monströse Urwaldriese wirkte durch seine überragende Mächtigkeit einschüchternd genug. Es konnte gar nicht anders sein: Dieser Urwaldriese musste heilig sein. Dass außer dem Geistermann kein anderer Mensch diesen Baum berühren durfte, war ein Gebot, das Izu eingeführt hatte. Den Menschen konnte er Vorschriften machen. Allen anderen Lebewesen waren seine Spielregeln egal. Droben im Durcheinander des Geästs flatterten unter dem grünen Dach Papageien, kreischten Affen, schimpften Vögel, flatterten Schmetterlinge, dösten Schlangen und Faultiere, lauerten Spinnen, schwirrten Insekten; alle trachteten danach, sich gegenseitig umzubringen und zu fressen, oder sich mit raffinierten Methoden zu begatten.
Dieser Baum wucherte als ein Dschungel für sich.
Izu hielt die Augen geschlossen. Er träumte. Zuvor hatte er tüchtig dem Caapi zugesprochen, einem aus speziellem Rindenextrakt hergestellten Tee. Izu braute ihn selbst, mit einigen unkeuschen Zutaten, nach bewährtem Hausrezept, und natürlich auch heilig und geheim; jedenfalls von brachialer halluzinogener und aphrodisierender Wirkung. Mit Hilfe des Caapi hatte Izu sich im Laufe seines langen Lebens nicht nur herausragende Räusche beschert, er hatte mit ausreichend Caapisaft im Leib auch zahlreiche Stammesgenossinnen geschwängert, ohne je in seiner Manneskraft zu ermüden. Er trank das Gebräu ehe er Beginn und Ende von Überfällen und Raubzügen verkündete und er erhob sich mit diesem Gesöff auch zum Herrn der Träume, zum Geisterflüsterer des Stammes. Die Tupanaki fürchteten und verehrten den alten Izu als ihren Geistermann und Stammesältesten. Wie alt mochte er sein? Er sah aus wie eine tausendjährige Mumie. Die Bewohner des großen Waldes sortierten ihr Leben anhand der Katastrophen, die sie erlebten, und sie zählten die Jahre nach den regelmäßigen Frühjahrsfluten. Izu hatte als Knabe das fürchterliche Sterben des Zinunque-Stammes erlebt, als eine ansteckende Seuche ausgebrochen war; er hatte das Hochwasser gesehen, das die Dörfer Yoni und Xama hinweggerissen hatte. Später dann hatte er den Raub der Frauen von Sima erlebt und den Überfall der Yaomi. Das große Buschfeuer am Berg Taori war das letzte große Ereignis gewesen. Er musste also 52 Großfluten alt sein. Außer ihm hatte bei den Tupanaki niemand mehr Ereignisse erlebt. Also musste Izu der Stammesälteste sein. Das war unwiderlegbar!
Der heilige Baum war Izus Traumplatz. Träume, die der Zaubermann darunter träumte, galten als heilig und sie bargen allesamt geheime Botschaften. Und der Platz bot praktischen Nutzen, weil Izu unter diesem Baum ungestört blieb, mitsamt seinem Caapi-Rausch. Diesmal riss der süße Trank Izu gewaltsam und rücksichtslos in die Traumwelt: Der Zaubermann stürzte in einen strahlend blauen Himmel hinein. Er stieg in einem langen und schwindelerregenden Taumel in unendliche Höhen hinauf. Das Firmament strahlte von einem solch makellosen Blau, dass Izu sich geblendet abwenden musste. Er sah plötzlich unter sich den heiligen Baum. War er ein Vogel? Im Laubdach des Urwaldriesen tropfte die Feuchtigkeit des letzten Regengusses. Leichter Nebel stieg vom Blätterdach auf. Und zu Füßen des Baumes, an den übermächtigen Wurzelauslegern angelehnt, erblickte Izu sich selbst. Der Zaubermann verschmolz mit seiner Traumfigur und betrat deren Traum. Wieder der strahlendblaue Himmel, nicht einmal der Standort der Sonne ließ sich in ihm ausmachen. Die Blätter in der Krone des heiligen Baumes wisperten: „Izu Zaubermann, schau dir den Himmel an! Schau genau! Schau hin. So blau wirst du den Himmel nie wieder sehen. Merke dir gut, wie blau er ist.“
War er so besoffen? So intensiv, so einprägsam, so real hatte er seine Traumbilder noch nie erlebt. Sollte er etwa tatsächlich einen Geistertraum haben? Einen Traum mit Botschaft? Welche? Dass der Himmel blau ist? Izu grunzte und wälzte sich herum. Das Blaubild verschwand.
I. Palos (1492)
Am Rande der Hafenstadt Palos klebte eine traurige Ansammlung armseliger Lehm- und Bretterhütten an einem unfruchtbaren Hang. Wenige Pinien krallten sich an die Erde. Disteln und verdorrtes Gras kämpften zwischen den Behausungen ums Überleben. Hier wohnte der Hirte Rodrigo Sanchez de Palos. Er war 13 Jahre alt. Dass er dieses Alter erreicht hatte, darf man als mittleres Wunder bezeichnen. Seine Mutter hatte bereits versucht, ihn umzubringen, als er noch unschuldig im Mutterleib heranwuchs. Vergebens führte sie sich Gifte aller Art zu und auf allen denkbaren Wegen ein. Der Balg wollte nicht abgehen. So wuchs und gedieh Rodrigo im Mutterleib, obwohl er in dieser Welt nicht willkommen war. Weder der Lebenswandel der Mutter noch die Prügel, welche sie in dieser Zeit bezog, konnten dem Fötus etwas anhaben. Nach der Geburt ließ sie ihn an Ort und Stelle hinter einer Lehmhütte zurück. Ihm den Hals umzudrehen, wagte sie nicht, aber sie vertraute der Sonne – und den Krähen. Doch die feuchte Kuhle, in der das kleine nackte Wesen liegenblieb, erwies sich als guter Platz zum Überleben, weil ihn eine kleine Steinmauer umfriedete, die Schweine und Hunde abhielt. Als der Säugling nach drei Tagen immer noch schrie, trug ihn jemand in jene Spelunke Namens „La Tortuga“, die Schildkröte, in der die Mutter inzwischen schon wieder ihrem Gewerbe nachging. Notgedrungen nahm sie ihn mit in ihre Hütte. Hätte er Arbeit gemacht, wäre er zur Last gefallen, wäre er krank oder ein Schreihals gewesen, dann hätte er keine Überlebenschance gehabt. Aber er war genügsam, hungerte klaglos, wenn er tagelang nicht gefüttert wurde, und verschlang dazwischen alles, was man ihm in den Mund schob. Als Säugling lag er stumm und still. Als Kleinkind versteckte er sich und machte sich so unsichtbar wie möglich. Bereits im Alter von fünf Jahren trug er als Ziegen- und Schweinehirte zum kargen Einkommen bei. Er blieb zäh und unerschütterlich am Leben. Ein immer dreckiges und hungriges Kind. Nie krank. So wuchs Rodrigo Sanchez heran. Inzwischen war er dreizehn Jahre alt und die Sippe hatte sich vergrößert.
Manchmal saß er mit seinen grimmigen Gedanken zuhause auf dem Lehmboden der armseligen Hütte, in der er, die Sippe hatte sich vergrößert, mit seinen Geschwistern zusammen mit der Mutter hauste. Einen gemeinsamen Vater gab es nicht. Niemand wusste genau, wer waren die Erzeuger, nicht einmal die Mutter. Jener Mann, von dem sie sich derzeit verprügeln und bespringen ließ, war ein Säufer.
Die Mutter hielt ihre Schar mit dem Hurenlohn am Leben, den sie sich in den Hafenkneipen verdiente. Ihr Gesicht trug verhärmte Züge, war von Falten gefurcht. Ihre Augen blickten glasig von Suff, Hunger, Elend und Prügel. Der einstmals vorhandene Liebreiz war längst unter Dreck und Verbitterung verschwunden, obwohl sie noch keine dreißig Jahre alt war. Ein knappes Dutzend Schwangerschaften, eine pro Jahr, hatten ihre Hüften breiter werden lassen. Ihre Brüste waren längst nicht mehr so straff wie früher. Die meisten Zähne fehlten bereits, so dass ihr einstmals verheißungsvolles Lächeln mit den Jahren zum zahnlosen Grinsen einer Vettel geworden war. Dass sie überhaupt noch Freier fand, verdankte sie dem Alkohol und der Dunkelheit der Nacht. Beides gute Verbündete, wenn es darum ging, Reize vorzutäuschen. Die andalusischen Schafhirten, Matrosen, Fischer und Hafenarbeiter, zeigten sich nicht wählerisch, wenn sie für wenig Münzen eine Wurst, ein Stück Käse, vorwiegend aber für Wein und Schnaps schnelle Befriedigung zwischen den Schenkeln der Hure Sanchez fanden. Nicht alle dieser Bälger dieser Freier waren so zäh wie Rodrigo. Die meisten taten der Hure und ihren wechselnden Zuhältern den Gefallen und starben im ersten Lebensjahr. Auch der Bastard von diesem Säufer war schon nicht mehr da. Er war nur drei Monate alt geworden. Der Alte hatte das brüllende Wesen im Suff so lange geschüttelt, bis es für immer still blieb.
Читать дальше