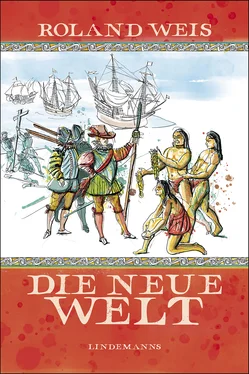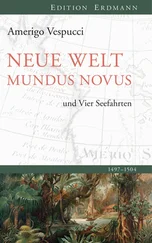Nach und nach lernte Rodrigo alle Besatzungsmitglieder kennen. Ganz im Gegensatz zu diesen beiden Piloten standen die geckenhaft herausgeputzten Zivilisten auf dem Schiff. Diesbezüglich schleppte die Gallega allerhand Ballast mit sich, allen voran das Gespann Escobedo und Gutierrez. Diese beiden, da sie mit dem Dienst an Bord nichts zu schaffen hatten, lümmelten an Deck herum, standen im Wege, schnüffelten den Matrosen hinterher und ernteten durch ihr Schwatzen und Spionieren überall Unwillen. Aber als königliche Beamte des Hofes hatte man ihnen Respekt entgegenzubringen, und man wusste sie mit erheblichen Befugnissen ausgestattet. So hütete die Mannschaft sich geflissentlich vor ihnen.
Weitere Zivilisten an Bord der Gallega waren Rodrigo Sanchez
de Segovia, der königliche Schatzmeister, ein leichengrauer Stubenhocker, zuständig für die Finanzen der Flotte, Louis de Torres, ein Dolmetscher, von dem man flüsterte, er sei ein konvertierter Jude, und Juan Sanchez, der kugelbäuchige Schiffsarzt.
Für Rodrigo, der all diese Besatzungsmitglieder und ihre Eigenheiten schnell zu unterscheiden lernte, folgten einige anstrengende, dennoch unbeschwerte, fast beschwingte Tage. Selten zuvor in seinem Leben hatte er sich so ungebunden gefühlt. Wie weit war Palos doch schon weg? Der Alte – hoffentlich war er im Grab. Seine Brüder Miguel und Pedro, die kleine Schwester Consuela, Mutter, – alle waren in weite Ferne gerückt. Erstmals in seinem Leben fühlte Rodrigo sich frei. Er lebte ohne Ängste in den Tag, ohne Hunger, ohne Prügel, ohne Streit, war nur vom Rhythmus der Arbeit an Bord und vom Wechsel zwischen Tag und Nacht geleitet.
José Pequinos, der dürre Matrose mit dem mürrischen Gesicht eines Maulesels, führte ihn in die Abläufe an Bord ein. Gegen halb acht am Morgen gab der Smutje mit einem Flamenco-Singsang bekannt, dass das Frühstück fertig sei. Dann machten sich jene acht oder neun auf, die drunten im pechschwarzen Laderaum ausgestreckt lagen und um acht zum Wachdienst eingeteilt waren, rappelten sich mühsam auf die Beine und zwängten sich in ihre klammen, salzstarrenden Hosen und Hemden, wenn sie nicht ohnehin in den Kleidern geschlafen hatten. Noch schlaftrunken griffen die Männer ihre Näpfe und drängten sich um die große vordere Luke, nahmen vom Schiffskoch Rührei, Bohnenbrei, Speck, Sardellen und altbackenes Brot in Empfang und begannen zu essen, eingezwängt in irgendeine Ecke des schwankenden Decks. Sobald sie fertig waren und ihre vierstündige Wache als Navigator, Rudergänger oder Ausguck angetreten hatten, konnte die übrige Besatzung frühstücken. Essen gab es reichlich, regelmäßig und abwechslungsreich, wie Rodrigo es nie zuvor bekommen hatte. Am Mittag trug der Schiffskoch noch einmal auf: Pökelfleisch, Käse, Sardinen und Heringe. Manchmal servierte er auch eine warme Kichererbsensuppe. Welch ein Unterschied zur kargen Kost zu Hause. Rodrigo hatte überdies Glück, dass er all die Tage nicht seekrank wurde.
Viel Segelarbeit gab es nicht zu verrichten. Die Winde bliesen stetig, ohne die Richtung zu wechseln. Das Meer tänzelte verspielt mit kleinen Schaumkronen um die Schiffe herum. In der Ferne, backbords, schimmerte ab und an die Küstenlinie am Horizont. Noch segelten sie auf bekannten Routen an Spanien und dem afrikanischen Kontinent entlang, mit Kurs auf die kanarischen Inseln. Steuerbords, immer einige Meilen voraus, glitten die beiden anderen Schiffe der Flotte übers Meer. Am Tage hielten sie Abstand und verständigten sich nur durch Rauchzeichen. In einer Pfanne am Heck der Schiffe brannte ein Signalfeuer, das in der Nacht über viele Meilen zu sehen war. Rauch oder Feuerschein besagten, ob die Schiffe den Kurs ändern, sich zusammenfinden oder wie gehabt weitersegeln konnten. Es gab ein ganzes System von Feuer- und Rauchsignalen, mit deren Hilfe die Flotte beisammengehalten wurde.
Solange man ihn in Ruhe ließ, dämmerte Rodrigo die langen und heißen Nachmittage an einem schattigen Platz vor sich hin und lauschte all den Geräuschen, die die Gallega begleiteten.
Am Abend spielten die Leute von der Freiwache Karten oder stimmten lautstark unanständige Lieder an. Zuerst aber sangen nach dem Abendessen alle gemeinsam auf dem Achterdeck das Salve Regina, so wie sie am Morgen den Tag mit dem Ave Maria und dem Gloria begannen.
Die Nächte verbrachte Rodrigo an Deck. Es gab keinen Schlafraum für die Matrosen. Sie legten sich dort nieder, wo sie Platz fanden, bei schönem Wetter fast immer draußen. Die am meisten umkämpfte Schlafstätte war Abend für Abend der Bereich der Schiffsluke, im Zentrum des Schiffes. Dies war die einzige ebene Fläche; denn das Deck hatte einen leichten Eselsrücken.
Pablo, drei Jahre älter als Rodrigo, schon mit erstem Flaum auf dem Kinn, trat im Kreise der Mannschaft stark und selbstbewusst auf, er hatte vor niemandem Angst. Im Gegensatz zu Rodrigo gab Pablo bereits das Bild eines großen und breitschultrigen jungen Mannes ab. Entsprechend stolzierte er über das Deck: Seht her, ich bin es, der schöne Pablo!
Völlig anders die Körpersprache bei Rodrigo. Er machte sich vorauseilend klein, fühlte sich eingeschüchtert, geduckt, fast devot schlich er herum, stets auf der Hut. Er hatte in seinem Leben schon zu viel Prügel einstecken müssen und lebte in der ständigen Angst, dass ihm weitere drohten. So herausfordernd aufzutreten wie Pablo hätte er nie gewagt. Stattdessen äugte er misstrauisch um sich, drückte sich am liebsten in einen Winkel, ging Konfrontationen aus dem Wege. Manche an Bord unterlagen daher dem Irrtum, Rodrigo sei ein wehrloser Feigling. Ein Trugschluss, denn Rodrigo legte damit nur seine bewährte Überlebenshaltung an den Tag. Im Ernstfall wusste er sich zu wehren. Eines Abends, der vierte oder fünfte Tag auf See ging zu Ende, grauschwarze Dämmerung legte sich bereits bis zum Horizont über das Meer, an Bord der Gallega und der anderen beiden nicht weit entfernten Schiffe hielt der schläfrige Rhythmus der Nachtschicht Einzug, kam Pablo zu Rodrigos Schlafplatz direkt an der Kante zur Back hingerutscht. Er stieß den Jüngeren an.
„Was gibt’s?“, flüsterte Rodrigo.
„Schläfst du?“
„Siehst du doch, nein.“
„Schau mal, was ich habe.“ Pablo nestelte umständlich einen länglichen Gegenstand unter seinem Hemd hervor. Ein Messer. Ein stilettartiger Dolch mit spitz zulaufender Klinge.
„Wo hast du das her?“
„Psst, nicht so laut! Das ist ein Messer.“
„Sehe ich. Wozu brauchst du es?“
Pablo beugte sich noch näher zu Rodrigo hin: „Weißt du nicht, wo die Fahrt hingeht? Wir fahren nach Zipangu, nach Cathay. Die Länder des großen Khan. Hast du nie von Marco Polo gehört? Der war dort. Vielleicht werden wir dort angegriffen. Vielleicht überfallen uns unterwegs Piraten. Wer weiß?“
Rodrigo hielt nichts von Spekulationen. Der große Khan kümmerte ihn nicht. Von Cathay und Zipangu hatte er noch nie etwas gehört, genauso wenig von einem Marco Polo.
„Und außerdem“, Pablos Flüstern ging in geheimnisvolles Raunen über, „außerdem braucht man so ein Messer auch hier an Bord. Du musst dich wehren können. Chachu, der Bootsmann, kann dir auch ein Messer besorgen.“
Chachu war ein großer Kerl, mit wildem Vollbart und am ganzen Leib behaart, nicht nur auf der Brust, sondern am ganzen Körper, auf Schultern, Rücken und Armen. Rodrigo wusste nicht, weshalb er von diesem hünenhaften Kerl ein Messer hätte erbitten sollen. Pablo sagte es ihm: „Hier an Bord ist man nicht sicher. Ich rate dir, halte dich an Chachu. Es gibt ein paar schmierige Typen hier, für die musst du sonst deinen Hintern hinhalten.“
„Was meinst du damit?“
„Du wirst es schon noch merken. Frag mal den kleinen Martin, warum der so zusammengekniffen rumläuft.“
Der „kleine Martin“, das war Martin de Urtubia, ein Baskenjunge. Er war der jüngste Schiffsjunge an Bord der Gallega, noch jünger als Rodrigo, und auch er blieb fast immer unsichtbar. Rodrigo sah ihn nur beim Essen. Martin war ein kleiner Kerl mit lustigem Lockenkopf. Aber was Pablo sagte, das stimmte: Der kleine Martin war ungewöhnlich still und verschreckt, er ging Kontakten und Gesprächen mit der übrigen Mannschaft aus dem Wege.
Читать дальше