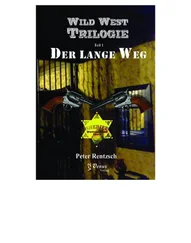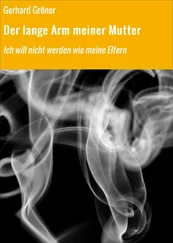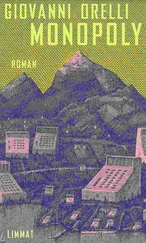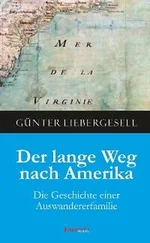Giovanni Orelli - Der lange Winter
Здесь есть возможность читать онлайн «Giovanni Orelli - Der lange Winter» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Der lange Winter
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Der lange Winter: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Der lange Winter»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Der lange Winter — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Der lange Winter», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Unser Dorf ist nach den Gewohnheiten der
früheren Gebirgler erbaut, die Häuser in einer eng zusammengeschlossenen Gruppe: Sie wählten den Platz außerhalb der Lawinenbahnen, im Schutz des Waldes, und dort bauten sie ganz dicht. Früher haben gewiss bis zu fünfhundert Personen hier gelebt, auf die vierzig vorhandenen Häuser verteilt. Die Häuser voller Menschen sind, zumal in der Jahreszeit, in der man nach den Arbeiten des Tages gern auf die Steintreppe hinausgeht, gewiss noch näher aneinander gerückt und auch heiterer erschienen. Jetzt sind wir hier nur noch wenige; vielleicht stammt ein Altersgenosse von mir, draußen in Kalifornien, von einem ab, der aus dem Haus, das dem unseren gegenüberliegt, fortgegangen ist, und er weiß womöglich nicht einmal mehr, dass es unser Dorf gibt: Wir sind sechzig, wenig mehr als Häuser. So bleibt der größte Teil der Häuser leer.
Zwischen unserem Haus und dem nächsten, in dem jemand lebt, ist ein kleiner Gemüsegarten, und dann kommen fünf leere Häuser. Manchmal, wenn ich die Augen schließe, ist mir, als verschwänden diese leeren Häuser und ließen die bewohnten gleich Oasen übrig, denn es ist nicht etwa ein Teil des Dorfes bewohnt und der andere nicht: Aus Zufall oder Schicksal haben die wenigen hier gebliebenen Familien, man könnte sagen, in der eigensinnigen Absicht, auch nicht einen Teil des Dorfes sterben zu lassen, sich überallhin zerstreut, indem sie eine von der andern abrückten – wie eine kleine Streitmacht, die ein ausgedehntes Gebiet halten muss und nicht will, dass auch nur ein Winkel verlassen bleibt, sich in Gruppen aufteilt, die durch den ausgedehnten Bereich hierhin und dahin rücken.
Von jemandem tiefer unten im Dorf weiß man fast weniger, als wenn er draußen in Frankreich lebte; von dort schreiben sie wenigstens zu den Totengedenk- und Festtagen. Wir halten es so: Im Herbst kaufen wir den Zucker und das Mehl, das Übrige haben wir selbst; wir gehen aus dem Haus, um den Schnee ein wenig wegzufegen, damit wir zu den Hühnern oder in den Holz- oder in den Heuschuppen können. Sonntags gehen wir, wenn es möglich ist, in den Ort hinunter, dort wo das Tal breiter wird, wo die Ebene beginnt; wir hören die Messe und kaufen einen Korb Brot. Nach der Messe verweilen wir noch, um von denen vom Ort die Neuigkeiten zu hören. Aber jetzt haben wir die vom Unterland schon eine Weile nicht mehr gesehen. Dieses Jahr wird es noch so weit kommen, dass sie nicht einmal am Karsamstag zu uns heraufkommen werden, zum großen Feuer und um «die tolle Geiß» 1zu sehen. In andern Jahren zogen sie in Gruppen von zu Hause los, schweigend, sie achteten in dem wenigen Schnee auf ihren Schritt so vorsichtig wie Alte, die in die Mitternachtsmesse gehen, und erst dreißig Meter vor uns setzten sie ihre Stoffmasken auf, traten mit einer übertriebenen Verbeugung ein und tanzten so heftig, dass der Boden in unseren alten Häusern einzustürzen drohte.
Einen Menschen gibt es, dem ich gern begegne: Verena, denn ob es Winter ist oder nicht, immer ist sie vergnügt, und mir scheint, ich habe sie immer so gesehen, alterslos. Meine Mutter sagte oft, sie müsse sehr viel geweint haben, als sie ohne Beziehungen zu Verwandten aus Meiringen herkam. Meine Mutter sagte auch, dass die andern Frauen, die hinter dem Fenster saßen und strickten, es geahnt haben müssten, wenn sie an die Tür trat – seht, dort ist sie! –, denn sie hätten wie auf Befehl Kopf und Oberkörper vorgestreckt, wobei sie einen Vorhang beiseite schoben, bis Verena sie sah und, töricht, wie sie war, die Situation verkennend, einen Gruß andeutete: Das sollte heißen, sie wolle zu unserem Dorf gehören. Ja, sie hob einen Arm und den Kopf nach ihren Fenstern. Da ließen sie allesamt den Vorhang zurückfallen, streckten den von der schwarzen Schürze umschlossenen Oberkörper wieder durch, zogen den Kopf zurück, aber höchstens bis an die Stuhllehne, nicht weiter! Danach liefen ihre runden, gläsernen Hühneraugen umher, und nun wurde losgelacht: Verena ging wieder ins Haus. Aber das Schicksal ist ja nicht immer grausam: Später kam noch eine von auswärts, so dass die beiden, außer friedlichen Augenblicken mit ihren Männern, ihre eigenen Begegnungen haben und von dem Land jenseits des Berges reden können, wobei sie auf ihre deutsche Art lachen.
Und dann haben sich weitere Häuser geleert; der Aufbruch vieler sowie manche Todesfälle bewirken, dass die Zurückbleibenden einander wenigstens etwas näher kommen. Jetzt, wo wir nur noch diese paar Leute sind, nennt niemand mehr die beiden «die tollen Geißen», die instinktiv dazu neigen, sich von der Herde abzusondern. Verena macht Torten und Liköre, wie unsere Frauen sie nicht zu machen verstehen; bei Verena lebt fast das ganze Jahr ihre Nichte Vanda, die nun auch schon mehr hierher als auf die andere Seite des Berges gehört, und oft ist Linda, Verenas Schwester, da, und wenn jemand will, dass ich rot werde, so braucht er nur zu sagen, sie sei meine Liebste – man muss nicht besonders scharf aufpassen, um das zu bemerken.
Nach so vielen Tagen Schnee wandern am Himmel einige helle Stellen umher, ein blasses Blau zwischen breiten, schmutzigen Wolken. Inzwischen haben wir nichts unterlassen, wir haben zu den Heiligen gebetet, haben die drei- und die neuntägigen Andachten abgehalten. Adele sagt, man solle die Reliquien ausstellen, und da gerade ein Tag Ruhe ist, kommt auch der Priester herauf, uns eine Messe zu lesen, die wir nötiger brauchen als das Brot, das wir essen. Nachdem die Messe, ohne Predigt, gelesen war, haben der Priester und die Frauen uns am Schluss alle Beschwörungsformeln gelesen und danach die Gebete, wie sie der Heilige Vater vorschreibt. Sonst tun wir nur das Übliche, aber auch wir halten uns an die Vorschriften des Papstes. Nach der Messe steigen wir alle hinauf ins Dorf. Angesichts des Berges, von dem man deutlich nur den Fuß sieht, den mit Schneeflecken bedeckten Lärchenwald, liest der Priester erneut die Beschwörungsformeln. Es ist kalt, er liest, ohne den Blick von seinem kleinen Messbuch zu heben. Er wendet sich an den Berg, als wolle er ihn daran erinnern, dass auch er von Gott geschaffen ist, auch wenn das Gebet den Berg nicht ausdrücklich anklagt. Wer kann sagen, ob der Berg ihm zuhört oder nicht, ob er geneigt sein wird, ihm zu gehorchen? Und Mitleid mit uns zu haben? Von seinen Flanken schickt er uns für den Augenblick nur einen Wind, der das gestickte Chorhemd des Jungen, der Weihwasserkessel und Wedel in den blau gefrorenen Händen hält, zittern lässt. Ist das eine Antwort? Die Alten, knorrig wie die letzten Lärchen auf den Alpen, nur noch dafür gut, das Feuer vom Abend bis zum Morgen in Gang zu halten, warten wie das Postpferd, wenn der Reiter ihm Halt befiehlt.
Die Frauen blicken unverwandt auf den Priester.
Obwohl hoch oben, breitet das Grau sich über den ganzen Himmel aus, gleitet den Waldhang hinunter. Am Schluss des Bittgebetes ist der Berg schon nicht mehr zu sehen; kennten wir ihn nicht, so könnten wir denken, er wäre zehntausend Meter hoch; und wenn der Priester den Blick vom Buch hebt und den Wedel dem kleinen blonden Jungen aus den blau gefrorenen Händen nimmt, sprüht er seine heiligen Tropfen gegen eine undurchdringliche weiße Masse. Die Alten bekreuzigen sich ruhig, der Berg dort wird schon zahm bleiben, wie ein Tier, das die Hand des Meisters auf dem Rücken spürt: ein paar Tropfen, die den Schnee gewiss festfrieren lassen – sie werden ihn an den harten Fels kleben und daran hindern, in ungeordnetem, todbringendem Durcheinander auf uns herabzustürzen; oder diese Tropfen werden die Lawine – wenn sie kommen sollte, aber das ist nicht möglich – ablenken, über unsere doch auch gesegneten Häuser hinweg: wie man eine Natter mit dem Stock von sich fern hält. So ist es auch früher schon geschehen, wenn der Glaube vorhanden war: Lawinen, die ganz glatt durch ihre Bahnen hinuntergekommen sind, als alle schliefen, Lawinen, die oberhalb des Dorfes stecken geblieben sind, sozusagen dicht über den Häusern, ein Wunder, das man den Gegnern der Priester vor Augen führen konnte; oder wie ein Luftzug neben den Häusern hinuntergefahren: allerdings nicht im Jahre 88, aber im Grunde hatte Gott in seiner Gnade damit sagen wollen, dass man nie mit dem Feuer spielen dürfe. Dreiunddreißig Tote, so steht es auf dem Kreuz zu Füßen der großen Mauer.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Der lange Winter»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Der lange Winter» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Der lange Winter» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.