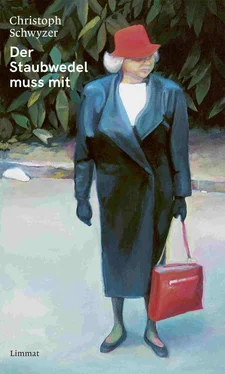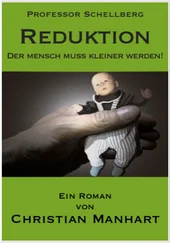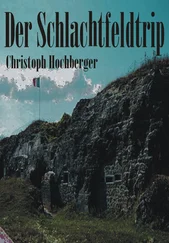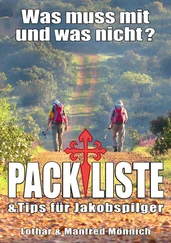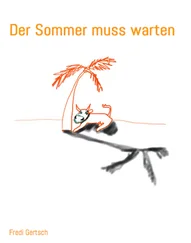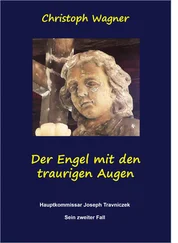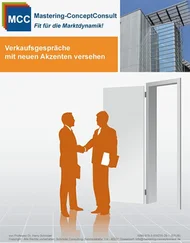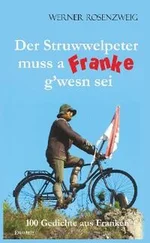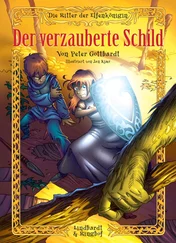Der Wille allein hilft nicht. Die Krankheit hält ihn fest im Griff, drückt ihn nieder, zwingt ihn, sich wieder hinzulegen. Aus Erschöpfung zieht er sich in sich selbst zurück, in seine Erinnerungen. Während er auf dem Bett liegt, geht er durch Wände. Er spaziert durch sein Leben wie durch eine Landschaft, besucht Wohnorte und Arbeitsplätze, begegnet Menschen. Manchmal ist die Sicht schlecht, nebulös; was einst vertraut war, zeigt sich nur schemenhaft. Und dann gibt es diejenigen Momente, wo auf einen Schlag alles hell erleuchtet erscheint, weil eine Einzelheit zur Leuchtkugel wird. Beispielsweise der kleine weisse Sarg, von seinem Vater am Martinstag auf der Schulter durch die Hintergasse des Dorfes getragen, darin das ungetaufte Kind, seine Schwester.
Ja, dort auf dem Foto, die Frau mit Hut, das ist sie. Nie wäre meine Mutter in ein Altersheim gegangen, nie! Sie war so stolz und schön und immer stilvoll gekleidet; sie hatte sich selbst und alle anderen im Griff. Ach, meine Mutter, wenn die mich in meiner Aufmachung sähe! Sie wollte immer, dass aus mir mal was wird. Ob Bankdirektor, Bäcker oder Bauarbeiter, das spielte eine Rolle, aber nicht eine derart entscheidende. Die Hauptsache war, wo und in welchem Beruf auch immer, anständig, tüchtig und vor allem: flott zu sein. Anständig, tüchtig und flott, das war man nicht dauerhaft; man musste es immer wieder von neuem werden. Es war Arbeit: die schmutzige Hose gegen eine saubere austauschen. Die abgestossenen Schuhe eincremen und polieren. Die widerspenstigen Haare kämmen. Nicht mit vollem und auch nicht mit halbvollem Mund reden. Langsam essen; das Messer gehört in die rechte, die Gabel in die linke Hand, langsam trinken. Jedermann laut und deutlich grüssen. Das Geld ins Sparschwein stecken und nicht am Kiosk verputzen. Nicht rauchen, nicht trinken. Jeden Tag dafür beten, dass man mal eine hübsche Frau, eine hübsche Wohnung finden würde. Man konnte nie genug früh damit anfangen, sich ins Anständig-, ins Tüchtig- und Flottsein einzuüben.
Was für ein flottes Hemd du hast! Was für ein flotter Bub du bist, ach mein Mäuschen Maximilian! Aus dir wird mal ein flotter Oberministrant!, sagte sie am Sonntag zu mir, bevor ich in die Kirche zum Ministrantendienst ging. Flott, wie ich dieses Wort hasste. Das Wort «flott» flutschte angepasst und widerstandslos durchs Leben. Es hatte keine Ecken, keine Kanten. Es kam darin kein knirschendes K, kein bremsendes R, kein verlangsamendes H vor. Flott. Ogottogott! Ich wollte nicht anständig, ich wollte nicht tüchtig, ich wollte, verdammt noch mal, nicht flott sein.
Noch heute höre ich Mutter, wenn mein Blick an meinem Spiegelbild hängen bleibt, zu mir sagen: Nein, Maximilian, das geht nicht, das macht mir Sorgen. Wie läufst du herum! Schämst du dich nicht? Dein Hemd, es hat Flecken. Deine Hose, abgewetzt und ausgewaschen. Und deine Schuhe, das sind keine Schuhe, das sind Latschen! Geh in die Stadt zum Schild und kauf dir was Flottes!
Ein Bett, ein Bad und drei Mahlzeiten – das ist schon alles, alles, was man braucht zum Leben, wer mehr braucht, leistet sich Luxus, sagt sie. Und sie braucht mehr: einen Bleistift, Papier, die Bibel. Auch einen Stuhl und einen kleinen Tisch. Morgens liest sie, schaut aus dem Fenster; nachmittags schreibt sie, schaut aus dem Fenster. Ihre Hände sind gekrümmt, ihre Füsse auch. Sie sitzt im Rollstuhl, gehen kann sie nur mit Mühe. Gicht, sagt sie. Den Bleistift schiebt sie in eine Lücke zwischen den hakenförmigen, geröteten Fingern. Sie hält ihn mit sanftem Druck. Die Schmerzen wären sonst unerträglich. Beim Schreiben wackelt der Bleistift. Im Geheimen, durch die Hand verdeckt, entstehen die Buchstaben. Zum Vorschein kommen grosse, zitterige Wesen, jedes ein Kunstwerk. Vor dem Nachtessen faltet sie das Blatt. Es ist auf beiden Seiten beschriftet, und es vibriert vor Lebendigkeit. Umständlich schiebt sie das Blatt in ein Couvert. Ein Brief pro Tag, sagt sie. Meine Freundinnen sollen wissen: Ich lebe.
Nachts schlafe ich schlecht, tagsüber kratzt es mich ununterbrochen im Hals. Und wenn ich durch den Gang zum Fernsehzimmer gehe, spüre ich ein Stechen in der Brust. Wehleidig war ich nie. Aber genug ist genug, sage ich, du bist krank, du gehörst zum Arzt. Zum besten in der Stadt, nicht da zu diesem Etagenheini. Ich bekomme einen Termin, fahre zuversichtlich mit dem Taxi hin. So, sagt der Arzt, was führt Sie zu mir? Und ich sage genau, wie es um mich steht, verheimliche nicht mal mein Pfeifenrauchen, lasse alle Doktorspiele über mich ergehen. Dann verschwindet der Arzt, ich hoffe schon; und nach ein paar Minuten kommt er zurück: mit leeren Händen! Herr Schwery, freuen Sie sich, ruft er, Ihnen fehlt nichts; es sieht alles so weit gut aus. Machen Sie weiter so! Trinken Sie viel Wasser, auch wenn Sie keinen Durst verspüren; essen Sie abends nicht zu viel und nicht zu fettig, legen Sie sich nicht allzu früh ins Bett und lutschen Sie bei Bedarf ein Kräuterbonbon. Mit offenem Mund, eine fürchterliche Enge im Hals, starre ich ihn an: Ohne ein Medikament, ohne ein einziges, schickt dieser arrogante Kittelköter mich nach Hause. Ein Depp, ein Vollidiot. Wenn ich zum Arzt gehe, gehe ich zum Arzt, weil ich krank bin, ein Medikament brauche. Jetzt schlafe ich noch schlechter. Was immerhin beweist: Ich bin wirklich krank!
Es brennt in ihr. Zum Ausgehen parat, mit roten Lippen und mit Handtasche, sitzt sie im Fauteuil. Die Finger, gepflegt bis in die Nagelspitzen, nesteln an den Knöpfen des Mantels, an der Gürtelschnalle, befühlen den Rocksaum, gleiten über die Beine, legen sich auf ihre Wangen; Frau Moser tätschelt sich selbst. Und erst dann, wenn die Finger an den geschminkten Lippen zu drücken und zu zupfen beginnen, steht Frau Moser auf, zieht sich vor dem Spiegel die Lippen nach, verlässt das Heim und macht sich über Süssigkeiten her. In der nahen Confiserie ist sie Stammgast. Sie setzt sich ans Fenster mit Blick auf die Passanten und versucht durch die Einnahme von Pralinés, Cremeschnitten, Mousse au Chocolat, Zwetschgenkuchen, Hefeschnecken, Marzipanzungen, Zitronenkuchen, Carameltörtchen oder Caracs die immer wieder aufstossende Sehnsucht hinunterzuschlucken. Doch alles, was ihr am Ende eines Tages, auf dem Rückweg zum Heim, davon bleibt, ist: Magenbrennen.
Soll ich Ihnen den Brief vorlesen? Vor zwei Wochen ist er eingetroffen, aus den USA, aus Boston, von meinem Sohn. Ich nehme ihn jeden Tag unzählige Male zur Hand, trage ihn mit mir herum. Also, hören Sie:
Liebe Mutter
Ich habe Deine Adresse von meiner Halbschwester bekommen. Und von ihr habe ich auch gehört, dass Du sehr oft weinst. Du meinst, ich hätte Dich völlig vergessen. Nein, das stimmt nicht. Ich möchte Dich nach all den Jahren endlich wieder einmal besuchen. Dich nicht länger missachten, verachten, nur weil Du Papa damals verlassen hast. Ich möchte lange und entspannt mit Dir an einem Tisch sitzen. Dir keine Vorwürfe mehr machen, Dich nicht anschreien, nicht anschweigen. Ich möchte mit Dir ins Plaudern kommen. Ja, plaudern! Weil es nicht darum geht, gescheites Zeug zu reden, zu diskutieren, über Vergangenes zu streiten, sondern nur darum, im Gespräch miteinander verbunden zu sein: aufgehoben im Klang der Muttersprache. Ich habe sie verlernt, Deine Sprache. Wie klingt sie? Ich möchte Deine Stimme hören, mit Dir sein. An Vorsätzen mangelt es mir nicht, hat es mir noch nie gemangelt. Doch nun ist es höchste Zeit, das «Vor» zu streichen und aus den Vorsätzen einfach Sätze zu machen. Kleine, bescheidene Sätze. Ein Satz schliesst sich an den anderen an – und es gibt ein Weiterkommen, einen Weg. Schritt für Schritt, Satz für Satz. Keine Vorsätze mehr, nur noch Sätze. Das wär’s! Das würde schon reichen. Mutter, ich werde Dich besuchen, ich werde kommen, nur Deinetwegen, ganz bestimmt.
Читать дальше