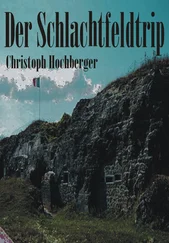Das Tram brachte mich nach Saint-Louis, der Alkohol nach Algerien. Gegen Mittag erwachte ich und dachte: Heimatland, wo bin ich hier? Ich polterte, tobte und schrie, schlug mit den Fäusten gegen die Wand. Ta gueule!, brüllte der Gendarm. Etwas später öffnete er die Tür zur Zelle, warf mir einen roten Rucksack vor die Füsse, meinen Rucksack. Verflucht, dachte ich, ich war also wieder einmal nach der Arbeit in diesen Spunten nach Saint-Louis gefahren und nach einer durchzechten Nacht in der Ausnüchterungszelle gelandet. Nach und nach kam mir alles in den Sinn. Im Rucksack steckte mein Übergewand, aber nicht nur mein Übergewand, sondern auch ein Couvert, und in diesem Couvert steckte ein Vertrag mit meiner Unterschrift: Dieser spendable, braungebrannte Agent mit Bürstenschnitt und kantigem Kopf, der mein Weinglas nie leer werden liess, hatte mich also, Heimatland noch mal, kurz bevor ich meinen Verstand verlor, rumbekommen. Mein Chef schimpfte mit mir, schnauzte mich an, als er hörte, dass ich schon bald nicht mehr in Basel Blumen setzen und jäten würde, sondern als Fallschirmspringer in Algerien kämpfen und schiessen. Ich ging nach Strassburg zur Musterung, fuhr mit dem Zug nach Marseille, wurde dort mit einer abenteuerlustigen Meute in einen alten Kahn gepfercht, betrat im Hafen von Oran erstmals algerischen Boden, rumpelte auf der Ladefläche eines Lastwagens nach Sidi bel Abbès, wurde ein zweites Mal gemustert und gefragt, welchen Beruf ich erlernt hätte. Jardinier, war meine Antwort. Sie nickten, brachten mich in eine grosse Kaserne nach Saida. Dort bekam ich weder einen Fallschirm noch ein Sturmgewehr, sondern Schaufel und Hacke; und die ganze Zeit tat ich nichts anderes als auf dem Kasernenareal Unkraut jäten, Blumen setzen und Rasen mähen. Nach drei Jahren verliess ich die Fremdenlegion als Pazifist.
Elvira steht vom Tisch auf und schliesst, obwohl es Spätsommer und draussen angenehm warm ist, die beiden gegenüberliegenden Fenster. Die Fliegen, sagt sie. Sie mag es nicht, wenn diese Viecher hineinschwirren und sich aufs Essen setzen. Ein Essen, das allen schmeckt und vorerst keinen Anlass zu Beanstandungen gibt. Aber die Fliegen, die bereits im Speisesaal drin sind, sie stören die von Schmatz-, Hust- und Besteckgeräuschen untermalte Mittagessensstille. Die Fliegen fallen als schwarzblaue Flecken auf den Kartoffelstock. Oder sie versuchen überhängend, vom Schüsselrand aus, an die Sauce zu kommen. Elvira wedelt mit ihren Händen über dem Teller. Sie kann sich nicht mehr aufs Essen konzentrieren, Gabel und Messer bleiben auf dem Tellerrand liegen. Die Fliegen, die furchtlosesten Tiere überhaupt, kann nichts davon abhalten, immer wieder an den Tisch zurückzukehren. Eklig, wie eklig!, ruft Elvira. Und Arnoldo, ihr Tischnachbar, den sie eigentlich sehr mag, haut auf den Tisch und ruft: Fliegen tun keinem Menschen etwas zuleide; wir hatten auf unserem Hof Tausende davon! Doch, sagt Elvira, doch: Sie sind Krankheitsüberträger! An ihren Füssen klebt Dreck, Hundedreck, Strassendreck, Kadaverdreck. Und im «Drogistenstern» habe ich neulich auch gelesen, dass sie durch ihren Rüssel Magensaft auf die Nahrung erbrechen, damit diese sich auflöst, um sie danach mit ihrem Rüssel aufsaugen zu können. Elvira hält es nicht mehr aus, sie rollt die Serviette zu einer Fliegenklatsche. Sie lauert, auf dem äussersten Stuhlrand sitzend, den Fliegen auf. Arnoldo isst und schweigt. Und schöpft sich sogar demonstrativ nochmals vom Kartoffelstock und von der Sauce. Plötzlich holt Elvira zum Schlag aus, schafft es aber, im Gegensatz zum tapferen Schneiderlein, nicht, auch nur eine einzige Fliege zu töten. Arnoldo schaut zu und beginnt zu fluchen: Jetzt leg diese blöde Serviette weg! Herrgott, kann man denn nicht einmal in Ruhe essen! Arnoldo schüttelt den Kopf. Elvira wischt sich Tränen ab, während eine Fliege friedlich auf den Zinken ihrer Gabel sitzt.
Nein, ich kann meinen Kindern nicht böse sein. Sie haben doch nach dem Tod meines Ehemannes alles so gut und gründlich geregelt: das Haus verkauft, die Möbel zum Trödler gebracht, die Katzen ins Tier- und mich ins Altersheim.
Viola liebt Taschentücher. Natürlich nicht jene aus Papier, die man in schnellem Tempo aus dem Hosensack zieht und ebenso schnell wieder wegwirft, sondern nur jene aus feinstem Baumwollstoff; Taschentücher, die zum Teil so alt sind wie sie selbst – aber die, im Gegensatz zu ihr, noch immer wie neu aussehen, makellos. In den beiden Nachttischschubladen hütet sie ihre Sammlung. Öffnet sie eine Schublade, breitet sich über der bunten Taschentuchlandschaft ein Duft nach Lavendel aus. Manche Taschentücher sind aufwendig mit Katzen oder Schmetterlingen bestickt, andere mit Blumen und Pflanzengirlanden. Auch mit Bibelsprüchen. Wieder andere sind bedruckt mit Sehenswürdigkeiten: Eiffelturm, Kapellbrücke, Matterhorn, Schlösser und Wappen. Einige besonders kostbare haben eine gehäkelte Umrandung. Und alle werden gut gepflegt und mit dem Bügeleisen geglättet.
Ist ihr Sohn, nach wochenlangen Unterbrüchen, bei ihr zu Besuch, schenkt sie ihm zum Abschied jedes Mal ein Taschentuch: Man muss das hergeben, woran man selber am meisten hängt. Sie tut es feierlich, trägt das Taschentuch auf der flachen Hand zu ihm, nicht ohne vorher einige Tropfen Lavendelöl oder Franzbranntwein darauf getröpfelt zu haben, manchmal auch noch ein paar Tropfen Weihwasser. Hier, nimm, tief einatmen; das tut dir gut, das erfrischt dich! So verschiebt sich langsam, Stück für Stück, ihre Taschentuchsammlung in seine Wohnung, in seinen Schrank. Lila, lindengrün, erikaviolett. Und er glaubt, dass sie erst dann sterben wird, wenn ihre Nachttischschubladen leer sein werden.
Gestern Nachmittag, als ich mit meinem Enkel um drei Uhr in die Cafeteria kam, sah ich meine Freundin Martha allein an einem Vierertisch sitzen. Sie stocherte mit der Gabel in einem Erdbeertörtchen – und beim Näherkommen fielen mir ihre verweinten Augen auf und die verschmierte Wimperntusche. Noch nie hatte ich Martha weinen sehen. Es musste etwas Schreckliches passiert sein. Ich musste sie aus dem Netz, in dem sie gefangen schien, herausholen. Ich setzte mich zu ihr und fragte: Martha, was hast du? Warum weinst du? Sie umklammerte meine Hand, zog mich zu sich, strich mir über mein Haar und flüsterte, um Fassung ringend: Weisst du, Liebes, heute ist mein Geburtstag. Alle haben es vergessen, selbst meine Kinder, nur ich habe daran gedacht!
Frau Jud kniet vor ihrem ausgebreiteten Leben, in der Mitte ihres Zimmers, auf einem dunkelblauen Teppich. Die Vorhänge sind zurückgezogen, die Geranien auf dem Balkon verblüht, einige wenige Wolken stehen am Himmel; sie dämpfen das Sonnenlicht. Auf den vielen Fotos, alle schwarz-weiss, liegen Schatten des jetzigen Lebens. Frau Jud neigt sich nach vorne, stützt sich mit den Fäusten auf den Teppich, schaut auf ihre vergilbte Vergangenheit, seufzt, lacht leise. Hinter ihren Füssen stapeln sich Schuhschachteln; Dutzende von Fotos schwimmen auf dem Teppich. Frau Jud rutscht auf den Knien, dreht sich im Kreis. Die Bilder, die so nah sind und doch so fern, tauchen wie Inseln aus dem Meer des Vergessenen auf, ziehen in Zeitlupe an ihren Augen vorbei. So lange, bis sich auf einmal ein Bild aus der Menge in den Vordergrund drängt, Frau Jud ihre Drehbewegung stoppt, sich herabbeugt, das Gleichgewicht verliert, nach vorne kippt, sich mit einer Hand, in eine Lücke zwischen den Fotos zielend, auffängt und mit der anderen Hand zögernd, fast etwas ängstlich, das Foto, das ihr ins Auge gesprungen ist, vors Gesicht führt, das Kind auf dem Schaukelpferd grösser und grösser wird und Frau Jud klein, so klein, wie sie früher einmal war.
Читать дальше