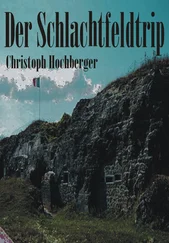Laetizia gibt sich am Mittagstisch alle Mühe. Sie versucht eine ernste Miene zu machen. Denn sie will nicht, dass sie mit ihrer Lebensfreude den anderen den Tag noch mehr verdirbt.
Ich liebe Autos. Aber dieser saudumme Audi ist schuld, dass ich mein Haus am Waldrand verlassen musste – und mitten in der Stadt in einer Alterswohnung gelandet bin. Nun gut, auch meine Tochter trug einen zünftigen Teil dazu bei. Ich erinnere mich, es war an Allerseelen, vor genau einem Jahr: Jemand klingelte an der Haustür. Ich war zu niedergeschlagen zum Aufstehen. Es klingelte wieder. Am liebsten wäre ich unters Sofa gekrochen. Die Tür ging auf. Es war meine Tochter, sie hatte ja einen Schlüssel. Sie rief nach mir, bekam keine Antwort, sie befürchtete schon das Schlimmste. Sie rannte die Treppe hoch, stürzte in die Stube und sah mich bleich und erschöpft, mit Tränen in den Augen, auf dem Sofa liegen. Weinst du meinetwegen, weil ich dich gestern nicht angerufen habe und heute nicht auf Mutters Grab gekommen bin?, fragte sie mich. Nein, gab ich zur Antwort, du bist es nicht. Aber wenn du in die Garage gehst, dann wirst du sehen, weshalb. Energisch drehte sie sich um und polterte nach unten. Ich hörte, wie sie die Tür zur Garage aufriss. Ich wusste, jetzt würden dann gleich die Neonröhren anspringen und sie würde alles sehen: Der Audi neunzig, Automat, silber metallic, fünf Zylinder, einhundertfünfzehn PS, stand schräg in der Garage. Die Fahrerseite war von vorne bis hinten zerkratzt und eingedrückt, der linke Seitenspiegel lag wie eine abgeschlagene Hand auf dem Boden. Und der rote Rapid-Rasenmäher stand nicht wie üblich einen halben Meter von der Motorhaube entfernt an seinem Platz, sondern lag umgekippt, gegen zwei Harassen mit Äpfeln gedrückt, hinten an der Betonmauer.
Als sie wieder neben mir stand, schwieg sie lange, begann dann zu schimpfen und befahl in einem Tonfall, der nicht den kleinsten Widerspruch duldete: Dein zweiter Unfall innerhalb eines Monats. Du gibst den Audi samt Ausweis ab – und ziehst zu mir in die Nähe, in die Stadt!
Nackt, so wie sie vom jahrelangen Leben im Heim geschaffen worden war, üppiges Essen, keine Arbeit, wenig Bewegung, stand sie vor dem Spiegelschrank, einzig das Haar unter einer Duschhaube versteckt. Ein pensioniertes Schneewittchen, weiss und rein, als wäre vom Hals an abwärts noch kein einziger Strahl Sonne auf ihre Haut gefallen. Es roch nach Rosenöl. Ein betäubender Duft. Sie sog ihn ein. Sie liebte ihn. Die dunkelrote Glasflasche stand auf dem Lavabo. Nach einer Verschnaufpause machte sie mit Einreiben weiter, hob den rechten Fuss, stellte ihn auf dem WC-Deckel ab, beugte ihren breiten Oberkörper vornüber. Mit weit ausholenden Bewegungen und von klatschenden Geräuschen begleitet fuhr sie mit den öligen Händen über ihren Unterschenkel bis unter die Kniekehle, Innenseite, Aussenseite. Ihr schwarzes Haar war ein wenig unter der Badehaube hervorgerutscht. Die eine Brust hing nach unten und baumelte bei jeder Bewegung in der Luft. Die andere Brust wurde von ihrem dicken Oberschenkel zusammengedrückt, so dass sich Wülste bildeten. Die Brustwarzen hatten dieselbe Farbe wie die Erlenzapfen, die sie vor ein paar Tagen unten am Bächlein gesehen hatte: dunkelbraun, fast schwarz. An gewissen Tagen packte sie eine unglaubliche Lust, Herbert zu fragen, ob er ihr beim Einreiben helfen wolle. An anderen Tagen blieb sie im Badezimmer wie angewurzelt stehen, schaute in den Spiegel und glitt mit dem Blick verstört, fast angewidert über die ihr so fremd erscheinende Frau.
Verliebt war ich nicht, geheiratet habe ich ihn trotzdem. Und ich bin unendlich dankbar dafür. Ich hätte viele haben können, sehr viele. Und als ob sie es beweisen wollte, zählt sie Namen, Berufe, Wohnorte auf. Fügt dann aber rasch hinzu: Ich kann froh sein, dass ich die vielen, die ich hätte haben können, nicht genommen habe. Ich kann wirklich froh sein, ich muss Gott dafür danken. Meine Geduld hat sich gelohnt. Denn eines Tages kam er: Ich arbeitete damals in der Bäckerei und im Café meiner Eltern, war Fräulein für alle und alles. Ich habe Brotlaibe, Pralinés und Nussgipfel verkauft. Regale aufgefüllt. Abgewaschen. Serviert. Bis er auftauchte. Per Zufall. Er war auf der Durchreise und hatte Lust auf etwas Süsses. Als er den Laden betrat, wusste ich sofort: ein Fremder, kein Einheimischer. Dieses sauber rasierte, schmale und etwas bleiche Gesicht, das im Kontrast zur schwarzen Hornbrille stand, hatte ich noch nie zuvor im Laden gesehen. Es war Frühling, Anfang Mai. Er kaufte sich eine Schlossbergkugel. Und ich musste ihm, da er diese Süssigkeit nicht kannte, in allen Einzelheiten erklären, aus welchen Zutaten sie bestand, wie sie hergestellt wurde. Während des Zuhörens schaute er mir aufmerksam und liebevoll in die Augen, ein kindliches Lächeln auf den Lippen. Danach kam er immer wieder, jeden Samstagnachmittag. Das eine Mal kaufte er sich eine Schlossbergkugel, das andere Mal ein Meitschibei. Er war ein bisschen steif, ein bisschen ein Pedant, aber seine mit einer Prise Humor gespickte Freundlichkeit strahlte etwas Sympathisches, Vertrauenerweckendes aus. Er trug bei jedem Wetter, selbst bei Sommerhitze, eine Krawatte, meistens von dunkler, unauffälliger Farbe. Seine Hemden waren weiss. Manchmal hatte er eine Ledermappe unter den Arm geklemmt oder einen Regenschirm. Bald stellte sich heraus: Er war ein Schreibmaschinenvertreter, besuchte Kunden in unserer und in angrenzenden Gemeinden. Auch am Samstagmorgen war er unterwegs. Einmal tranken wir zusammen im angebauten Kaffeestübchen einen Milchkaffee. Es war kurz nach Ladenschluss. Zum Kaffee ass er eine mit Zucker glasierte Vanillebrezel, die ich ihm spendiert hatte. Er fasste das Gebäck sehr zart und vorsichtig an, als wäre es aus Porzellan, biss ein Stückchen ab. Er kaute es mit geschlossenem Mund und blickte mich so unglaublich treuherzig und ehrlich an, dass ich mich zwar nicht gerade in ihn verliebte, sein Angebot aber, mit ihm am Sonntag einen Spaziergang zu machen, nicht ausschlagen konnte. Und während des Schlenderns dem Seeufer entlang machte er mir im Schatten einer Rosskastanie einen wohl zu Hause Wort für Wort auswendig gelernten Heiratsantrag. Weshalb lange überlegen, dachte ich, sag doch einfach: Ja! Bei ihm wirst du in sicheren Händen sein. Besser ich nehme ihn, ich gründe mit ihm bald einmal eine Familie – anstatt dass ich auch noch mit fünfzig Jahren im Geschäft meiner Eltern das Fräulein spielen muss und ewig ledig bleibe. Er wird bestimmt ein pflichtbewusster Vater sein. Und er wird dir, das war in seinen Augen zu lesen, nie untreu werden. Einen Besseren wirst du nicht mehr so schnell finden. Es war also mehr ein Kopf- als ein Herzentscheid. Aber irgendwann muss man sich entscheiden. Irgendwann muss man Ja sagen, auch wenn vieles im Unklaren bleibt. Und Liebe, mein Lieber, ist kein Gefühl; Liebe ist eine Haltung, eine Frage des Willens.
Ins Gedächtnistraining geht er nicht. Er sagt: Ich bin so nachtragend. Besser wäre eine Methode, die gezieltes Vergessen möglich macht.
Um die Kanarienvögel in der Cafeteria kümmert sich kaum einer. Natürlich: Der Käfig wird geputzt, die Vögel werden gefüttert, machen keineswegs einen verwahrlosten Eindruck. Doch selten bleibt jemand vor ihrem Käfig stehen, wendet sich ihnen zu, spricht mit ihnen. Nur Frau Heri sitzt den ganzen Tag im Rollstuhl neben dem Käfig, träumt davon, ein Vogel zu sein. Kein Kanarienvogel, um Himmels willen, nein! Vielleicht ein Spatz. Oder noch viel lieber einer dieser Distelfinken, die nie allein, sondern immer paarweise im Innenhof auftauchen, leicht wie Schmetterlinge durch die Luft fliegen, sich an Gräser und Blütenstengel krallen und genau zu ahnen scheinen, wie hoch sie hinaufsteigen dürfen, damit die Gräser und Stengel beim Samenpicken nicht einknicken.
Читать дальше