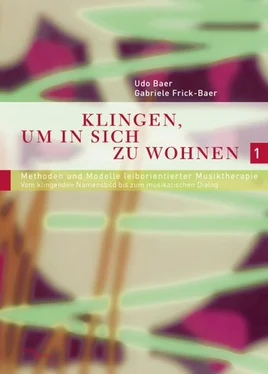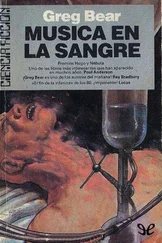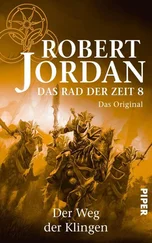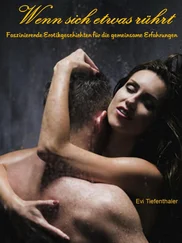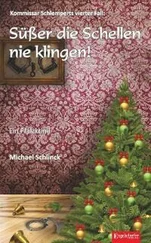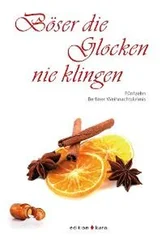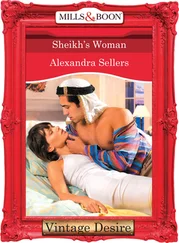Manchmal reicht es, wenn in der therapeutischen Situation von diesen Erfahrungen erzählt werden kann, wenn sie „heraus“ dürfen, damit sich die KlientInnen von ihnen frei machen und sich den neuen Erfahrungen des Musizierens in der Therapie öffnen können. Manchmal bedarf es lediglich klärender Worte der TherapeutInnen, dass sich das Musizieren in der therapeutischen Situation fundamental von dem unterscheidet, was diese KlientInnen kennen: „Hier geht es nicht um Richtig oder Falsch. Hier geht es nicht darum, etwas zu können, sondern darum, sich im Musizieren zu erleben.“ Und manchmal, vor allem wenn über negative, ja traumatische Erfahrungen des Musiklernens weitere Traumata lebendig werden, muss (musiktherapeutische) Traumaarbeit geleistet werden.
Es gibt allerdings nicht nur negative Erfahrungen, die KlientInnen damit gemacht haben, ein Instrument zu erlernen. Manche erzählen auch, wie gut ihnen das getan hat. Für viele hat sich mit dem Musizieren eine neue Welt erschlossen, für andere war das Lernen ein Halt, gab das Üben eine Struktur, manche hat es „gerettet“, das psychische Überleben gesichert.
2.8 Die soziale Dimension der musikalischen Biografie
Die bislang angeführten Beispiele für die Wirkungsmöglichkeiten der musikalischen Biografie haben sicherlich schon gezeigt, dass die musikalische Biografie immer auch eine soziale Dimension hat. Unter sozialer Dimension verstehen wir den Bezug zu anderen Menschen, z. B. ihre Anwesenheit und Bedeutung in der Szene des Vorspielens. Auch die Abwesenheit anderer Menschen („Nie hat mir jemand zugehört.“) kann als soziale Dimension wirken. Wie unterschiedlich und zum Teil gravierend die soziale Dimension der musikalischen Biografie deren Bedeutung bestimmen kann, möchten wir an drei kurzen Beispielen illustrieren:
Eine Frau erzählt, dass sie sich selbst das Spielen von Musikinstrumenten beigebracht hat. Um Unterricht nehmen zu können, reichte das Geld nicht, aber es gab einige Instrumente im Haushalt. Also probierte sie und probierte und brachte sich das Spielen selbst bei. Dafür gab es Wertschätzung, die einzige, an die sie sich erinnern kann. Mit dem Musizieren gelang es ihr, eine Oase in der Wüste der Abwertung zu schaffen: „Das war das einzige, worin ich was konnte.“
Für eine andere Frau war nicht so sehr das Spielen, sondern eher das Hören von Musik in der Jugend wichtig gewesen. Sie war in einer großen Familie aufgewachsen. Die Musik, die sie hörte, war anders als die, welche einerseits bei den Geschwistern und andererseits bei den Eltern „in“ war. Ihre Eigenwilligkeit bei der Musikauswahl stärkte ihren Eigensinn und ihr Freiheitsgefühl. Aber sie zahlte einen Preis dafür: Sie blieb mit ihrer Musik allein, bezahlte Freiheit und Eigensinn einige Jahre lang mit Einsamkeit.
Ein Mann erzählt begeistert von seinen Erfahrungen in einer Jugendband. Er konnte ein paar Griffe auf seiner Gitarre, schon tat er sich mit anderen zusammen, übte, probte und trat auf. „Sicher, die Auftritte waren auch toll. Das gab Punkte bei den Mädchen. Klasse war aber vor allem der Zusammenhalt in der Band. Wir waren Freunde. Und wenn es Meinungsverschiedenheiten gab, haben wir gelernt, das so zu regeln, dass die Gruppe nicht auseinander fiel. Ja, ich habe in der Band Teamgeist gelernt. Du musst auf die anderen hören und trotzdem bei dir bleiben – das bringt’s.“
Jeder Mensch sieht sich in seiner persönlichen Entwicklung Herausforderungen gegenüber, die er bewältigen muss. Die Ablösung von den Eltern im Jugendalter ist solch eine Herausforderung, ebenso jede Krise, wie eine schwere Krankheit, der Verlust einer nahen Person oder das Erleiden einer Gewalttat.
Menschen entwickeln Strategien, um solche Herausforderungen zu bewältigen. In den Sozialwissenschaften nennt man solche Bewältigungsstrategien „Coping“. In der Therapie spielen vor allem die persönlichen Krisen-Copings eine wichtige Rolle (s. a. Baer/Frick-Baer 2001a. S.363ff). Fast alle Menschen neigen dazu, eine Art und Weise, mit der sie eine Herausforderung wie z. B. eine Krise zumindest halbwegs gemeistert bzw. physisch und psychisch überlebt haben, zu ihrer Strategie zu machen, d.h. zu versuchen, mit ihr auch alle künftigen Herausforderungen zu bewältigen. Das kann gelegentlich gelingen, viele Menschen scheitern aber, wenn sie auf alten Wegen Herausforderungen gegenüber treten, die eigentlich ganz anderer Copings bedürfen.
Was hat das nun mit der musikalischen Biografie zu tun? In der musikalischen Biografie sind häufig Copings enthalten. Das Hören von Musik und das Musizieren können zu zentralen Bestandteilen einer Bewältigungsstrategie werden. Vertraut wird vielen die wichtige Rolle sein, die die Musik in der Pubertät und der darauf folgenden Ablösung vom Elternhaus spielt. Die eigene Musik, die eigene Musikrichtung und -vorliebe, steht als Symbol für das Erwachsenwerden, für die Eigenständigkeit. Sie steht für das Anderssein als die Eltern, die Erwachsenen.
Welch lebensrettende Bedeutung das Musizieren für einen Menschen haben kann, illustriert das Leben von Anton, in der DDR stramm erzogen, stramm groß geworden. Auf die Partei wurde gehört, nicht auf ihn. Also spielte er Violine, allein. Die Violine wurde seine Stimme. Dann, als er Anfang 20 war, zog er weg. Er heiratete in den Westen, ins Schwäbische. Aus Anton wurde Toni. Doch er merkte, auch in dieser Welt wurde er nicht gehört: fremde Welt, fremde Sprache, fremdes Denken. Und Krach mit dem Schwiegervater. Und wieder spielte er Musik. Diesmal Gitarre, klassische Gitarre.
Erste Auftritte folgten. Erst klassisch, dann Folk-Musik, dann eigene Lieder, mit Violine und Gitarre. Doch irgendwie war alles zu leise, also griff er zur E-Gitarre. Lauter. Hörbarer.
Die Ehe und das Schwäbische wurden unaushaltbar. Also floh er nach Berlin und in die Musik. Nun gab es nur noch Musik, Musik, Musik. Vergessen in der Musik, Leben in der Musik, genauer: im Musizieren. Zwei Jahre lang ging er auf Tournee, mit Violine, mit klassischer Gitarre, mit E-Gitarre. Leise und laut. Er lebte im Musizieren. Ruhelos. Einen Abend mit ihm zu verbringen bedeutete, durch zehn Kneipen zu ziehen. Auch sein Gewicht wurde ruhelos, die Kilos gingen rauf und runter, die Beziehungen waren genauso ruhelos, gingen rauf und runter. Keine Bindung. Kein Zuhörenkönnen. Ein Asteroid, der immer schrecklicher um das eigene Verlorensein kreist.
Außer, wenn er musiziert. Dann ist er eins mit dem Instrument, mit der Musik. Dann klingt die Verzweiflung, die Einsamkeit, die Trauer, dann tönt das verlorene Schwäbische, dann füllt die Hoffnung den Raum, dann wird zwischendurch der kleine Junge hörbar, pfeifend, froh und zart. Immer, wenn das geschieht, fordert er die ZuhörerInnen auf mitzupfeifen. Und wenn sie pfeifen, lächelt er.
Nicht lange. Dann legt er wieder los, dann kreischt die Verzweiflung aus der E-Gitarre, verbissen, verloren. In der Musik, im Musizieren kämpft er ums Überleben.
Musik sei sein Leben, sagt er. Und er meint es wörtlich.
Solche Geschichten begegnen uns in der Therapie gar nicht so selten, vor allem, wenn wir TherapeutInnen uns trauen, nach musikalischen Lebensgeschichten zu fragen, die häufig erst einmal nicht so deutlich hörbar werden. Für viele Menschen war das Musikhören und das Musizieren überlebenswichtig. Eine Frau erzählt, dass sie sich immer, wenn die Atmosphäre zu terroristisch wurde, in einen Verschlag zurückgezogen und geflötet hat. Eine andere Frau berichtet, dass sie den Tod der Mutter „am Klavier betrauert“ hat. Wenn der Schmerz und die Trauer sie zu überwältigen drohten, spielte sie stundenlang auf dem Klavier, bis ihr „etwas leichter ums Herz wurde“.
Vielen KlientInnen tut es gut, wenn sie in der Therapie verstehen, welche Bedeutung die Musik für ihre persönliche Entwicklung und die Bewältigung von Krisen hatte. Es hilft ihnen, sich zu verstehen, um das Musizieren und Musikhören auch in Zukunft zu nutzen. Sie können überprüfen, ob das Musizieren reicht oder ob sie andere Bewältigungsstrategien einschlagen müssen.
Читать дальше