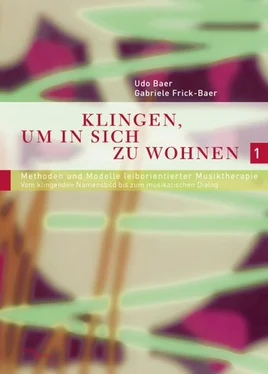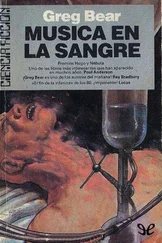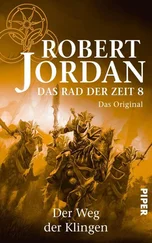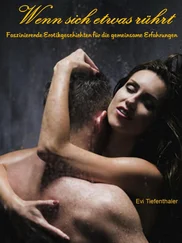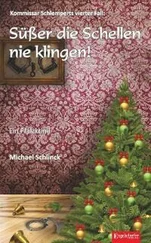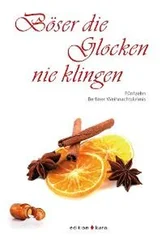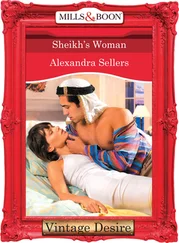Nach etwa 15 – 20 Minuten:
„Sucht und findet bitte den Platz, an dem ihr für einige Momente euer Erleben nachklingen lassen könnt … Sinniert noch einmal darüber nach, welche Stationen, welche Erfahrungen euch während eurer Reise wichtig geworden sind. Vielleicht hat euch etwas überrascht, vielleicht war etwas neu oder vertraut oder vergessen oder fremd … Und drückt diese Erfahrung, dieses Erleben in einem Ton oder Klang aus.“
Hier sollte sich wie üblich ein Austausch in der Gruppe oder mit Therapeutin oder Therapeut anschließen, in dem auch die zuletzt gefundenen Töne bzw. Klänge vorgespielt werden. Wichtig sind Fragen wie: „Was hast du während des ganzen Prozesses erlebt? Was hast du über dich und dein Leben, insbesondere deine musikalische Biografie erfahren?“ Und: „Was hat sich während dieses Prozesses verändert?“
Den Weg durch die Räume kann man musikalisch gestalten. Dies geht in Gruppen nur nacheinander, da bei einer gleichzeitigen Aktion der Einfluss der anderen so groß wäre, dass das Eigene, Besondere, auf das es uns besonders ankommt, zu kurz käme. Sehr geeignet ist diese Variante in der Einzelarbeit. Die Räume werden wie beschrieben gestaltet und beschritten. Dann wird die Klientin, der Klient aufgefordert:
„Suche dir bitte Instrumente oder andere Gegenstände, die Klänge erzeugen, und gib ihnen einen Platz in diesem Raum, der zu deiner musikalischen Biografie passt … Und dann spiele dich durch deinen Instrumentenparcours, auf deine eigene Art und Weise, auf deinem eigenen Weg. Spiele und höre dir selbst zu …“
Hier gilt es, im verbalen Austausch anschließend vor allem der Frage nachzugehen, was sich während des Prozesses wodurch verändert hat. Eine weitere Variante kann darin bestehen, dass die KlientInnen vorher aufgefordert werden, Objekte ihrer musikalischen Biografie mitzubringen. Das können wie vorhin Instrumente sein oder alte Schallplatten, Noten, der uralte Kassettenrecorder, dies und jenes, was mit der musikalischen Biografie zusammenhängt. In jedem Fall ist es wichtig, die KlientInnen aufzufordern, in der aktuellen therapeutischen Situation den Parcours durch Instrumente zu ergänzen, die aktuell dazu passen. Auch dieser Parcours sollte, wenn möglich, musikalisch „durchgespielt“ und räumlich erlebt werden.
Der therapeutische Weg zur „Komposition“ einer biografischen Filmmusik beginnt mit einer Variante der eben vorgestellten Panorama-Methode. Wie beschrieben, werden ein Beobachtungs- bzw. „neutraler“ Raum sowie ein großer Raum der musikalischen Biografie geschaffen.
„Geht durch den Raum und findet dabei den Platz, den ihr als Ausgangspunkt eurer musikalischen Lebensgeschichte bezeichnen möchtet … Wenn ihr ihn gefunden habt, haltet einen Moment an diesem Platz inne …
Sucht von diesem Platz aus die Stelle im Raum, wo das Hier und Jetzt, euer gegenwärtiges Leben und Erleben seinen Ort haben könnte. Wählt diesen Ort noch ganz unabhängig davon, wie der Weg dazwischen aussehen könnte.
Nachdem ihr diese beiden Entscheidungen getroffen habt, erzähle ich euch, wozu ich euch im weiteren anleiten möchte. Ich werde euch bitten, eure musikalische Lebensgeschichte durchzugehen, diesmal als Weg durch den Raum. Ich werde euch begleiten, indem ich immer wieder Lebensabschnitte nennen werde, um euch Anhaltspunkte zu geben. Wenn euch das gerade zu schnell oder zu langsam geht, wenn euch andere Zeiteinteilungen sinnvoller erscheinen, dann nehmt euch ernster als meine Anregungen. Für euren Weg durch die musikalische Lebensgeschichte bitte ich euch, immer wieder euren Einfällen, Empfindungen, Gefühlen und Gedanken Aufmerksamkeit zu schenken.
Bevor ihr vom Ausgangspunkt losgeht, sucht euch einen Platz, der zeitlich und örtlich davor liegt … Was war vor dem Beginn deiner musikalischen Lebensgeschichte? Was haben deine Vorfahren mitgebracht? … Welche musikalischen Traditionen gab es in deiner Familie? … Was wurde dir in die Wiege gelegt?
Geht nun in eurer Art und in eurem Tempo in eure Kindheit hinein, in die ersten Abschnitte eurer musikalischen Lebensgeschichte. Folgt euren Einfällen, der Weg wird sich von allein entwickeln …Was fällt euch ein zu euren ersten Lebensjahren? Oder was habt ihr von anderen über euch gehört? Habt ihr viel geschrieen oder eher wenig? Wart ihr laut oder eher still, unruhig oder ruhig, temperamentvoll oder eher zurückhaltend? … Was fällt euch ein zum Kindergartenalter? … zur Schule … zur Pubertät … zum Erwachsenwerden … zum Erwachsensein … zum Singen … zum Musikhören … zum Musikspielen … zu heute … ?
Wenn ihr am Ort des Hier und Jetzt eurer musikalischen Lebensgeschichte angekommen seid, haltet dort inne. Überprüft, ob dieser Platz jetzt stimmt. Wenn ja, dann bleibt dort, wenn nicht, sucht euch einen anderen Ort, der jetzt angemessen ist.
Sucht und findet an diesem Platz eine Haltung im Stehen, Sitzen oder Liegen, in der ihr gut in euch hineinhören könnt.
Schließt, wenn ihr mögt, die Augen, atmet gut und lasst das, was ihr vorhin erlebt habt, noch einmal wie in einem Musikfilm in euch ablaufen. Hört der Musik, die den Film eurer musikalischen Lebensgeschichte begleitet, gut zu.“ 10 Minuten Zeit lassen!
„Welche Szene, welche Musik steht jetzt im Vordergrund eures Hörens und Erlebens? Was bewegt euch am meisten? Schenkt dieser Szene und dieser Musik eure ganze Aufmerksamkeit …
Wie geht es euch jetzt? Was erlebt ihr nun? Musiziert es so, dass sich das Bewegendste aus der Filmmusik zu eurer Lebensgeschichte in einer Ouvertüre, einem musikalischen Schlüsselthema oder einer musikalischen Schlüsselszene verdichtet.“
Ein Mann kommt in die Therapie, „irgendwie ärgerlich“, den Zorn aber kaum spürend, nur „mit angezogener Handbremse“. „Es grummelt in mir. Aber ich weiß nicht, worüber. Seit zwei Tagen komme ich mir wie in einem Käfig vor, wie ein Tier im Zoo, das hin und her läuft. Und ich weiß nicht, warum.“ Der Therapeut fragt, aus welchen Zeiten er sich so kenne, wann er sich so schon einmal erlebt habe.
„Das passiert mir öfters, aber meistens nur kurz, es kommt und geht wieder. So stark wie jetzt kenne ich das nur aus meiner Jugendzeit. Da bin ich auch in meinem Zimmer immer hin und her gelaufen, war ärgerlich und fühlte mich gefangen.“
„Welche Musikstücke haben Sie damals gehört? Oder haben Sie selbst Musik gespielt?“
„Gespielt habe ich leider nicht, aber gehört habe ich viel, zumeist Rock und Blues und auch ein bisschen Jazz. Meistens im Radio beim britischen Soldatensender BFBS. Davon habe ich mir die besten Sachen auf einem Tonbandgerät aufgenommen. Einen Schallplattenspieler hatten wir nicht.“
„Welche Musik haben Sie gehört, wenn Sie so hin und her tigerten und mit angezogener Handbremse ärgerlich waren?“
„Alles Mögliche. Aber am besten hat mir ‚Paint it black’ von den Stones gefallen“, sagt er und dabei beginnt sein Gesicht freudig zu strahlen, „das hat mir richtig gut getan. Ich habe den Text damals nicht verstanden, aber mir immer vorgestellt, dass ‚Paint it black’ bedeutet, alles um mich herum schwarz zu malen, den ganzen Kitsch schwarz anzustreichen, die spießige Unehrlichkeit schwarz anzustreichen, das Duckmäusertum. Die Stones haben für mich ihren Ärger und ihren Zorn herausgeschrieen.“
„Wie geht es Ihnen jetzt, wenn Sie sich daran erinnern und davon erzählen?“
„Oh, jetzt merke ich wieder meinen Zorn. Ich höre die Nummer der Stones innerlich. Sie finden die Worte und die Musik für meinen Zorn. Und ich weiß jetzt auch, was mich zur Zeit zornig macht: Ich hasse diese feigen Hunde an meinem Arbeitsplatz. Immer, wenn ich mal den Mund aufmache, lassen die mich im Regen stehen …“ Er erzählt und erzählt, ärgerlich, aufgeregt, zornig, klar und deutlich – nichts mehr ist von dem Diffusen, von der angezogenen Handbremse zu sehen und zu hören, mit der er in die Therapie gekommen war. Er gestikuliert und seine Beine zucken. Der Therapeut bittet den Klienten aufzustehen, während er erzählt. Er tut es gerne und läuft hin und her. Auch sein körperlicher Ausdruck wird freier.
Читать дальше