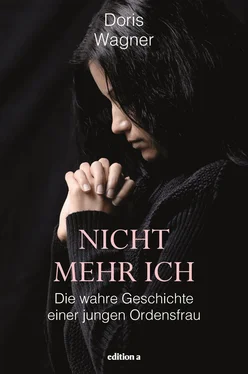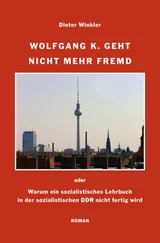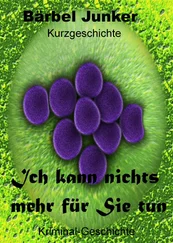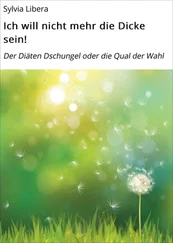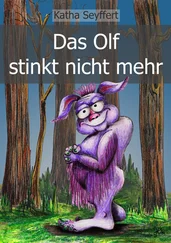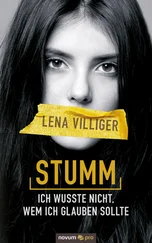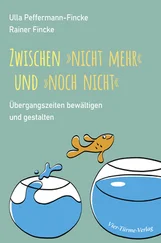Der folgende Lebensbericht macht in schonungsloser Klarheit deutlich: In der Kirche beanspruchen Denk- und Lebensweisen Geltung, die dem widersprechen. Deswegen verdient er höchste Beachtung, fordert er faire Auseinandersetzung mit dem System, ermutigt er dringend zur Korrektur. Es geht darum, eine genuin christentumsförmige neue geistliche Bewegung zu schaffen, hin zu den Ursprüngen und von dort zur effektiven Verwirklichung der Freiheitsbotschaft des christlichen Evangeliums. Solches Werk hat die Kirche, hat die Welt in der Tat nötig.
Prof. Dr. Wolfgang Beinert ist katholischer Priester,
emeritierter Hochschullehrer und Publizist.
„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder
getan habt, das habt ihr mir getan.
Was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan
habt, das habt ihr auch mir nicht getan.“
Mt 25,40.45
„Wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne
Kleidung ist und ohne das tägliche Brot
und einer von euch zu ihnen sagt:
Geht in Frieden, wärmt und sättigt euch!
Ihr gebt ihnen aber nicht,
was sie zum Leben brauchen – was nützt das?“
Jak 2,15-16
1. DAS ROTE KREUZ
Die Kindheit
Ich wollte ins Kloster, seit ich 15 war. Diese Entscheidung war für mich beinahe natürlich, denn ich hatte den Glauben gewissermaßen mit der Muttermilch aufgesogen. Er war die alles bestimmende Größe in meinem Leben, wie er es im Leben meiner Eltern war. Sie waren überzeugte Lutheraner und brauchten den Glauben zum Leben wie die Luft zum Atmen, denn sie hatten so viel Not zu ertragen, dass sie wohl daran zerbrochen wären, wenn sie nicht gewusst hätten, dass Gott diese Last mit ihnen trägt. Gott war immer da, und sie konnten ihn bitten, ihnen Kraft zu geben oder Rat – manches Mal auch Geld. Er war ihre Hoffnung und ihr Trost. Deswegen hatte ihr Glauben auch nichts Aufgesetztes und Unbehagliches. Er war völlig authentisch. Er bestand auch in den Augen von uns Kindern nicht aus lästigen Pflichten und unliebsamen Erziehungsmaßnahmen, sondern er war der unsichtbare Hintergrund, der das tägliche Leben mit einer unzerstörbaren Schutzhülle umgab. Gott war da, um uns zu beschützen und für uns zu sorgen. Er war wie der gute Hirte hinter dem Eingang in der Kirche, der ein verletztes kleines Lamm behutsam auf seinen Schultern trägt.
Mein Vater arbeitete als Dreher, obwohl er in seiner Jugend gerne das Gymnasium besucht und Theologie studiert hätte. Wenn er sich abends nach getaner Arbeit an den Küchentisch setzte und Psalmen las, spürte ich, dass sich diese Worte wie Balsam auf seine zermürbte Seele legten. Es war ein heiliger Augenblick. Gottes Gegenwart wurde greifbar, hier in unserer kleinen Küche. Fast jeden Abend saß er so, sorgenschwer und doch getröstet, über das Buch gebeugt, in dessen dünnen Seiten er mit seinen von der Arbeit schwieligen Händen blätterte. Die aufgeschlagene Seite hielt er dicht vor seine kurzsichtigen Augen, wobei er die zum Lesen ungeeignete Brille in die Stirn schob. Oft nahm er dabei eines seiner Kinder auf den Schoß und las laut vor. Mir wurde sehr feierlich zumute bei diesen schwer verständlichen und darum umso mächtigeren Worten, mit denen die Widersacher Gottes verflucht und die Frommen gesegnet wurden. Und ich empfand vage, dass mein Vater wie der Psalmist in Not war, von unheimlichen Feinden bedrängt, und dass Gott ihn schützen musste, ihn und uns alle, vor bösen Menschen und dem grausamen Schicksal. Und wenn dann die jubelnden und glücklichen Verse folgten, war ich selig über das Siegeslied der Gerechten, die Gott lobten und ihm dankten, weil er ihnen so wunderbar geholfen hatte. Und ich wusste: Solange Gott da war, konnte uns nichts geschehen.
Der Glaube an Gott war mir darum heilig, und ich reagierte empfindlich, wenn er infrage gestellt wurde. Als ich in den Kindergarten kam, stellte ich fest, dass nicht alle Kinder an Gott glaubten. Jedenfalls schien es mir so, denn sie hatten andere Helden als ich. Ich erinnere mich lebhaft daran, wie ich einmal einen Jungen, der ein begeisterter Batman-Verehrer war, zu überzeugen versuchte, dass der Herr Jesus viel mächtiger sei als Batman und dass Batman ihm im Notfall nicht helfen könnte, weil es ihn gar nicht wirklich gibt.
Auf die Spitze getrieben wurde meine kindliche Empörung aber immer dann, wenn der Glaube zur Freizeitgestaltung degradiert wurde. Als wir in der Grundschule zur Kinder-Bibel-Woche gingen und dort ein Zauberkünstler auftrat, der im Handumdrehen drei verschiedenlange Seile in gleichlange verwandelte und uns dabei erklärte, dass es vor Gott keine kleinen und großen Sünden gäbe, sondern alle gleich groß wären, war ich dermaßen entrüstet, dass ich den Saal verließ. Erstens war es falsch, was er gesagt hatte, denn es gab sehr wohl Sünden, die schwerer wogen als andere. Zweitens steht in der Bibel, dass man nicht zaubern darf, und drittens – was am schwersten wog – hatte er die religiöse Deutung nur vorgeschoben, um seinen Trick vorführen zu können. Dieser oberflächliche Umgang mit dem Glauben verletzte mich sehr. Ich litt darunter, weil er ja der Schutzwall meiner kindlichen Geborgenheit war. Also musste es ernst sein mit dem Glauben, und dann musste man ihn auch ernst nehmen. Und wenn es nicht ernst wäre, dann hätte es schlicht keinen Sinn zu glauben, und man könnte es gleich ganz bleiben lassen. Den Glauben aber als eine Art Hobby zu pflegen, kam mir wie ein Verrat vor.
Bei aller Frömmigkeit, kannte mein Leben aber auch andere Seiten. Ich besaß beispielsweise keinen großen Schuleifer und neigte dazu, keine Hausaufgaben zu machen. Viel lieber verbrachte ich die Nachmittage mit meinen Geschwistern im Freibad. Zudem hatte ich in meiner Grundschulzeit eine Freundin, mit der ich viel Unsinn anstellte, Süßigkeiten stahl, in fremde Scheunen und Keller eindrang und anderes mehr.
Als ich aufs Gymnasium kam, musste ich mit dem schrecklichen Unfall meines Vaters fertigwerden, der im Januar 1995 von einem betrunkenen Lastwagenfahrer beinahe totgefahren worden war. Damals war ich elf und wurde mit meinen Geschwistern jäh aus der heimeligen Routine unseres Familienlebens herausgerissen. In der Folge mussten wir vieles aushalten, was unsere so fragile und kostbare Kindheitsatmosphäre bedrohte. So richtig erholt haben wir uns davon nie.
Um mir einen neuen Schutzraum zu suchen, machte ich die Schule ein Stück weit zu meinem Zuhause. Ich begann, mich wohl zu fühlen in dieser Welt, in der mir mühelos so vieles gelang. Latein, Englisch und Geschichte zählten zu meinen Lieblingsfächern, während ich Mathematik und Physik nicht schätzte, weil sie mir die süßen Früchte des Erfolgs versagten, wenn ich ihnen nicht meine Nachmittage opferte. Ich las auch sehr viel, wobei die frommen Bücher, die mir meinen Eltern zum Geburtstag schenkten, ab meinem 13. Lebensjahr in den Hintergrund traten und zunächst von Hermann Hesse abgelöst wurden. Ich las »Das Glasperlenspiel«, das ich im Schrank meiner Eltern fand, den »Steppenwolf« und dann alles was ich von Hesse in die Finger bekommen konnte. Zugleich las ich Gedichte von Rilke und lernte einige von ihnen auswendig. Mir eröffnete sich eine neue romantische Welt voller merkwürdiger Bilder und Gedanken, die sich kaum mit der religiösen Welt meiner Kindheit in Einklang bringen ließen, aber die mich faszinierten, weil ich meinte, mich darin wiederzuerkennen. Ich verbrachte so viel Zeit wie möglich damit, diesen Gedanken nachzuhängen. Dabei war ich am liebsten für mich allein. Die köstlichsten Stunden verbrachte ich am Klavier, mit Chopin, Debussy oder Tschaikowsky, in deren Stücken ich mich verlieren und alle angestauten Gefühle, Sehnsüchte und Phantasien ausleben konnte. Es zog mich auch hinaus auf einsame Feld- und Waldwege, wo ich stundenlang unterwegs war und versteckte Geheimplätze regelmäßig aufsuchte. Diese einsamen Waldspaziergänge ließen mich innerlich zur Ruhe kommen. Als meine Altersgenossen anfingen, sich für das andere Geschlecht zu interessieren, wurde mir klar, dass ich eine ganz andere Einstellung hatte als sie. Liebe war für mich eine ernste Angelegenheit, mindestens so ernst wie die Religion. Zwar verliebte ich mich auch das eine oder andere Mal. Aber ich betrachtete diesen merkwürdigen Zustand immer als einen ärgerlichen Zwischenfall, den ich bestenfalls als eine Art psychologischen Selbstversuch interessant finden konnte. Mein eigentliches Interesse galt nicht der Verliebtheit, sondern der Liebe oder dem, was ich mir darunter vorstellte: eine Macht, die zwei für einander bestimmte Menschen für immer zu verbinden vermag, auf Gedeih und Verderb. Das war kein Gefühlsanflug, es war Schicksal, ernst und mächtig, und weniger als das konnte ich nicht wollen. Deswegen stand ich dem pubertären Beziehungstreiben meiner Altersgenossen mit einer gewissen Ratlosigkeit gegenüber. Mir schien ihr Verhalten kindisch und selbstverletzend, in jedem Fall schreckte es mich ab. Ihre Beziehungsgeschichten verfolgte ich abwechselnd mitleidig und belustigt. Wenn ich einmal lieben werde, dachte ich, dann ganz anders.
Читать дальше