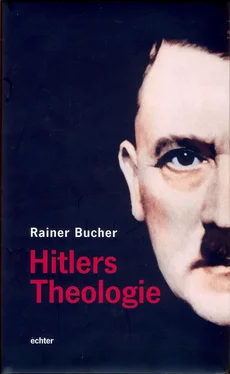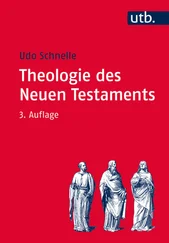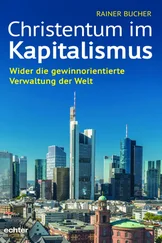Hitlers ideologische Gebundenheit an die rassistisch legitimierte Volksgemeinschaftsideologie ist dabei derart massiv, dass er universalistische Konzepte noch im Angesicht seiner eigenen totalen Niederlage gegen die westlichen Demokratien und die kommunistische Sowjetunion für handlungsunfähig erklärt. Wenn „Universalisten, Idealisten und Utopisten“ letztlich nichts anderes als Unerreichbares versprechen können, so Hitler, müssen sie auch notwendig im Spalt zwischen „Wort“ und realer Tat stecken bleiben. Denn ihr Handeln bleibe nicht nur gelegentlich, sondern prinzipiell hinter ihren eigenen Worten zurück. Zumal, wie Hitler sehr genau sieht, universalistische Konzepte dann doch nur partielle soziale Räume belegen können und so ihren universalistischen Anspruch in der Begrenztheit ihrer eigenen sozialen Existenz selbst zu dementieren scheinen. Hitler war sich der konkreten Partikularität religiöser und/oder weltanschaulicher Geltungsansprüche sehr bewusst. Durchgängig wirft Hitler dem Christentum vor, einen allgemeinen und universalistischen Anspruch zu erheben, also Aussagen über alle Menschen und für alle Menschen zu machen, aber doch immer nur eine historisch und geographisch beschränkte Partikularität zu erreichen.
So etwa in einem Tischgespräch am 27.2.1942: „Warum gibt Gott den Menschen nicht die Möglichkeit, alle zur richtigen Vorstellung zu kommen? Horizontal gesehen, wissen die Gebildeten heute, daß die Gottesvorstellung des Katholizismus noch nicht einmal zehn Prozent der Menschheit hinter sich hat. Im gleichen Zeitraum haben die von der gleichen Vorsehung geschaffenen Menschen tausenderlei verschiedenen Glauben. Wir sehen die Dinge heute aber auch vertikal: Wir wissen, daß dieses Christentum nur eine ganz kurze Epoche der Menschheit umfaßt.“ 38Und nicht ohne Hohn stellt Hitler im erwähnten „Politischen Testament“ denn auch fest, dass „der ganze Erfolg der bewunderten christlichen Mission, deren Künder die göttliche Wahrheit für sich allein in Erbpacht genommen haben“, nur einige „winzige Farbflecke als Inselchen der Christenheit, und auch diese mehr dem Namen nach“ ausmache. 39
Die regional begrenzte Bedeutsamkeit und die damit verbundene soziale Verkapselung der Konfessionen gerade in Deutschland stehen für Hitler in unübersehbarem Gegensatz zur für ihn einzig – politisch wie „wissenschaftlich“ – möglichen Handlungsbasis: der rassisch geeinten Volksgemeinschaft. „Unser Volk ist nicht von Gott geschaffen, um von Priestern zerrissen zu werden“, so Hitler in einer Rede vor Gauleitern bei der Einweihung der Ordensburg in Sonthofen am 23.11.1937. „Daher ist es notwendig, seine Einheit durch ein System der Führung sicherzustellen. Das ist die Aufgabe der NSDAP. Sie soll jenen Orden daher stellen, der, über Zeit und Menschen hinwegreichend, die Stabilität der deutschen Willensbildung und damit der politischen Führung garantiert.“ 40„Heute vollzieht sich“, so Hitler in dieser Rede weiter, „eine neue Staatsgründung, deren Eigenart es ist, daß sie nicht im Christentum, nicht im Staatsgedanken ihre Grundlagen sieht, sondern in der geschlossenen Volksgemeinschaft das Primäre sieht. Es ist daher entscheidend, daß das ‚Germanische Reich Deutscher Nation‘ diesen tragfähigsten Gedanken der Zukunft nun verwirklicht, unbarmherzig gegen alle Widersacher, gegen alle religiöse Zersplitterung, gegen alle parteimäßige Zersplitterung.“ 41
Dieser Kampf gegen die „konfessionelle Zersplitterung“ Deutschlands ist für Hitler nicht nur rein taktisch motiviert, sondern gründet unmittelbar in seiner rassistischen Anschauung vom unerbittlichen Kampf der Rassen gegeneinander und von der Auserwählung der Deutschen als Teil der arischen Rasse. Hitler fordert denn auch in der Konsequenz der oben analysierten „Wort“-„Tat“-Dichotomie von seinen Anhängern die Reinterpretation ihrer Konfessionsmitgliedschaft in rassistischen Handlungskategorien. „Gerade der völkisch Eingestellte hätte“, so Hitler in „Mein Kampf“, „die heiligste Verpflichtung, jeder in seiner eigenen Konfession, dafür zu sorgen, daß man nicht nur immer äußerlich von Gottes Willen redet, sondern auch tatsächlich Gottes Willen erfülle und Gottes Werk nicht schänden lasse .“ 42Bereits in „Mein Kampf“ hatte Hitler auch in jenen, „die heute die völkische Bewegung in die Krise religiöser Streitigkeiten hineinziehen, schlimmere Feinde meines Volkes“ gesehen „als im nächst besten international eingestellten Kommunisten“ 43. Denn „jüdisches Interesse“ sei es heute, „die völkische Bewegung in dem Augenblick in einem religiösen Kampf verbluten zu lassen, in dem sie beginnt, für den Juden eine Gefahr zu werden“ 44.
Totaler Anspruch, Dogmatisierung und Normierung des Diffusen sowie 2000-jährige Organisationsklugheit: So lässt sich zusammenfassen, was Hitler an den christlichen Kirchen analysiert und durchaus bewundert. All dies ist formaler Natur. Hitlers inhaltliche Kritik gilt der materialen Verkündigung der Kirchen, deren Entplausibilisierung durch die modernen (Natur)Wissenschaften für ihn feststeht.
Doch Hitlers Kritik geht über diese szientistische Trivialargumentation hinaus. Denn die Unvereinbarkeit der christlichen Verkündigungsinhalte mit dem „modernen Bewußtsein“ schlägt für Hitler nicht nur auf deren Plausibilität im Bewusstsein der Einzelnen zurück, sondern auch auf die Möglichkeit der Konstitution von Kirche als handlungsfähigem sozialem Organismus. Nach wie vor sieht Hitler in der christlichen Verkündigung ein universalistisches Konzept am Werk. Dieses aber bleibt für Hitler handlungsunfähig. Es zielt für ihn „ins Nichts“, da es zu keiner Konkretion fähig sei, ohne darin den eigenen universalistischen Anspruch implizit zu verraten. Christliche Konzepte würden permanent zwischen dem eigenen Anspruch, dem ins Ganze zielenden „Wort“, und dem eigenen Handeln, der dann weit hinter dem eigenen Anspruch zurückbleibenden „Tat“, zerrieben.
Die Kirchen retteten sich dann notgedrungen einerseits in einen Intellektualismus des Wortes, andererseits in eine Form bloß partikulärer Konstitution, die ihre eigene konfessionelle und regionale Partikularität vor sich selbst verschleiern muss. Es fällt nicht schwer, diese beiden Varianten mit den Gefährdungen der beiden großen christlichen Konfessionen zu parallelisieren.
Auf dieser implizit selbstwidersprüchlichen Basis aber ist für Hitler die Schaffung einer handlungsfähigen sozialen Organisation unter den Bedingungen der Moderne nicht möglich. Hitlers Ausweg ist ebenso schlicht wie effektiv: Der grundsätzliche Abschied vom Universalismus beseitigt das typisch moderne Problem der Kluft von universalem Anspruch und bloß regionaler Plausibilität. „Wort“ und „Tat“, universeller Anspruch und historisch-kontingente Realität bleiben so vermittelbar.
Erst wenn man sich vom Universalismus befreit, wie es Hitler mit dem Ideologem der Volksgemeinschaft tut, dann, so Hitler, ist es möglich, eine handlungsmächtige Weltanschauungsinstitution unter den Bedingungen der Moderne zu schaffen. Denn dann erst ist es möglich, die plausibilitätszerstörende Kluft von Anspruch und Wirklichkeit im Bewusstsein der Einzelnen zu überwinden, insofern man dem „Wort“, also der „Verkündigung“ der Weltanschauung, auch eine identifizierbare und realistische soziale Basis verleiht. Wenn dies, wie bei Hitler, auch noch unter Rückgriff auf die sozialdarwinistische Interpretation biologischer Theorien geschieht und sich also mit „wissenschaftlicher“ Legitimation versehen kann 45, dann ist die Anschlussfähigkeit an die Moderne sichergestellt.
Hitler sieht im Totalisierungs-, aber auch im Normierungs- und Konkretisierungspotential der kirchlichen Verkündigung deren herausragende Leistung, deren existenzgefährdende Schwäche aber erkennt er zum einen in der veralteten kirchlichen „Weltanschauung“, zum anderen aber in der notwendigen Kluft von „Wort“ und „Tat“.
Читать дальше