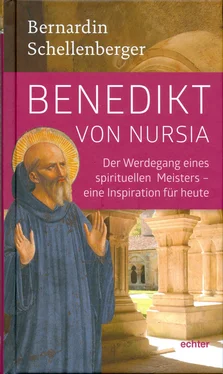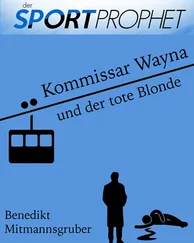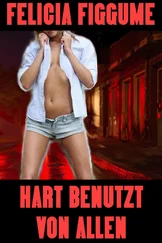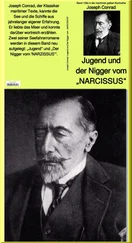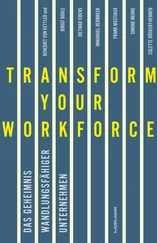Die Welt kam ihm blutlos, also wie eine „verdorrte Blume“ vor, der Wissenschaftsbetrieb hohl und verhängnisvoll. Aus diesem Grund ging er auf radikalen Abstand dazu (wofür noch einmal der Begriff despicere verwendet wird): Das sind zunächst seine grundlegenden Motive – also derart allgemeine Beweggründe, wie sie auch ein nicht besonders religiös veranlagter Mensch nachvollziehen kann. Es ist die Sehnsucht nach etwas, „das mehr als das alles“ ist. Dieses „mehr als das alles“ benennt Gregor schließlich religiös: Benedikt habe „begehrt, einzig Gott zu gefallen“ (soli Deo placere desiderans) .
Wenn diese Sehnsucht vehement im Menschen aufbricht, ist er imstande, vieles Bisherige aufzugeben und auf die Suche zu gehen. Das war bei Benedikt der Fall, und so zog sich der junge Student eines Tages wissend ins Nichtwissen und weise ins Ungelehrtsein zurück (recessit igitur scienter nescius et sapienter indoctus) .
Die lateinische Sprache der Bibel, die Meditation und der Name „Benedictus“
Als Helden seiner Erzählung stellt Gregor der Große einen jungen Mann vor, der Benedictus hieß, und zwar gleich im ersten Satz seiner Lebensbeschreibung. Das entspricht dem antiken Brauch (wie er heute noch in päpstlichen Enzykliken fortlebt), mit den Anfangsworten das Thema oder den Kern des gesamten folgenden Schreibens oder Buchs anzukündigen.
Dieser Name ist alles andere als zufällig.
Dazu muss hier kurz erläutert werden, dass die Bibel seit ungefähr dem 4. Jahrhundert im Abendland immer mehr auf Lateinisch verwendet wurde. Die Gesamtübersetzung von Hieronymus († 420), die als Vulgata („die allgemein übliche“) bekannt wurde, setzte sich durch und war bis zur Reformation im 16. Jahrhundert allgemein in Gebrauch. Die Leser, für die Gregor schrieb, nämlich die Mönche und des Lesens (natürlich auf Latein) kundigen Kleriker, waren mit dem Wortlaut der lateinischen Bibel auf eine uns heute unvorstellbare Weise vertraut. Schließlich war die Bibel der hauptsächlichste Text, mit dem sie sich ständig befassten. Sehr viel mehr andere Texte hatten sie gar nicht zur Verfügung; es war ein verschwindend kleiner Bruchteil dessen, womit wir heute tagtäglich „zugetextet“ werden.
Entsprechend besser und genauer blieb dieses Wenige im Gedächtnis haften. Die Mönche hatten in ihren langen täglichen Stundengebeten immer Bibelworte im Mund und hörten vorwiegend biblische Lesungen oder Auslegungen und Paraphrasen der Bibel; viele kannten lange Passagen daraus oder sogar ganze Bücher auswendig. Der ägyptische Mönchsvater Pachomius († 347) hatte in seiner Klosterordnung angeordnet: „Keiner sei im Kloster, der nicht das Lesen und Schreiben lernt. Jeder soll zudem einiges aus der Heiligen Schrift auswendig können: wenigstens (!) das Neue Testament und den Psalter.“ 8
Für diese Mönche bestand die vorwiegende „Methode“ der „Meditation“ darin, Bibeltexte zu murmeln (meditari) , wie es schon im Judentum Tradition gewesen war und ist: os iusti meditabitur sapientiam („der Mund des Gerechten bewegt Worte der Weisheit“), heißt es in Psalm 37,30; und in Psalm 1,2 steht die Empfehlung: „Wohl dem, der Lust hat zum Gesetz des Herrn und seine Weisung murmelt bei Tag und bei Nacht“ (… et in lege eius meditabitur die ac nocte) .
Gleiche Formulierungen weckten Assoziationen, luden zu Gedankenverbindungen ein, knüpften Zusammenhänge. Damit spielten die Autoren bis ins Mittelalter. Heutigen Lesern entgeht das so gut wie ganz. Deshalb wird im Folgenden immer wieder einmal ein lateinischer Wortlaut genauer erschlossen werden.
Was einem sonst entgehen kann, zeigen bereits die ersten Worte der Lebensbeschreibung des heiligen Benedikt: Fuit vir vitae venerabilis, gratia Benedictus et nomine … (wörtlich übersetzt: „Es war ein Mann ehrwürdigen Lebens, seiner Begnadung und seinem Namen nach ein Gesegneter“).
Beim Lesen des gratia Benedictus et nomine kam dem Bibelkundigen im 6. Jahrhundert und noch bis ins Mittelalter unwillkürlich die Stelle Genesis 12,2–3 in den Sinn, ein kunstvolles Wortspiel mit dem Begriff benedictus: … magnificabo nomen tuum erisque benedictus. Benedicam benedicentibus tibi et maledicam maledicentibus tibi atque in te benedicentur universae cognationes terrae („… ich werde deinen Namen groß machen und du wirst ein Gesegneter sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir werden gesegnet sein alle [deine] Verwandtschaften auf Erden.“
Als spontane Assoziation für „Benedikt“ stellte sich also unverzüglich die Gestalt Abrahams ein, des biblischen Stammvaters.
Manche kritische Autoren vermuten sogar, es handle sich bei der Namensgebung „Benedictus“ um eine literarische Erfindung. Abgesehen von Gregors Biografie sei nämlich der Mann, der als Stammvater aller Mönche des Abendlands gilt und nach dem man deren Regel benannt hat, völlig unbekannt und mit nichts historisch zu belegen.
Auch wenn man eine derart scharfe Skepsis nicht teilen mag, kann man staunen, wie treffsicher dieser Name das erfasst, worum es in der ganzen Darstellung Gregors geht: anhand der Urmodelle Abraham und Benedikt (konnte der Stammvater der abendländischen Mönche historisch „rein zufällig“ so heißen?) sozusagen den archetypischen Verlauf der Berufung des Menschen durch Gott aufzuzeigen.
An Abraham ergeht unvermittelt der Ruf: „Geh fort von deinem Land, deiner Verwandtschaft und vom Haus deines Vaters und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde! Ich werde dich zu einem großen Volk machen“ (Gen 12,1). Das ist der entscheidende Schritt, von dem oben bereits die Rede war.
Wie beschrieben, schildert Gregor in seinem Text, dass Benedikt genau das Gleiche tut und infolge seines Auszugs aus der Welt „ein großes Volk“ von Mönchen entsteht. Analog gilt das Entsprechende – wenn auch selten derart folgenreich und messbar – für den Christen „in der Welt“: Wenn er den Mut zu Ab- und Aufbrüchen hat und sich dabei konsequent von Gott führen lässt, kann sein Leben auf ungeahnte und vielfache Weisen fruchtbar werden, nicht nur für ihn allein, sondern auch für die Gemeinschaft der Menschen.
Der Aufbruch in die „Wüste“
Benedikt soll, wie bereits gesagt, um die Jahre 480/490 in der antiken Stadt Nursia zur Welt gekommen sein, dem heutigen Norcia in der umbrischen Provinz Perugia (154 km nordöstlich von Rom, 95 km südöstlich von Perugia sowie 83 km westlich der adriatischen Küste bei Porto d’Ascoli). Seine Eltern sollen einem angesehenen Geschlecht der Oberschicht angehört haben. Sie hatten ihrem Sohn also ein Studium der Freien Künste in Rom ermöglichen können. Außerdem hatten sie ihm dorthin als Haushälterin eine „Amme“ mitgegeben – recht bequeme Umstände, ein Studentenleben führen zu können.
Aber Benedikt fand das auf andere Weise ungenügend. Deshalb machte er eines Tages – ungefähr im Jahr 505 – damit Schluss und verließ Rom, um „die Wüste aufzusuchen“, petere deserta : das ist in der gesamten frühen Mönchsliteratur der klassische Begriff zur Bezeichnung der für den Geist besonders fruchtbaren Umgebung, die der Mönch aufsucht. Benedikt kehrte gar nicht mehr heim, sondern ließ seine Eltern einfach auf Nimmerwiedersehen hinter sich. Solche herzlosen Abschiede waren im frühen Mönchtum Brauch.
Der sechzig oder siebzig Jahre vor Benedikts Geburt verstorbene rigorose Asket und später nicht unbedingt deswegen heiliggesprochene Hieronymus hatte in einem Brief an einen gewissen jungen Heliodor geschrieben: „Selbst wenn dein kleiner Neffe sich dir an den Hals klammern würde; selbst wenn deine Mutter mit aufgelösten Haaren und zerrissenem Kleid dir ihre Brüste vorweisen würde, mit denen sie dich gestillt hat, und dein Vater sich auf die Türschwelle legen wollte: Setz den Fuß über deinen Vater und schreite über ihn hinweg, wende dich von deiner Mutter ab, geh fort und flieh trockenen Auges! Hier grausam zu sein ist der einzig richtige Erweis der Elternliebe.“ 9
Читать дальше