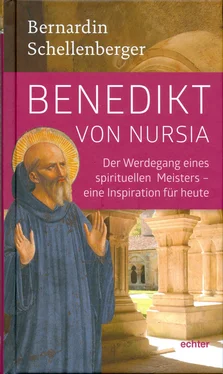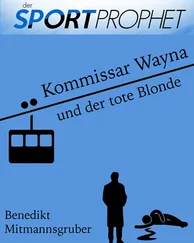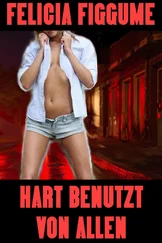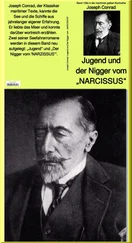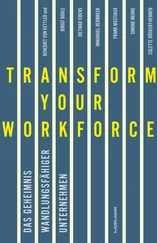So verschmähte er das wissenschaftliche Studium. Er verließ das Haus und die Güter seines Vaters und suchte in seiner Sehnsucht, Gott zu gefallen, einen dementsprechenden Lebensstil .
Er zog sich also wissentlich ins Nichtwissen und mit Weisheit in die Ungelehrtheit zurück .
In diesem Text ist recht pauschal von der Welt- und Wissenschaftsverachtung des Helden die Rede: Benedikt verachtete die Welt mit ihrer Blüte, die ihm dürr erschien . Der lateinische Begriff dafür, mundum despicere , „die Welt verachten“, wurde zum Standardbegriff für die Grundhaltung des Mönchs. Wörtlich heißt er: „auf die Welt herabschauen“. Wenn man von der arroganten Konnotation dieses Ausdrucks absieht, kann man darin den guten und auch heute brauchbaren Sinn erkennen: „sich die Welt aus einigem Abstand ansehen“. Das brauchen wir heute sogar unbedingt, um nicht jeder Ideologie, jeder Mode, jedem Geschmack und jeder Spinnerei des Zeitgeists, also jeder dürren Blüte , auf den Leim zu gehen.
In der Aufzählung Gregors lassen sich durchaus Impressionen und Verhältnisse spiegeln, die man auch als Mensch von heute kennt, selbst wenn man die Welt nicht derart radikal verachten will: die Hohlheit eines Großteils unseres Vergnügungsbetriebs mit seiner „Blüte, die einem dürr erscheint“; die „Abgründe der Laster“, von denen in den Medien zuhauf die Rede ist, weil sie das interessierte Publikum offensichtlich zu einer Mischung aus ständiger Faszination und Empörung anstacheln; die Eitelkeit in manchen Bereichen des Wissenschaftsbetriebs oder jedenfalls die Sucht nach Titeln, Diplomen und Zertifikaten, infolge derer sogar bekannte Persönlichkeiten „in eine bodenlose Tiefe stürzen“.
Es tut gut, manches „wissentlich nicht wissen“ zu wollen und aus Weisheit über manches unbelehrt zu bleiben.
Dieser einleitende Abschnitt der Lebensbeschreibung Benedikts spricht ganz kurz etliche weitere interessante Themen an. Betrachten wir sie der Reihe nach etwas gründlicher.
Da heißt es gleich am Anfang, unser Held habe von Kindheit an das Herz eines weisen Alten gehabt (ab ipso pueritiae suae tempore cor gerens senile) . Gemeint ist mit dem „Herz eines weisen Alten“die frühe Weisheit dieses Kindes. Einer solchen kann man ja bei kleinen Kindern tatsächlich immer wieder verblüfft begegnen, jedenfalls in Form des kurzen Aufblitzens von Fragen oder Aussagen über Gott und die Welt, über die man sich nur wundern kann; zuweilen nennt man solche Kinder ja dann auch „altklug“.
Gregor war geprägt vom antiken Ideal des weisen alten Mannes, des „Greises“ (senex) , und schrieb Benedikt die frühreife Weisheit einer solchen Persönlichkeit zu.
Mit diesem Paradox, in der Jugend bereits über Züge einer Altersweisheit zu verfügen oder fähig sein zu müssen, solche anzunehmen, bekommt jeder zu tun, der jung in den Mönchsstand eintritt. Denn die Wertvorstellungen und Lebensrhythmen im Kloster sind im Wesentlichen diejenigen älterer, abgeklärter Menschen; für junge Menschen sind sie nicht unbedingt sofort sinnvoll und fruchtbar. Eine heutige Psychologie der Lebensalter und deren stufenweise Entwicklung führt das deutlich vor Augen. Sie zeigt, wie sich im Lauf eines Menschenlebens die Sensibilitäten, Wertvorstellungen und Interessenschwerpunkte immer wieder deutlich verlagern.
In manchen spirituellen Traditionen wusste man schon lange ziemlich deutlich darum. So gibt es zum Beispiel im Hinduismus eine alte Lehre von vier Lebensphasen des Menschen: Er durchlaufe nacheinander die Stadien des Schülers, des Haushalters, des Waldeinsiedlers und des Bettelmönchs: Der Jugendliche ist zunächst ein Lernender und wird als junger Erwachsener immer mehr zum aktiven Gestalter seiner Welt; ab der Lebensmitte setzt ein besinnlicher, kontemplativer Zug ein, wofür der „Waldeinsiedler“ steht, und am Ende darf er sich als „Bettelmönch“ verstehen, der alles loslassen kann und mit Recht erwarten darf, von seinen Mitmenschen das Notwendige zu erhalten.
Wo eine Gesellschaft sich auf diese vier Rollen der einzelnen Lebensstadien einigen könnte, hätten die Menschen auf allen Altersstufen ihre anerkannte Identität. Sie müssten zum Beispiel nicht krampfhaft versuchen, möglichst lange „jung“ zu bleiben, also auf Lebenszeit autarke „Haushalter“ zu bleiben. In Indien gelang dies vielleicht irgendwann einmal ganz gut; die „Bettelmönche“ galten als anerkannter Stand; wenn man ihnen ein Almosen gab, so glaubte man, verbessere man sein eigenes Karma.
Für unseren Zusammenhang hier ist interessant, dass die Geschichte Benedikts genau in der Gegenrichtung dieses Lebensentwurfs verläuft. Wie wir sehen werden, fängt er als „Bettelmönch“ und „Waldeinsiedler“ an, wird schließlich „Haushalter“ einer großen Mönchsfamilie und stirbt am Ende aufrecht stehend.
Es ist hier nicht der Raum und auch nicht notwendig, weiter auszuführen, wie kontraproduktiv und gefährlich es sein kann, wenn junge Menschen, die in ihrem Leben noch gar nichts angepackt und aufgebaut haben, „alles verlassen“, um „Bettelmönch“ zu werden und eine Spiritualität des abgeklärten Alters zu pflegen. Oft holen sie die übersprungene Lebensphase später nach und geraten aus der Bahn eines kontinuierlichen Reiferwerdens.
Andererseits weist die Lebensweise und Spiritualität im Kloster schon früh im Leben in die Kunst ein, mit den Bedingungen fruchtbar umzugehen, in die man im Alter unvermeidlich gerät: dass man einsamer und es stiller um einen wird; dass das aktive Element zunehmend dem kontemplativen Platz machen sollte; dass die „Abgeschiedenheit von der Welt“ zunimmt. Glücklich, wer früh die Strategien und Künste gelernt hat, damit umzugehen.
Aber bei den folgenden Überlegungen und Anregungen geht es ja nicht um den Eintritt ins Kloster, sondern um jenen Abschnitt im Leben, an dem man anfängt, zum üblichen Treiben in der Welt auf einigen kritischen Abstand zu gehen und sich für einen einfacheren Lebensstil und eine tiefgründigere Orientierung zu interessieren. Normalerweise wird man dafür eine gewisse Reife, Erfahrung und Bewährung im praktischen Leben brauchen. Man wird auch nicht unbedingt eine jähe „Bekehrung“ erfahren, sondern die innere Distanz zu vielen, allgemein üblichen Wertvorstellungen wird ganz allmählich größer werden.
Keine besondere Einstiegserfahrung
In der Gattung der Lebensbeschreibungen heiliger Mönche steht dagegen meistens am Anfang eine jähe, schlagartige Berufungserfahrung. So wurden die großen religiösen Berufungen, die in der Welt nachhaltige Bewegungen und Bewusstseinsverlagerungen auslösten, weithin in irgendeiner Form als eindrucksvolle „Gotteserfahrungen“ beschrieben. Antonius den Großen, den späteren Wüstenvater (251/252–356), und den Ordensgründer Franz von Assisi (1181/82–1226) zum Beispiel traf in der Kirche der Spruch Christi ins Herz: „Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen; so wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach!“ (Mt 19,21), und sie taten das buchstäblich.
Es ist bemerkenswert, dass von Benedikt keine derartige Erfahrung berichtet wird. Die Überlegungen, die den jungen, gut situierten Studenten dazu bringen, sein Studium abzubrechen und Rom zu verlassen, sind zunächst einmal eher „profaner“ Natur. Es heißt, er hätte in Rom – als Sohn wohlhabender Eltern – durchaus vorübergehend die sinnlichen Genüsse genießen können, doch habe er in seiner Studienzeit viele in die Abgründe von Lastern stürzen sehen und deshalb seinen Fuß, den er sozusagen gerade erst in die Welt gesetzt hatte, wieder zurückgezogen. Er wollte sich nämlich nicht von deren Kenntnis anstecken lassen und dann schließlich ebenfalls ganz in den bodenlosen Abgrund stürzen .
Читать дальше