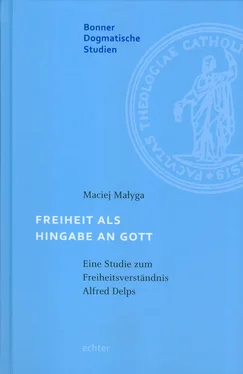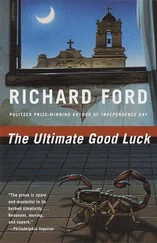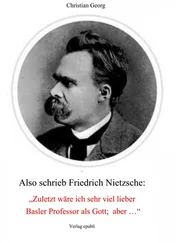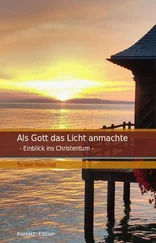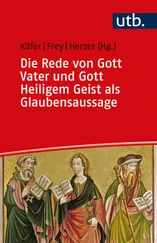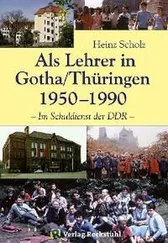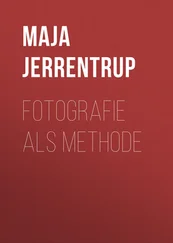c) … mit dem Schicksal der Gefangenschaft und des bevorstehenden Todes (1944-1945)
Nach dem erfolglosen Attentat Stauffenbergs auf Hitler am 20. Juli 1944 wurde auch Delp am 28. Juli durch die Gestapo verhaftet, da sein Name in den Notizen des durch den Staatsstreich kompromittierten Grafen Yorck entdeckt wurde. 76Im August 1944 wurde Delp nach Berlin gebracht, dort zuerst im Gestapo-Gefängnis Berlin-Moabit inhaftiert und anschließend im September in die Haftanstalt Berlin-Tegel eingesperrt. Dem Angebot, aus dem Jesuitenorden auszutreten und dadurch freizukommen, erteilte Delp eine Absage; am 8. Dezember legte er in der Zelle das Ordensgelübde ab. 77Nach einem zweitägigen „Prozess“ vor dem Volksgerichtshof wurde er am 11. Januar 1945 wegen „Hoch- und Landesverrates“ zum Tod verurteilt. Am 2. Februar 1945 wurde er im Gefängnis Berlin-Plötzensee hingerichtet. 78
Hinter diesen wenigen Daten stehen intensive Erfahrungen eines sich des eigenen nahenden Endes immer bewusster werdenden Menschen. Die Phasen der Ruhe und der Angst, der Sicherheit und des Zweifels, durch die Delp ging, fanden ein Echo in seinen Gefängnisschriften. Die Texte enthalten zwar keine radikalen Neuheiten – Delp selbst betonte, er bleibe bei den alten Thesen 79–, sie stellen aber das ganze bisherige Denkwerk Delps in den Horizont eines Freiheitsdenkens. Die Grundbegriffe seines Denkens, wie etwa Gottesunfähigkeit, Blick auf das Ganze, Rückkehr zur Mitte, Bewegung „über sich selbst hinaus“ und Hingabe, wurden von dem gefangenen Jesuiten auf das Freiheitsereignis hin bezogen. Der existenzielle Kontext jener Reflexion ist evident, Delp schrieb über sich selbst, zu sich selbst und nicht nur für Andere. 80Sichtbar ist eine Verschiebung des Schwerpunktes seines Freiheitsverständnisses: weg von einem akademisch verfassten und eng an die philosophische Reflexion geknüpften Begriff von Freiheit, hin zu einem beinahe mystischen Freiheitsdenken. Sein an außergewöhnliche Bedingungen geknüpftes Freiheitsverständnis hält Delp zugleich für unbedingt realistisch und für die Alltäglichkeit geeignet. Die ganze den Menschen ergreifende, oft als Fessel erlebte Wirklichkeit könne zu einem Raum der Freiheit werden – in diesem Sinn versteht Delp die Wirklichkeit als ein „Sakrament der Freiheit“. 81
Die Gefangenschaft erlebte Delp als eine Zeit des inneren Wachsens, was vor allem in einer Verbindung mit der Ablegung der Profess zu sehen ist. 82Auf die Tatsache eigenen Reifens macht er in Briefen aufmerksam, indem er etwa erklärt: „Ich habe in diesen Wochen für Jahre gelernt und nachgelernt.“ 83Die Welt erschien ihm nunmehr ohne Vortäuschungen: „Die Kulissen sind weg, und der Mensch steht heute unmittelbar vor den letzten Wirklichkeiten“ 84. Die Gefängnisschriften zeugen nicht so sehr von einer Weiterentwicklung der inzwischen ausgearbeiteten Theorien, sondern vielmehr von dem Weg, der einmal von Theorien ausgegangen war und nunmehr in die Praxis mündete – dies gerade auch in Hinsicht auf die Freiheit:
Vieles, was früher Fläche war, erhebt sich in die dritte Dimension. Die Dinge zeigen sich einfacher und doch figürlicher, kantiger. Vor allem aber ist der Herrgott so viel wirklicher geworden. Vieles, was ich früher gemeint habe zu wissen und zu glauben, das glaube und lebe ich jetzt. 85
Delp schärfte seinen Blick auf die Wirklichkeit einerseits durch den Bezug auf den Glauben, 86andererseits durch die Auseinandersetzung mit dem System des Nationalsozialismus. Nach der Prozessfarce stellte er fest, dass der Nationalsozialismus sich als von sich selbst berauschte Macht und Herrlichkeit nun voll offenbare. 87Eine Beschreibung der nationalsozialistischen Epoche nahm er jetzt ganz ungeschminkt vor:
Die Zeit ohne Erbarmen. Die Zeit der unerbittlichen Schicksale. Die Zeit der Grausamkeit und Willkür. Die Zeit der sinnlosen Tode und der wertlosen Leben … Nie wieder sollen die Menschen sich so über ihre Möglichkeiten täuschen und sich solches tun. 88
Der am 9. und 10. Januar 1945 vor dem Volksgerichtshof stattfindende „Prozess“ war für Delp der letzte und zugleich größte Zusammenstoß jener zwei so verschiedenen Kräfte, die jedoch eine gemeinsame Eigenschaft haben, wie Moltke in Abwandlung eines Wortes des Präsidenten des Volksgerichtshofs Freisler sagt: sowohl das Christentum als auch der Nationalsozialismus, „fordern den ganzen Menschen“ 89. Der sorgfältig auf seine Verteidigung vorbereitete Jesuit musste konstatieren, dass jede objektive Diskussion ausgeschlossen war:
Der Prozeß war eine große Farce. Sachlich wurden die Hauptanklagen: Beziehung zum 20. 7. und Stauffenberg gar nicht erhoben … Es war eine große Beschimpfung der Kirche und des Ordens. Ein Jesuit ist und bleibt eben ein Schuft. Das alles war Rache für den abwesenden Rösch und den Nicht-Austritt. 90
Diese Tage erlebte Delp in der inneren Ruhe, obwohl er keinen Ausweg aus seiner Situation sah. Er notierte: Gott will „den absoluten Sprung von mir weg in ihn hinein“ 91. Er akzeptierte und verstand es als eine neue Etappe seines Wachsens:
Denn jetzt bin ich ja erst Mensch geworden, innerlich frei und viel echter und wahrhafter, wirklicher als früher. Jetzt erst hat das Auge den plastischen Blick für alle Dimensionen und die Gesundheit für alle Perspektiven. 92
Vielmals wiederholte er, das Leben habe ein gutes Thema bekommen. 93Er fühlte sich zur inneren Freiheit erzogen, deshalb antwortete er dem nach seiner Tätigkeit fragenden Freisler: „Ich kann predigen, so viel ich will, und Menschen geschickt oder ungeschickt behandeln und wiederaufrichten, solange ich will.“ 94
Die Texte der Verteidigung Delps vor dem Tribunal und ein Entwurf seines Gnadengesuchs liegen vor. Der Jesuit wollte sich dabei keinesfalls als ein entschiedener Widerstandskämpfer darstellen. Nach der Lektüre seiner Verteidigungsschriften drängt sich die Meinung auf, dass er – entgegen dem eigenen Willen – in die große Geschichte verwickelt wurde. 95Ein noch trüberes Bild findet sich im Gnadengesuchsentwurf, bei welchem aber ungewiss ist, ob es überhaupt abgeschickt wurde. 96Dass Delp jene Worte mit einer großen inneren Distanz schrieb, bezeugen sein Briefe: Diese Texte waren eine strategische Positionierung eines 37-jährigen Mannes, der in „die äußerste Situation gekommen [ist], in die Menschen kommen können“ 97, und der nicht sterben wollte: „Ich würde gern noch weiterleben.“ 98Nicht die Verteidigung und das Gnadengesuch, sondern eine kurze, wenige Tage vor dem „Prozess“ verfasste Notiz drückt die tatsächliche Meinung Delps aus: „Die Gestalt des Leonardo da Vinci hat mich gestern mehr interessiert als meine Anklage.“ 99Den bestimmenden Horizont für die Lektüre aller seiner Worte liefert letztendlich seine Entscheidung, dass er bewusst auf die Zugehörigkeit zu dem Orden nicht verzichtet, sondern vielmehr um den Preis des Lebens für sie einsteht. 100
Delp wollte unbedingt den gesunden, freien Blick auf die Wirklichkeit behalten und Realist bleiben. 101Extrem niedergedrückt durch das Bewusstsein des kommenden Todes kämpfte er um eine realistische Perspektive auf das Leben. Er erklärt:
Ich habe in diesen letzten Tagen gezweifelt und überlegt, ob ich Selbsttäuschungen zum Opfer gefallen bin, ob sich mein Lebenswille in religiöse Einbildungen sublimiert hat oder was das war. Aber diese vielen spürbaren Erhebungen in mitten im Unglück; diese Sicherheit und Unberührtheit in allen Schlägen; dieser gewisse „Trotz“, der mich immer wissen ließ, es wird ihnen die Vernichtung nicht gelingen; diese Tröstungen beim Gebet und beim Opfer; diese Gnadenstunden vor dem Tabernakel; diese erbetenen und immer wieder gegebenen und gewährten Zeichen: ich weiß es nicht, ob ich das alles jetzt wegtun darf. Soll ich weiter hoffen? Will der Herrgott das Opfer, das ich ihm nicht versagen will oder will er die Bewährung des Glaubens und Vertrauens bis zum äußersten Punkt der Möglichkeit? … Was will der Herrgott mit alledem? Ist es Erziehung zur ganzen Freiheit und vollen Hingabe? … Was soll ich jetzt tun, ohne untreu zu werden? … Soll ich einfach in der Freiheit zur Verfügung bleiben und in der Bereitschaft? … Es ist Zeit der Aussaat, nicht der Ernte. 102
Читать дальше