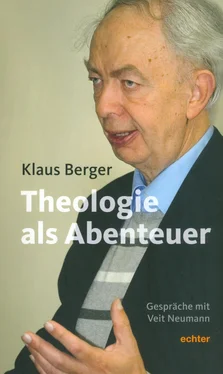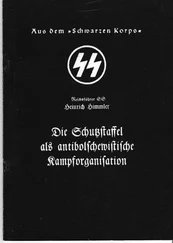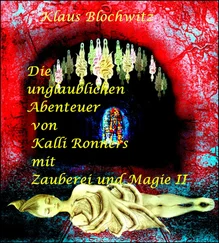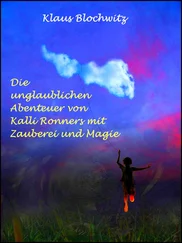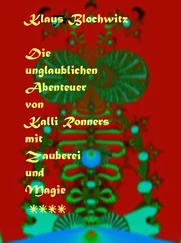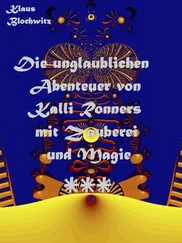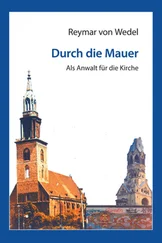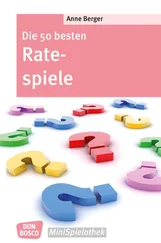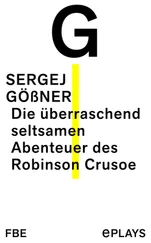Magna Charta dieser Religion, in das christliche Glaubensbekenntnis, aufgenommen. Wie aber soll man dies (und noch viel mehr !) glauben, gar sein Leben darauf bauen können, wenn die moderne Bibelauslegung zu dem Ergebnis kommt, es sei alles ganz anders gewesen, als der blanke Buchstabe verspreche ? Wie noch an Jesus, an seine Auferstehung von den Toten glauben, wenn die Mehrzahl seiner Worte und Taten sich als „unecht“ beziehungsweise „spätere Gemeindebildung“ herausgestellt haben sollte ? Wie ihm nachfolgen, wie zu ihm beten, wenn er sich – zum Beispiel – mit der Ankündigung des Reiches Gottes noch zu Lebzeiten seiner Zuhörer (nach Mk 9,1) komplett „geirrt“ haben sollte ? Die Anzahl jener, die durch solche „Erkenntnisse“ der „aktuellen“ theologischen „Forschung“ den Glauben verloren haben, dürfte immens sein. Darunter auch Geistliche, die, wenn sie im Amt bleiben, ihren als Wissenschaft verbrämten Unglauben auf ihre Gemeinden streuen. Allein in meiner Verwandtschaft mütterlicherseits hatten von 16 Vettern und Basen vier ein Theologiestudium aufgenommen. Zwei brachen es infolge bohrender Zweifel vorzeitig ab, zwei fielen vom überlieferten Glauben ab, einer davon „glaubt“ jetzt, wie er sagt, an Friedrich Nietzsche. Familie, Gymnasium, Universität hatten ihnen nicht das Rüstzeug zu geben vermocht, mit dem man die Waffen der Kritik gegen diese selbst richten muss, will man den tatsächlichen Erkenntniswert moderner Bibelwissenschaft richtig einschätzen können.
Ihr Flaggschiff, die „historisch-kritische Methode“, ist ein typisches Produkt der (klassischen) Moderne. Wo sie religionsgeschichtliche Vergleiche zieht und die unterschiedlichen Texte des Alten wie des Neuen Testamentes mit sprachwissenschaftlichen, also text- und literarkritischen, form-, redaktions- und traditionsgeschichtlichen Mitteln untersucht, zeitigt sie bisweilen staunenswerte Ergebnisse. Doch wie die Moderne selbst ist auch die „historisch-kritische Methode“ in die Jahre gekommen. Es konnte nicht ausbleiben, dass sie nach ihrem beispiellosen Triumphzug durch die theologischen Fakultäten selbst zum Gegenstand kritischer Untersuchungen wurde. Doch das Beharrungsvermögen etablierter Institutionen und scientific communities , zu denen die Mehrheitstheologen wie kaum eine andere Zunft zusammengeschweißt sind, sorgt dafür, dass solche Arbeiten unterdrückt oder lächerlich gemacht werden. Ich erinnere mich gut, wie 1993 der Würzburger Ostkirchenkundler Hans-Joachim Schulz seine bahnbrechende, trotz „erhebliche(r) Einwände“ von Rudolf Schnackenburg, wie dieser im Vorwort schrieb, in die renommierte Herder-Reihe Quaestiones disputatae aufgenommene Studie über „Die apostolische Herkunft der Evangelien“ (3. Aufl. 1997) veröffentlicht hatte und das exegetische Establishment tat, was in der Wissenschaft seit jeher die tödlichste Waffe ist : es schwieg ! Dabei zeigte das Buch – neben der Verortung der Evangelienentstehung in die liturgisch-anamnetische Praxis der frühen Christengemeinden –, was für Historiker und Altphilologen als längst ausgemacht galt : Die tragenden Prämissen, auf denen die moderne Bibelauslegung beruht, stammen aus der Mottenkiste des 19. Jahrhunderts, das wiederum rationalistische Engführungen der Aufklärung transportiert hat. Wunder beispielsweise konnte es nicht geben, weil sie dem mechanistischen Weltbild widersprachen. Berühmt geworden ist die Sentenz des protestantischen Bibeltheologen Rudolf Bultmann, der sein Entmythologisierungsprogramm 1941 so begründete : „Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Und wer meint, es für seine Person tun zu können, muß sich klarmachen, daß er, wenn er das für die Haltung des christlichen Glaubens erklärt, damit die christliche Verkündigung in der Gegenwart unverständlich und unmöglich macht.“ Dabei veranschaulichte Bultmanns Analogie, „existential“ betrachtet, kaum mehr, als dass der heideggernde Theologe Glühbirnen, Radiogeräte und Gerätemedizin noch Mitte des 20. Jahrhunderts für Wunder (der Technik) hielt.
Als besonders traditionalistisch erweist sich der mainstream der sog. biblischen Einleitungswissenschaft. Weil der (zweite) Tempel in Jerusalem bekanntlich im Jahr 70 n. Chr. zerstört worden ist, muss die Ankündigung Jesu, dass vom Tempel „kein Stein auf dem andern bleiben“ werde (Mk 13,2 parr.), als ein ihm von den Synoptikern Markus, Matthäus, Lukas nachträglich in den Mund gelegtes vaticinium ex eventu gewertet werden. „Die in Vers 2 enthaltene Prophetie läßt sich schwerlich auf Jesus zurückführen. Zu deutlich schildert sie den Zustand, den das Tempelgelände nach dem Römisch-Jüdischen Krieg bot“, schreibt der hochangesehene Münchner Exeget Joachim Gnilka in seinem Markus-Kommentar (4. Aufl. 1994). Will heißen : Markus lässt Jesus ankündigen, was in Wahrheit längst passiert ist – ein Täuschungsmanöver ! Ebenso die Parallelen bei Matthäus und Lukas, die Markus als Quelle nutzen. Dabei fragt sich jeder unvoreingenommene Leser, warum die Synoptiker ebengerade nicht „schildern“, sprich : veranschaulichen oder näher darstellen, was bei der – angeblich bereits vergangenen – Tempelzerstörung geschehen ist. Warum werden nur die Trümmer erwähnt, wenn doch die Tempelzerstörung als geschichtliche Katastrophe katexochen in Einzelheiten beschrieben werden könnte ? Warum lässt Markus Jesus nur wenige Verse später (13,14) dasselbe Ereignis noch einmal ankündigen, diesmal freilich in apokalyptischer Sprache (vgl. dazu Dan 9,27 ; 11,31 ; 12,11), und warum so eng verknüpft mit allerlei apokalyptisch-kosmischen Zeichen, die nach der Zerstörung des Tempels durch Titus offenkundig ausgeblieben sind ? Längst sind viele weitere Fragen und Argumente nicht zuletzt von Historikern und Klassischen Philologen zusammengetragen worden, die das bibelwissenschaftliche Dogma von der Spätdatierung aller vier Evangelien „nach 70“ – das große Tabu schlechthin – und andere Scheingewissheiten erschüttern müssten. Vergebens ! Selbst kirchenoffizielle Bibelausgaben halten am Unhaltbaren fest. Mancher wird einwenden : Spielt denn die Entstehungszeit überhaupt eine Rolle ? Die Frage nach dem terminus post quem ist deshalb so dringlich, weil Spätdatierungen im Hinblick auf Jesus als historische Person Zeitzeugenschaft ausschließen. Sie bilden das Einfallstor für allerlei „Einschübe“, „Redaktionen“, „Hinzufügungen“ und – sagen wir es deutlich – Phantastereien angeblich von „Parusieverzögerung“ gelähmter Christen und anonymer „Autorenkollektive“, die zu unterstellen manche Exegeten offenbar ungestillte Lust verspüren.
Als Absolvent der Rechtswissenschaften wunderte ich mich schon in den ersten Semestern Theologie, wie hartnäckig hier an Vorurteilen und fraglich gewordenen Prämissen festgehalten wurde. Das wäre unter Juristen undenkbar gewesen. Immerhin lernte ich so das alte Subtraktionsverfahren kennen, bei dem „Schicht um Schicht“ verschiedene „Bearbeitungen“ vom Evangelienstoff abgetragen werden, bis etwa vom „Menschensohn“ des Bibeltextes historisch einigermaßen sicher übrigbleibt, dass er ein „Fresser und Säufer“ (Lk 7,34 ; Mt 11,19) war. Wie gut, dass Vergleichbares mit Autoren des 20. Jahrhunderts nicht angestellt wird ! Ein kluger Studienrat demonstrierte einmal in einem Zeitungsartikel, wie viel das Schichtungsmodell, auf Franz Kafkas Roman „Der Prozeß“ angewandt, übrigließe. Nicht nur würde man wohl die Entstehung des Romans wegen des berühmten Anfangssatzes („Jemand mußte Josef K. verleumdet haben, denn ohne daß er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet“) statt auf vor 1914 fälschlicherweise auf die Jahre 1933 ff. datieren ; vor allem wäre man sich einig, dass die im Roman enthaltene „Türhüter-Parabel“ von einem „Redaktor“, sagen wir von Max Brod, später „eingefügt“ worden sei. Tatsächlich aber beweist das handschriftliche Originalmanuskript einwandfrei : Kafka hat den ganzen Text, von geringfügigen Retuschen abgesehen, in einem Zug geschrieben. Der Wechsel der Gattungen innerhalb des Werkes geht allein auf ihn zurück. Von mehreren Verfassern, gar einem „Kollektiv“ keine Spur !
Читать дальше