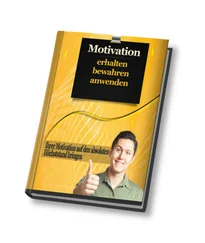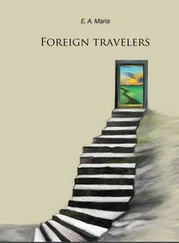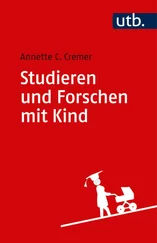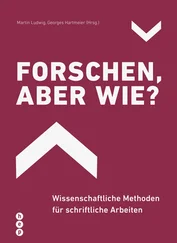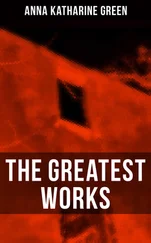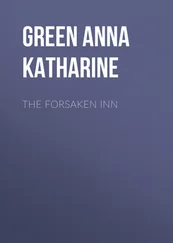Auf den Vorschlag der Finanzdelegation von 1910, das Landesmuseum solle Sammlungsstücke abgeben, um den Platzmangel zu beheben, antworteten die Museumsbehörden damals wie folgt: Erst wenn der Erweiterungsbau vorhanden sei, könne entschieden werden, welche Stücke entbehrlich seien, weil in den vorhandenen Räumen keine «vollständige[…] Übersicht» 197über die Sammlung möglich sei. 198Aus den Kommissionsprotokollen und den Jahresberichten geht aber hervor, dass die Museumsangestellten einen wesentlichen Teil ihrer Arbeit genau dieser angeblich unmöglichen Tätigkeit widmeten: Sie versuchten, eine Übersicht über die Bestände zu gewinnen. Hauptsächlich ging es darum, festzustellen, was in welchen Räumen vorhanden war, und ein System zu entwickeln, um die Objekte lokalisieren zu können.
Hans Lehmann wollte den gesamten Sammlungsbestand systematisch erfassen. Nach seinem Amtsantritt 1903 wurde «sofort», wie es hiess, «an die Anlage eines Standortkataloges geschritten, d.h. an ein Inventar der sämtlichen, in den Museumsräumen und Depots aufbewahrten Gegenstände». 199Weiter war ein Assistent beauftragt, die neu erworbenen Objekte in Eingangsbüchern zu erfassen, indem er sie beschrieb und vermerkte, wo sie ausgestellt oder magaziniert wurden. 200
In der Zeit von Lehmanns Vorgänger, Heinrich Angst, stand die buchhalterische Dokumentation zuhanden der Finanzkontrolle im Vordergrund: Es wurden Inventare der Objekte angelegt, die Auskunft erteilten über die laufenden Ausgaben, die Ankaufspreise der Altertümer und die Schätzungswerte der eingegangenen Depositen und Geschenke. Der «Buchhalter-Kassier» betreute diese Verzeichnisse. 201Die Finanzkontrolle des Finanzdepartements wie auch die Museumskommission überprüften von Zeit zu Zeit stichprobenartig, ob die erworbenen Objekte noch auffindbar waren. Sie schickten dafür einen Assistenten des Museums los, um bestimmte Objekte herauszusuchen und vorzuweisen. 202Nach der Einschätzung von Lehmann war nur ein seit längerer Zeit der Museumsverwaltung angehörender Beamter, der aus dem Gedächtnis wusste, wo sich was befand, in der Lage, die Gegenstände zu finden. 203Dass andere Suchhilfen fehlten, kann einerseits mit dem gehegten Ideal einer an den Ausstellungsraum gekoppelten überblickbaren Objektordnung erklärt werden. Andererseits wird daran auch die grosse Bedeutung der Objekte als Kapitalanlage erkennbar, wo das saubere Festhalten des monetären Werts zentral war. Die immense Grösse der Menge verlangte nun aber nach einem anderen Erfassungssystem, auch wollten die Museumsbehörden mehr als den Geldwert der Objekte festgehalten wissen.
Während seiner Amtszeit liess Hans Lehmann das System zur Erfassung der Sammlungsbestände mehrfach überarbeiten. In Zusammenarbeit mit dem eidgenössischen Finanzdepartement wurde versucht, ein Ordnungssystem zu finden, das die Angaben bündelte: diejenigen, die die Finanzkontrolle forderte (z.B. der aktuelle Versicherungswert), und diejenigen, die das Museumspersonal neu als wichtig ansah (z.B. eine Objektbeschreibung). Es wurde zu diesem Zweck ein Inventarbuch mit fortlaufender Nummerierung über alle Objekteingänge sowie nach Sach- und Materialgruppen angelegte Spezialkataloge und Inventare geführt, wobei die Standortangaben – in welchem Raum sich ein Objekt befand – nicht mehr fehlen durften. Parallel dazu wurden separate Standortkataloge angelegt. 204
Das visuelle Moment blieb für die Orientierung in der Objektmenge weiterhin zentral: Immer wieder wurden die angelegten Bücher mit der Ordnung der Objekte im Museumsraum abgeglichen. Es wurde jeweils eine «Revision» 205durchgeführt, wie der Vorgang genannt wurde. Wenn auch Verzeichnisse die Merkleistung der Museumsmitarbeiter weniger strapazierten, mussten diese doch immer noch wissen, wie die Objekte aussahen, die sie innerhalb eines Raums suchten. «Übersicht gewinnen» muss wörtlich verstanden werden. Das Museumspersonal schaute sich die Dinge an, sichtete Stück für Stück die einzelnen Sammlungsbestände und suchte gezielt nach Objekten, deren Nummer, nicht aber deren Standort bekannt war – oder umgekehrt. Die Standortkataloge wurden aktualisiert, die vorhandenen Inventare überarbeitet. 206Anlass waren nicht selten räumliche Veränderungen: etwa wenn infolge der Kündigung eines Depots Gegenstände verlagert werden mussten. 207
Ab den 1920er-Jahren wurde bei den Revisionen in den Depoträumen versucht, Objektgruppen ähnlich wie in den Ausstellungsräumen anzuordnen, «um auch in den Magazinen deren Übersicht und Studium zu erleichtern». 208Man wollte die ausserhalb der Ausstellungsräume befindlichen Sammlungsstücke «allfälligen Interessenten besser zugänglich […] machen». 209Damit waren die ersten Schritte in Richtung einer Studiensammlung vollzogen.
Während sich die Museumsbehörden in den Debatten über die Mengenbildung gegen die Abgabe von Objekten wehrten, war ihre alltägliche Praxis längst eine andere. Sie liehen nämlich immer wieder einzelne Sammlungsstücke wie auch ganze Bestände an andere Institutionen aus. So überliessen die Museumsbehörden verschiedenen musealen und museumsähnlichen Institutionen Sammlungsstücke als «Depositen». Das hiess, dass ein Stück leihweise für eine längere Zeit einer anderen Institution zur Ausstellung überlassen wurde, jedoch verbunden mit der Möglichkeit, es jederzeit zurückfordern zu können. 210Wie Hans Lehmann 1923 gegenüber dem Bundesrat ausführte, versuchte man dies «ohne grosses Aufsehen zu machen». 211In den Jahresberichten wurden diese Objektbewegungen zwar erwähnt, doch wurden die Berichte laut Lehmann von den Vertretern der Politik wenig beachtet. 212Dass die damalige Ausleihpraxis seitens der Museumsbehörden keine spezielle Erwähnung fand, lässt sich mit der Furcht vor grösseren Besitzverlusten erklären: Wenn sie Objekte für temporär entbehrlich bestimmten, unterwanderten sie ihr Argument, dass die Bedeutsamkeit der Sammlung in ihrer versammelten Grösse liege. Bei jeder Ausleihe betonten sie deshalb, dass man «ausnahmsweise und ohne Präjudiz» 213entschieden habe. 214
Die Initiative für Ausleihen ging selten vom Landesmuseum aus. Es waren vielmehr verschiedene Institutionen, die Bittschriften an dieses sendeten und anfragten, ob sie leihweise Objekte für ihre Ausstellungen haben könnten. Oft wurden ihre Anfragen abgelehnt. 215Manchmal wurden bloss einige wenige Gegenstände weggegeben: Die Museumskommission stimmte beispielsweise zu, ein paar Zinngeräte zur Ausschmückung des Büffets im Wirtschaftslokal «Rütlihaus» auszuleihen. Die Rütlikommission der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft hatte dafür ein Gesuch gestellt. 216Manchmal konnten es aber auch mehrere hundert Stücke sein: So wurden an verschiedene Schlösser zahlreiche Halbharnische abgegeben, ohne die vorhandenen Bestände «nennenswert zu vermindern», 217wie es hiess. 218
Auch wenn die Museumsbehörden die Ausleihen als solitäre Aktionen ausgaben, lässt sich doch eine Tendenz in der Objektauswahl feststellen. Mehrheitlich waren es Gegenstände aus den Depots, die anderen Institutionen für ihre Dauerausstellungen ausgeliehen wurden, so zum Beispiel magazinierte Möbel und Waffen aus den ehemaligen Beständen des kantonalen Zeughauses von Zürich. 219Die Behörden des Landesmuseums wollten aber unbedingt die Kontrolle über die ausgeliehenen Sammlungsstücke behalten: Es wurde dafür ein Verzeichnis der Depositen angelegt, die Objekte wurden vor ihrer Abgabe fotografiert, um allfällige Beschädigungen feststellen zu können, und bei den Leihnehmern wurden später vor Ort auch Inventarisationen und Revisionen durchgeführt. 220Was zu vermeiden versucht wurde, waren Ausleihen für temporäre Ausstellungen. Hier war die Furcht vor Beschädigungen an den Objekten durch unsachgemässe Handhabe noch viel grösser als bei den Dauerausstellungen. 221Auch von einer planvollen Wahl der Zielorte versprach man sich eine bessere Kontrolle über die Sammlungsstücke: Sie wurden nicht an Private, sondern nur an öffentlich zugängliche Sammlungen ausgeliehen, wie etwa an die historischen Museen von Basel und St.Gallen sowie an die Schlösser Kyburg und Hegi. 222In diesem Zusammenhang erscheint es als Glücksfall, dass 1912 dem Landesmuseum die Schlossanlage Wildegg im Kanton Aargau geschenkt wurde. Julie von Effinger, die letzte Vertreterin der dort wohnhaften Familie von Effinger, hatte diese Schenkung veranlasst. 223Damit gelangte das Landesmuseum nicht nur in den Besitz seines bisher «umfangreichste[n] Sammlungsobjekt[s]». 224Es erhielt auch zusätzlichen «Stauraum», wenn auch nicht in Zürich. Objekte, die nicht den höchsten Stellenwert in der Sammlung hatten, die man aber doch nicht weggeben wollte, konnten nun in den 35 Wohnräumen des Schlosses ausgestellt werden (Abb. 14). Das waren vor allem Möbel und wiederum Waffen aus den Depositenbeständen des früheren Zeughauses des Kantons Zürich. Das im Schloss noch vorhandene Mobiliar, welches vorwiegend aus dem 19. Jahrhundert stammte, wurde verkauft, weil es nicht den Sammelpräferenzen der Museumsbehörden entsprach. Aus dem Erlös finanzierte man die Restaurierung des Gebäudes, die zum Ziel hatte, das Schloss in den Zustand der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zurückzuversetzen. 2251915 wurde das Schloss Wildegg als Museum eröffnet (vgl. Abb. 14). 226
Читать дальше