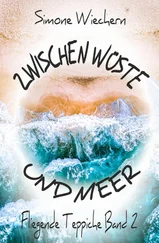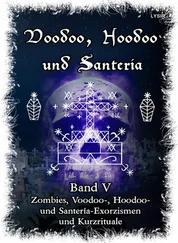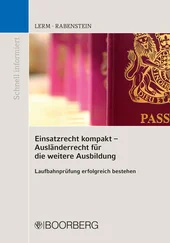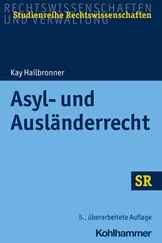1 ...6 7 8 10 11 12 ...33 3. Wenn die Gegenstände, die der Diskurs bildet, nur «in einer Praktik und durch eine Praktik» existieren, führt das zur Frage der Macht. Bevor sich Tatsachen – zumal prekäre wie der Bündner Gemeindedualismus – stabilisieren können, durchlaufen sie meist einen langen, konfliktreichen und nichtlinearen Weg. 101Politisches Handeln ist immer kommunikatives Handeln, das nicht einfach als eindimensionaler Akt gefasst werden kann, bei dem «von oben nach unten dekretiert, regiert, entschieden wird». 102Eine Abgrenzungsgeschichte der Bündner Gemeinden soll zeigen, wie Macht nichts anderes bedeutet als «Kräfteverhältnisse, die durch ihre Ungleichheit unablässig Machtzustände erzeugen, die immer lokal und instabil sind». 103Wodurch also das politische Kollektiv (die Bürgergemeinde, der Kanton, die Politische Gemeinde, der Bundesstaat usw.) entsteht, auf das sich Entscheidungen beziehen, ist historisch variabel und selbst «immer schon das Ergebnis von Bedeutungszuschreibungen». Deshalb bedürfen kollektive Akteure wie Bürgergemeinden oder der Kanton «institutionalisierte[r] Zurechnungsverfahren», 104um zur Existenz zu gelangen.
4. Damit ist noch einmal ein umfassender Begriff von politischer Kultur angesprochen. Für die Rekonstruktion diskursiver Praktiken soll nämlich ein ebenso weiter Symbolbegriff zur Hand genommen werden: Institutionalisierte Zurechnungsverfahren zielen auf die «fundamentale Konstituierung der sozialen Welt» 105durch das Handeln von Institutionen, wie es sich in Protokollen, Korrespondenzen, Verfügungen, Entscheiden, Abstimmungen usw. manifestiert. Dies heisst nicht, dass sich analytisch nicht
eine besondere Spezies von Zeichen, die […] über sich selbst hinaus auf etwas anderes, auf einen grösseren Zusammenhang verweisen, also sprachliche Metaphern, Bilder, Artefakte, Gebärden, komplexe symbolische Handlungssequenzen wie Rituale und Zeremonien, aber auch symbolische Narrationen usf. 106
unterscheiden liesse. Zu dieser besonderen Kategorie von Zeichen gehören das Kollektivsymbol «Bodenständigkeit/bodenständig» oder das Fahnenwort Gemeindeautonomie. So wird zu zeigen sein, wie die Gemeindeautonomie als identitätsstiftender Kampfbegriff «bewusst gewählt und dezidiert verwendet» wurde, um «in Konfliktsituationen, aber auch für das Selbstverständnis ‹Flagge zu zeigen›». 107Auch am Auftauchen des Begriffs «Bodenständigkeit/bodenständig» soll dargestellt werden, wie dieser Komplexität reduzieren und realitäts- und identifikationsstiftend wirken konnte. Anders als dem Fahnenwort Gemeindeautonomie kam ihm als Kollektivsymbol die Funktion zu, mehrere Diskurse miteinander zu verbinden. 108Gilt es bei beiden einerseits die historische Herkunft zu klären, können andererseits sowohl die Gemeindeautonomie als auch die «Bodenständigkeit» zeigen, «welch fundamentale Rolle symbolische Praktiken und diskursive Strukturen schon bei der Konstitution von politischen Institutionen, Ordnungskategorien, Geltungs- und nicht zuletzt Herrschaftsansprüchen spielen». 109
5. Es gehört schliesslich zu den fundamentalen Einsichten diskurstheoretischer Ansätze, dass Wissen zirkuliert. Erstens bedeutet dies, dass Wissen keinen Ursprung an einem einzigen Ort hat, der womöglich zwingend mit der akademischen Wissenschaft zu identifizieren wäre, auch wenn rationales Wissen seinen «Kristallisationskern» seit der Moderne in den sich ab dem 19. Jahrhundert etablierenden Wissenschaften findet. Doch selbst um diesen «Kristallisationskern» herum entwickelt und verändert sich Wissen «immer wieder neu durch die Zirkulation zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Sphären, bis es sich darin möglicherweise ‹verbraucht› und wieder verschwindet». 110
Zweitens folgt daraus, dass Wissen einen hybriden Charakter hat. Wissen ist daher nie in einer Reinform vorhanden, vielmehr ist davon auszugehen, dass sich «auch in gut begründeten wissenschaftlichen Systemen» häufig «mehr oder weniger deutliche Spuren der Herkunft, der kulturellen, politischen oder sozialen Existenzbedingungen von Wissen» finden. 111
Am Ende dieser theoretischen Überlegungen ist zu fragen, was diese erkenntnistheoretischen Überlegungen für die eigene wissenschaftliche Forschung bedeuten. Es liegt auf der Hand, dass auch eine Kulturgeschichte der Politik nicht «ausserhalb» ihres Forschungsgegenstandes steht. Vielmehr konstruiert sie «die eigene ‹Objektivität› nicht anders als andere Akteure». 112Wenn sich diese Untersuchung auch auf das «genaue Beobachten von Unterschieden» beschränken will, so ist bereits dieser Vorgang durch die Auswahl des Untersuchungsgegenstandes oder normative (Vor-)Annahmen geprägt, während Explikation und Argumentation sich an wissenschaftlichen Kriterien der Sachlichkeit, Informativität, Präzision und Relevanz orientieren, mit denen man sich bei einem umstrittenen Gegenstand wie den Bürgergemeinden zwangsweise «unbequem» machen wird. 113
1.4 Blinde Flecken der Bündner Geschichte
Bei der Gemeinde hat man es mit einem der prominentesten Gegenstände der Bündner Geschichte zu tun. Deshalb müsste, so der Frühneuzeithistoriker Jon Mathieu, eine vollständige Liste der Darstellungen zum Thema «wohl fast alle umfassen, die sich irgendwie mit Bündner Geschichte in unserem Zeitraum beschäftigten». 114Mathieus Einschätzung gilt indes nicht nur für die Frühneuzeit, wenn auch seiner Bemerkung etwas – vielleicht ungewollt – Typisches anhaftet: Die Bündner Geschichtsforschung ist bis heute tendenziell auf die Frühe Neuzeit und das (Spät-)Mittelalter fokussiert. 115Untersucht wurden vor allem die im 15. Jahrhundert entstandenen Gerichtsgemeinden und ihre kleineren Einheiten, die Nachbarschaften.
Dabei hatte man es in Graubünden lange «mehrheitlich mit einem von historisch interessierten Juristen geprägten Geschichtsbild […]» 116zu tun. Insbesondere für eine Geschichte des Dualismus zwischen politischer Gemeinde und Bürgergemeinde sind diese Darstellungen wichtig, da sie die Entwicklung von den Nachbarschaften zu den modernen (Bürger-)Gemeinden miteinbezogen und Fragen der Gemeindeautonomie erstmals hier auftauchten. Oft nahmen die historisch argumentierenden Juristen sogar explizit Stellung zu den zeitgenössischen Problemen des rechtlichen Verhältnisses zwischen Gemeindebürgern und Niedergelassenen. Es scheint daher sinnvoll, diese Untersuchungen bis in die 1970er-Jahre als Quellen für eine Abgrenzungsgeschichte der Bündner Gemeinden heranzuziehen.
Wie sieht es demgegenüber mit der neueren Bündner Geschichtsforschung aus? Aus einem gewissen zeitlichen Abstand behandelte Peter Metz’ Geschichte des Kantons Graubünden Anfang der 1990er-Jahre politik- und verfassungsgeschichtlich die Entstehung des Niederlassungsgesetzes von 1874 und einige Aspekte des damit gekoppelten Konflikts um die Bürgergemeinden. 117Im Gegensatz dazu lassen das vierbändige Handbuch der Bündner Geschichte 118(2000) oder der Sammelband Gemeinden und Verfassung 119(2011) das Phänomen «Bürgergemeinde» praktisch gänzlich ausser Acht. Wenig mehr als statistisches Datenmaterial zum Thema liefert Adrian Collenbergs wirtschafts- und sozialgeschichtliche Untersuchung von Trun, Andeer und Saas im Prättigau. 120Andere, über die Einzelgemeinde hinausgehende kultur- oder sozialgeschichtliche Monografien der modernen Bündner (Bürger-)Gemeinden fehlen. 121Das bedeutet auch, dass die spezifisch ortsbürgerlichen Werte und Praktiken im Bereich der Einbürgerungs-sowie der Boden- und Wasserrechtspolitik bisher nicht Gegenstand der Bündner Forschung waren. 122Für die Einbürgerungspolitik rücken damit die umfangreichen Studien zum Schweizer Bürgerrecht in den Fokus. Diese bieten eine wertvolle Grundlage für den Vergleich der Einbürgerungspolitik der Bürgergemeinden mit jener des Bundesstaats, konzentrieren sich jedoch in den Fallbeispielen ausschliesslich auf die grossen Schweizer Städte. 123
Читать дальше