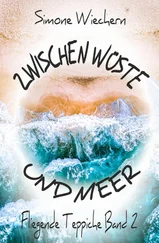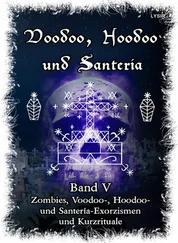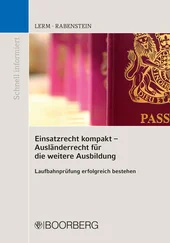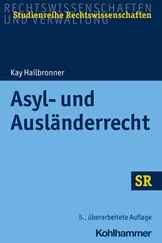Einbürgerungs-, Boden- und Wasserrechtspolitik
Neben dieser Geschichte des Streits um Eigentumsrechte und Kompetenzen in den Bündner Gemeinden bieten die Einbürgerungs-sowie die Boden- und Wasserrechtspolitik einen Zugang zu den Werten, Funktionen und Selbstbildern der Gemeindebürger in wichtigen Domänen ihrer behördlichen Praxis. Sie liefern weitere Hinweise darauf, wie sie sich nicht nur von den Niedergelassenen, sondern auch von den Ausländern abgegrenzt haben.
Der Befund, dass die rechtliche Abgrenzung innerhalb der Bündner Gemeinden regional und zeitlich unterschiedlich realisiert wurde, lässt sich nicht zuletzt an diesen tagespolitischen Praktiken ablesen: Das behördliche Tagesgeschäft konnte durchaus zur Herausbildung des Dualismus von politischer Gemeinde und Bürgergemeinde beitragen, indem sich die Korporation der Gemeindebürger ihren Status als autonome «Gemeinde in der Gemeinde» an diesen Orten immer wieder stabilisierte. Vor allem die Boden- und Wasserrechtspolitik einzelner Gemeinden diente neben Aussagen zur bürgergemeindlichen Einbürgerungskompetenz der Selbstbehauptung dieser Institution in Abgrenzung zu (möglichen) Ansprüchen der politischen Gemeinde. Besonders deutlich wird das bei der Bodenpolitik am Übergang von einer landwirtschaftlich geprägten zu einer industrialisierten Gemeinde. Während über die Frage, ob das Gemeindevermögen für industrielle Zwecke zu nutzen sei, innerhalb der Gemeinden kaum Dissens entstand, konnte die Frage, wem das Eigentum daran oder die Entscheidungskompetenzen darüber zukomme, Abgrenzungs- oder Trennungsmechanismen in Gang setzen. Auch in der seit 1900 entstehenden Kraftwerkindustrie traten Gemeinden als neue Akteure im lokalen Machtgefüge auf. Unter der Vielzahl von Akteursgruppen (Gemeinde, Kanton, Bund, Heimatschutzkreise und andere) fällt auf, dass sich Bürgergemeinden in allen untersuchten Fällen Handlungskompetenzen aneigneten, die ihnen de jure nicht zugefallen wären. Obwohl sich ihre Interessen mit denjenigen der Gesamtgemeinde vollständig deckten, setzte das altrepublikanische Verständnis der Gemeindebürger ein von der politischen Gemeinde getrenntes Vorgehen in Gang.
Darüber hinaus lässt sich an der Einbürgerungspolitik nach 1874 die Haltung der Bündner Gemeindebürger den Ausländern gegenüber darstellen, die überwiegend von Abgrenzung geprägt war. Bei den Gemeinden hat die Forschung zu Recht starke Partikularinteressen 64festgestellt. In erster Linie seien sie darauf bedacht gewesen, «ihre Gemeindegüter zu mehren, die Zahl der daran berechtigten Personen, das heisst der Gemeindebürger, beschränkt zu halten und die kommunalen Kompetenzen gegenüber den Kantonen zu verteidigen». 65Neben ökonomischen Ausschlusskriterien konnte die Religion oder die Gesundheit ein Grund sein, Bürgerrechtsbewerbern ihren Wunsch zu verwehren. Die Spannung zwischen Integration und Ausschluss der Zugezogenen beschränkte sich also mitnichten auf den Konflikt um die Integration der Schweizer Niedergelassenen durch die Schaffung von Politischen Gemeinden im Jahre 1874. Die demokratische Mitsprache wurde genauso über die Verleihung des Bürgerrechts gesteuert, die oft eine Abgrenzung gegenüber Schweizern und Ausländern zur Folge hatte. Darüber hinaus finden sich in Graubünden seit dem Ersten Weltkrieg Beispiele einzelner Gemeinden, deren monetär orientierte Einbürgerungspolitik eine gänzlich andere Praktik zur Folge hatte.
So wie in der Geschichte des Bündner Gemeindedualismus wäre es in der Analyse der Schweizer und Bündner Einbürgerungspolitik verfehlt, der Entwicklung eine einfache Dichotomie liberaler Öffnung «von oben» und vormoderner Abschliessung «von unten» zu unterstellen. Von den erwähnten Ausnahmegemeinden abgesehen, ging die im Regelfall tatsächlich dominierende «Abgrenzung von unten» oft Hand in Hand mit einer «Schliessung von oben», da auch dem Inklusionspotenzial des 1848 auf liberal-aufklärerischer Basis geschaffenen Bundesstaats bereits früh diverse Defizite inhärent waren. Unter dem Einfluss der «neuen Rechten» entwickelte die Schweizer Bundespolitik nach dem Ersten Weltkrieg eine «protektionistische und antiliberale Tendenz», die sich unter anderem durch eine auf Ausschluss bedachte Bürgerrechtspolitik konstituiert hat – und zum Teil bis in die heutige Zeit anhält. 66Die Bürgerrechtspolitik gehörte damit nach dem Ersten Weltkrieg zu jenen Diskursen, bei denen Affinitäten zum in dieser Zeit ebenfalls verstärkten protektionistischen Sprechen über die Rechtsprivilegien der Gemeindebürger feststellbar sind. Mit anderen Worten: Die in den «Krisenjahren der klassischen Moderne» in der Schweiz entstandenen kulturprotektionistischen Diskursmuster wurden von den Gemeindebürgern bisweilen für ihre Einbürgerungspolitik übernommen und dabei oft als Mittel der Abgrenzung ihrer Institution gegenüber der politischen Gemeinde eingesetzt.
Eine andere Abgrenzungsgeschichte: Vereine, Wirtschaft und Brauchtum
Als Abschluss eröffnet die Untersuchung einen dritten Anschluss an das Thema. Es geht darum zu zeigen, wie sich ein Selbstverständnis der Gemeindebürger ausserhalb des Wirkungskreises der Bürgergemeinde in verschiedenen Vereinen, in der Churer Unternehmerschaft und in der Praxis des Brauchtums stabilisieren konnte. Die wichtigste Institutionsform, in der sich eine solche Abgrenzungsgeschichte abspielen kann, ist der Verein. Zunächst einmal zeigt die relative Häufigkeit von Gemeindebürgern in bildungsbürgerlichen Vereinen und in der Churer Unternehmerschaft, dass die Gemeindebürger sozial dank Besitz und Bildung eine verhältnismässig privilegiertere Ausgangslage als Niedergelasse und Ausländer genossen.
Da die hier infrage kommenden Vereine und das Erwerbsleben nicht den Gemeindebürgern vorbehalten waren, ist das damit zusammenhängende Selbstverständnis der Gemeindebürger viel weniger offensichtlich. Dadurch, dass die Gemeindebürger in diesen Vereinen und in der Churer Unternehmerschaft eine relative, im Vorstand des Stadtvereins Chur und der Historisch-antiquarischen Gesellschaft gar in langen chronologischen Phasen eine absolute Mehrheit stellten, konstituierten sie «feine Unterschiede» zu den niedergelassenen Schweizern und Ausländern. Besonders in den Vereinen behielten sich die Gemeindebürger so über die Bruchlinie von 1875 hinaus ein eigenes Selbstverständnis, denn als Förderer von Geschichte und Gemeinwesen entsprach eine Mitgliedschaft oder die aktive Mitarbeit in der Historisch-antiquarischen Gesellschaft und im Stadtverein Chur einem Selbstbild der Gemeindebürger, wie es seit dem 19. Jahrhundert immer wieder für den Erhalt ihrer Rechtsprivilegien ins Feld geführt worden war. «Feine Unterschiede» zwischen ihnen und den Zugezogenen etablierten die Gemeindebürger schliesslich in der Praxis des Brauchtums, wenn sie beispielsweise wie in Domat/ Ems allein prestigeträchtige Ämter in einem wichtigen Verein wie der Knabenschaft besetzten.
1.2 Aufbau der Untersuchung
Kapitel 2stellt die Herausbildung des Freistaats der Drei Bünde seit dem Spätmittelalter dar. Im Zentrum stehen aber nicht so sehr die Gerichtsgemeinden, sondern der nachbarschaftliche Kommunalismus, da er die eigentliche Grundlage für die lokale Gemeindeautonomie und den Ausschluss der Hintersassen lieferte. Anschliessend gilt es die ersten Spannungen zu umreissen, die sich ergeben haben, als diese altrepublikanischen Demokratievorstellungen im Zuge der Aufklärung und der Französischen Revolution auf moderne Staatsvorstellungen trafen.
Die Kapitel 3bis 6erzählen in chronologischer Form die Geschichte des Streits um Eigentumsrechte und Kompetenzen zwischen Gemeindebürgern und Niedergelassenen, wobei Kapitel 6mit den Bürgervereinen Chur und Igis bereits eine Scharnierfunktion zu den Aktivitäten der Gemeindebürger jenseits dieser Konfliktgeschichte erfüllt. Kapitel 3zeigt, wie die politische und wirtschaftliche Gleichstellung aller mündiger Schweizer Männer zunächst in der Stadt Chur ein zentrales Problem innerhalb dieses Feldes von allein partizipationsberechtigten Gemeindebürgern auf der einen und demokratischen Erneuerern auf der anderen Seite wurde. Das kantonale Niederlassungsgesetz 1874 brachte den entscheidenden Bruch und eine bis auf wenige Ausnahmen vollständige politische und ökonomisch-rechtliche Gleichstellung aller männlichen Schweizer Gemeindebewohner. Dennoch führten die wenigen den Gemeindebürgern verbliebenen Privilegien vielerorts zum bis heute bestehenden Gemeindedualismus von politischer Gemeinde und Bürgergemeinde. Alsbald kam es zu den ersten Rechtsprozessen zwischen diesen beiden Körperschaften, die unmittelbar damit zusammenhingen, dass die Rechtsstellung der Bürgergemeinde und ihr Verhältnis zur neuen politischen Gemeinde durch das Niederlassungsgesetz und die späteren Kantonsverfassungen ambivalent blieben. 67
Читать дальше