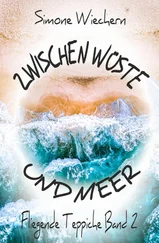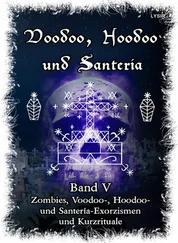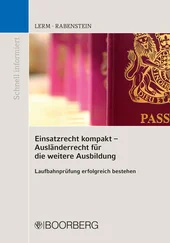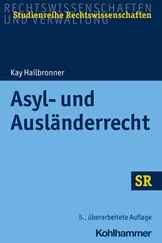Neben juristischen Argumenten zielte die Argumentation des Bürgerrates auf Elemente des «bürgerlichen Wertehimmels». Vertreten durch ihren ersten Bürgermeister Jakob Risch und Bürgerratsschreiber Hieronymus Salis, 264versuchte er «die wirkliche Absicht der Stifter» zu beweisen und gab zu bedenken, dass «wohl wenige Leute in der Zukunft zu solchen Opfern» bereit seien, falls «von einer Administrativbehörde seine Institution missachtet, seine Urkunde beseitigt oder falsch ausgelegt, seine Stiftungsverwaltung aufgehoben und das gestiftete Vermögen der Gemeinde inkorporirt wird, der er es nicht geben wollte». 265
Der Bürgerrat sprach damit das mäzenatische Handeln der 134 ehemaligen Zünfter an. 266Ein zentrales Moment bürgerlichen Mäzenatentums war, «Fehlentwicklungen in der modernen Gesellschaft» 267zu steuern, also da einzugreifen, wo sich der Staat ungenügend engagierte. Im konkreten Fall bestand die Absicht von 1841 in der «Bildung und Veredlung unserer Jugend», wobei umstritten war, ob nur den Churer Gemeindebürgern das Schulgeld für ihre Kinder erlassen werden sollte. Eine solche exklusive Verwendung des Fonds hatte jedoch nie stattgefunden. 268So oder so bestand der «Bürgersinn» dieser Mäzene in der zukünftigen Sicherung des Gemeinwohls. Dieses Engagement der Gemeindebürger lohnte sich vor allem deswegen, weil es den Verlust ihrer zünftischen Rechtsprivilegien teilweise kompensierte: Sie erkauften sich mit Geld Kulturprestige, das sie mit ihren zünftischen Rechtsprivilegien wenige Jahre davor verloren hatten. Die Stiftung war ähnlich wie der fast gleichzeitig (1842) gegründete Bürgerverein ein bewusster Zusammenschluss eines grossen Teils der Gemeindebürger zur Sicherung ihrer sozialen und kulturellen Hegemonie nach Ende der Zunftverfassung.
Der Stadtrat, vertreten durch den Stadtpräsidenten und Churer Gemeindebürger Albert Wassali, argumentierte in seiner Vernehmlassung vom 3. Januar 1884 ebenfalls mit dem «Bürgersinn» der Stifter. Er liess aber das Argument des Bürgerrates, eine «Sorge auch für die nichtbürgerlichen Einwohner» habe «keineswegs in dem Geiste und den Anschauungen der damaligen Zeit» gelegen, nicht gelten. 269Den Stiftern habe vielmehr eine liberal-universalistische Entwicklung der modernen Gesellschaft vorgeschwebt: Der damalige Amtsbürgermeister Simeon Bavier biete «Gewähr» dafür, dass das Zunftvermögen nach Ende der Zunftverfassung nicht nur den Gemeindebürgern gestiftet worden sei, vielmehr hätte Bavier so etwas «in seinem ächt liberalen Sinne» abgelehnt, sodass «es geradezu als unverdiente Beleidigung seiner Manen erscheint, jenem Beschlusse so engherzige Motive unterzuschieben». 270
Der Rekurs der Bürgergemeinde an den Grossen Rat blieb schliesslich erfolglos. Endgültig wurde der Streitfall jedoch erst 1885 vor Bundesgericht entschieden. Die Bürgergemeinde musste den Schulfonds mitsamt den Erträgen der letzten zehn Jahre der Stadt übergeben – summa summarum über 312 000 Franken. 271
Der Churer Schulfondsstreit blieb im 19. Jahrhundert der einzige über mehrere Instanzen geführte Rekurs zwischen einer Bürgergemeinde und einer Politischen Gemeinde. Er macht aber noch einmal deutlich, dass die beiden Institutionen, hervorgegangen aus einem Niederlassungsgesetz, das für die modernen Ansprüche der Gemeindeorganisation nicht ausgelegt war, über die Interpretation dieses Niederlassungsgesetzes zu streiten begannen. Allein schon die Institutionalisierung von Bürgergemeinden, die es gemäss mehreren offiziellen Verlautbarungen in den kantonalen Behörden nicht geben sollte, machte ein ortsbürgerliches Bewusstsein deutlich, mit dem der Kanton weiterhin rechnen musste. Zu welch heftigen Streitigkeiten der Bündner Gemeindedualismus ab den 1920er-Jahren noch führten sollte, ahnten die Regierungsräte und Grossräte des Fin de Siècle vermutlich noch nicht.
4 Die kurze Reaktion der 1890er-Jahre
In den 1890er-Jahren kam neuer Unmut über das kantonale Niederlassungsgesetz auf. Gleich zwei Mal wurde versucht, mit sogenannten «Bürgerinitiativen» die umstrittene Regelung zu revidieren. Treibende Kraft war ein prominenter Nachkomme der vormodernen Führungsschicht Graubündens: Theophil Sprecher von Bernegg, der spätere Generalstabschef im Ersten Weltkrieg. 1Das Kapitel zeigt, wie der Maienfelder als Teil der in der Schweiz im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts aufkommenden «neuen Rechten» versucht hat, den immer noch «unbewältigten Rechtszustand» 2der internen Organisation der Bündner Gemeinden zugunsten der Gemeindebürger zu normieren. Mit dem staats- und modernisierungskritischen Gestus dieser «reaktionären Avantgarde» veränderte sich der Diskurs um das Rechtsverhältnis von Gemeindebürgern und Niedergelassenen in Graubünden. Anstelle des Austarierens von Werten wie «Bürgersinn» oder spiessbürgerlichem «Eigensinn» rückten nun die bereits punktuell angesprochenen «alten Rechte der Bürger» in den Vordergrund, gepaart mit dem seit 1896 von katholisch-konservativer Seite rechtswissenschaftlich fundierten Fahnenwort der Gemeindeautonomie. Zwei weitere Merkmale tauchten mit Sprechers «Bürgerinitiativen» auf und trugen ebenfalls dazu bei, den politischen Diskurs um die Bürgergemeinde auf eine neue Ebene zu führen: Die Gegner des Niederlassungsgesetzes stellten nun nicht mehr nur dessen Nachteile für die Gemeindebürger infrage. Sie konstruierten vielmehr eine prinzipielle Frontstellung zwischen Altrepublikanismus und Etatismus, das heisst in diesem Fall zwischen autonomen Bürgergemeinden und einem als liberal-zentralistisch empfundenen Kanton – ein Spannungsverhältnis, das natürlich spätestens seit Mitte der 1870er-Jahre vorhanden, bisher aber nicht kontrovers debattiert worden war. Die Auseinandersetzung um den Wert und die Bedeutung der Bündner Bürgergemeinden wurde zudem zur scharfen Gegenreaktion, ja zu einem «Krieg der Bürger», 3wie ihn die bisherige Auseinandersetzung um das Rechtsverhältnis zwischen Gemeindebürgern und Niedergelassenen in Graubünden noch nicht erlebt hatte. Die Diskussion im Vorfeld der Abstimmung um die zweite Bürgerinitiative Ende 1899 war mit ihren Metaphern des Kampfes der vorläufig letzte Höhepunkt in diesem Diskurs. Abschliessend kehre ich mit dem Abstimmungsergebnis von 1899 noch einmal zur Bedeutung der Gemeindeautonomie zurück. Dank der Konjunktur dieses seit dem ausgehenden Jahrhundert zwischen populärer und wissenschaftlicher Wissensformation zirkulierenden Begriffs fand die zweite «Bürgerinitiative» auch in katholisch-rätoromanischen Gemeinden Aufnahme, obwohl diese meist einen geringen Grad an Niedergelassenen aufwiesen und noch 1874 für das liberale Niederlassungsgesetz gestimmt hatten.
4.1 Mit den «alten Rechten» gegen den «Allerweltskulturstaat»
Gemessen an ihrer restriktiven Verwaltungspraxis bestand in der Stadt Maienfeld bereits vor dem Niederlassungsgesetz von 1874 ein ausgeprägtes ortsbürgerliches Bewusstsein. So war in Maienfeld um die Mitte des 19. Jahrhunderts zum Beispiel die Abgabe von Brennholz an die Niedergelassenen verboten, während zahlreiche andere Gemeinden dies liberaler als die Bestimmungen des Niederlassungsgesetzes von 1853 handhabten. 4Welche Bedeutung die altrepublikanische Korporation in Maienfeld hatte, zeigt nicht nur die spätestens in den 1890er-Jahren mit der Statuierung eines Maienfelder Bürgerrates vorgenommene institutionelle Abgrenzung zwischen politischer Gemeinde und Bürgergemeinde. 1893 stellte der Maienfelder Bürgerrat im Vorfeld der ersten Volkswahl der Bündner Regierung gar ein Ausschreiben an die Herren Vorsteher der ehrs. Bürgergemeinde auf. In diesem für die Geschichte der Bündner Bürgergemeinden singulären Dokument wurde allen Gemeinden, die «auf Erhaltung ihrer alten und guten Rechte Werth legen», der Fläscher Regierungsstatthalter Thomas Marugg als Anhänger «des allgemeinen bündnerischen Bürgerprinzips und als Verfechter der Gemeinde-Autonomie» 5erfolgreich gegen den späteren Bundesrat Felix Calonder zur Wahl empfohlen. Immerhin war für den Maienfelder Bürgerrat «die angestammte Freiheit und Souveränität der bündnerischen Gemeinden eine der ehrwürdigsten und wertvollsten Grundlagen unseres kleinen Staatswesens», 6wie das Ausschreiben gleich einleitend klarmachte. In aller Deutlichkeit wurde jene Verbindung hergestellt, auf die bis dato in den Quellen nur am Rand oder indirekt hingewiesen wurde: Die Verteidigung der altrepublikanischen Rechtsprivilegien der Gemeindebürger wurde explizit zur Frage der Behauptung der Gemeindeautonomie gegen den Zugriff des etatistisch-liberalen Kantons gemacht.
Читать дальше