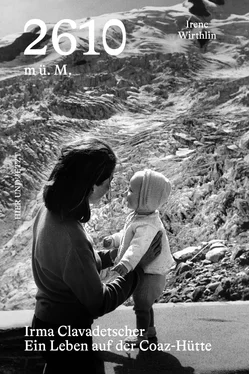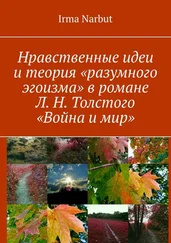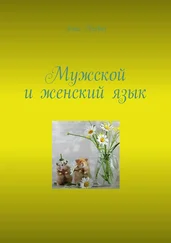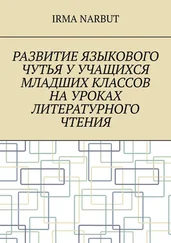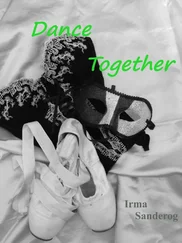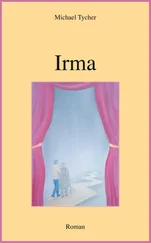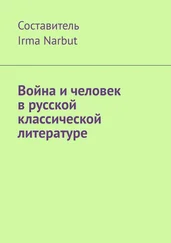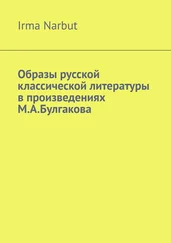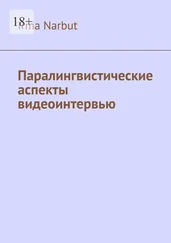Franz Müller und Sophie Kuster gingen zusammen in Schmerikon zur Schule. In ihr fand Franz später die ideale Ehepartnerin. Sophie wuchs als Zweitälteste von zehn Geschwistern auf einem Bauernhof, der Felsenburg, auf und lernte von Kindsbeinen an, hart zu arbeiten. Neben dem Bauernhof führten ihre Eltern eine Gastwirtschaft. Sophie half bei den Arbeiten auf dem Hof, betreute die jüngeren Geschwister und bediente in der Gastwirtschaft. Die Frage, welchen Beruf sie erlernen möchte, stellte sich nie. Als sie die Schule beendet hatte, begann sie ganz selbstverständlich, in verschiedenen Gastbetrieben am Obersee zu servieren, um für die Familie Geld zu verdienen.
Nach ihrer Heirat stellt sich heraus, dass sie für ihre Aufgabe als Ehefrau eines Handwerkers mit eigenem Betrieb und als Mutter von fünf Kindern bestens «ausgebildet» ist, denn sie hat Tag für Tag ein gewaltiges Arbeitspensum zu bewältigen: Sie wäscht – in den ersten Jahren gibt es noch keine Waschmaschine –, putzt und kocht drei warme Mahlzeiten am Tag. Zum Frühstück will der Vater zusätzlich zu Brot, Butter und Konfitüre Rösti oder Polenta, und das Mittagessen muss jeden Tag mit einer Suppe beginnen; hausgemacht, versteht sich, und es hat Punkt zwölf Uhr auf dem Tisch zu stehen. Daneben schreibt sie die Rechnungen und macht die Buchhaltung für das Geschäft. Ab und zu kommt Marie vorbei, um beim Bügeln oder Wäscheausbessern zu helfen. Und da sind ja auch noch die Kinder … Aber Sophie schafft das alles, und sie schafft es sogar, mit ihrer schönen Stimme eines der vielen Lieder, die sie kennt, zu singen, wenn sie nach dem Essen den Berg von Pfannen, Geschirr und Besteck abwäscht. Geschirr abtrocknen ist deshalb bei den Müller-Kindern weniger unbeliebt als anderswo.
Eine «Aufgabe», um die sie andere Frauen im Dorf beneiden mögen, fällt ihr fast schwerer als das Arbeiten: Ihr Mann erwartet von ihr, dass sie sich seiner Stellung im Dorf entsprechend kleidet – dezent, gediegen und elegant. Sie soll «etwas darstellen». Sie fühlt sich mit dieser Aufgabe gar nicht wohl, denn ihrem Wesen nach ist sie die einfache, bescheidene Bauerntochter geblieben. So wird sie jeweils von ihrem Mann begleitet, wenn sie nach Rapperswil fährt, um ihre Garderobe einzukaufen. Er will sicherstellen, dass alles, was sie kauft, von bester Qualität ist. Nach und nach kauft er ihr auch schönen Goldschmuck. Sie trägt beides, die Kleider und den Schmuck, zögerlich und immer etwas unsicher.
Ein Sonntag, vielleicht im Sommer 1952
Es ist halb neun Uhr an einem warmen, sonnigen Sonntagvormittag im Frühsommer. Im Hause Müller herrscht, wie jeden Sonntag um diese Zeit, eine gewisse Hektik. Der Vater ist nirgends zu sehen, aber alle wissen, dass er die ganze Familie um Punkt 8.45 Uhr vor der Haustür erwartet, sonntäglich gekleidet zum Besuch des Gottesdienstes in St. Jodokus. Die Mutter ist bereits in ihrem Sonntagsstaat: hellbeiges Deuxpièces mit passender Seidenbluse, einen hellbeigen, modischen Hut auf dem Kopf, braune Schuhe mit halbhohen Absätzen, eine cognacfarbene Ledertasche, gleichfarbige Lederhandschuhe, eine Perlenkette. Sie hält die kleine Uschi an der Hand, die ebenfalls ein Sonntagskleidchen trägt, und ermahnt Franz und Jakob, vorwärtszumachen. Franz findet seine Schuhe nicht, und das breite Grinsen auf dem Gesicht seines jüngeren Bruders zeigt ihm, dass der wohl etwas mit dem Verschwinden der Schuhe zu tun hat. «Warte», droht er ihm, «jetzt kriegst du’s!» Aber die Mutter steht schon dazwischen und schaut ihn bittend an. «Zieh halt die Werktagsschuhe an, sie sind ja frisch geputzt.» Inzwischen sind auch Hedi und Irma die Treppe heruntergekommen, Hedi in einem dunkelblauen Blazer, Irma in einem roten. Beide tragen ein weisses Béret und weisse Handschuhe. Hedi lächelt die Mutter an und anerbietet sich, die kleine Schwester zu tragen. Die will aber gerade jetzt nicht von Hedi, sondern von Mama getragen werden. «Nein, nein, nein», protestiert sie laut und klammert sich an Mamas Rock fest, die seufzend sagt: «Also, dann kommst du halt mit mir.» Irmas Gesicht, ohnehin schon düster, verfinstert sich noch mehr: «Die bekommt doch immer ihren Willen!», zischt sie Hedi zu, und die beiden Mädchen nehmen ihre Kirchengesangsbücher und verlassen das Haus. «Wie affig wir aussehen! Ich hasse diese blöden Handschuhe!», schimpft Irma wütend, verstummt aber sofort, als sie den Vater neben der Haustüre warten sieht.
Die Bibellesungen, die Predigt, die Gebete, die Eucharistiefeier, der Gemeindegesang: Für die Kinder will es kein Ende nehmen. Endlich braust die Orgel das Ausgangslied, und die Kirchentüre geht auf. Aber jetzt gehen das Bravsein und das Warten gleich weiter, denn der Vater wird von diesem begrüsst, von jenem etwas gefragt, und ein Dritter will ihm unbedingt noch etwas erzählen. Welche Erleichterung, als er der Mutter ein Zeichen gibt, sie solle doch mit den Kindern bereits nach Hause gehen. Kaum dort angekommen, reisst sich Irma die Sonntagskleider vom Leib; sie hasst das «Glump»!
Während des Essens – am Sonntag verlangt die Tradition einen Braten mit Sauce und Kartoffelstock – heisst es noch einmal: brav sein und warten. Die Kinder lieben zwar alle das «Saucenseeli», das die Mutter mit der Kelle in den Kartoffelstock drückt, aber irgendwann hält Jakob das Stillsitzen nicht mehr länger aus. «Dürfen wir heute nach der Christenlehre im See baden gehen, Mama?» – «Da musst du den Vater fragen.» – «Vater, dürfen wir heute Nachmittag im See baden gehen? Bitte!» – «Nein, heute nicht.» – «Aber warum nicht? Es ist so schön warm. Ach, bitte!» – «Ja, bitte, Vater!» – «Weil ich es sage.» Eine halbe Stunde später, während des Abwaschs in der Küche: «Mama, dürfen wir nicht doch baden gehen?» – «Ihr habt gehört, was der Vater gesagt hat.» – «Aber es ist so heiss und so langweilig hier, bitte, bitte!» – «Nun gut; ihr könnt es vielleicht noch einmal versuchen. Der Vater ist beim Nachmittagsjass im ‹Ochsen›. Einer von euch kann hingehen und ihn nochmals fragen.»
Möglich, dass der Vater dann gut gelaunt sagt: «Gut, aber pünktlich um halb sechs seid ihr alle wieder zu Hause!» Oder vielleicht sagt er auch: «In einer halben Stunde bin ich zu Hause. Macht euch bereit. Wir machen einen Ausflug.» Und dann steigt die ganze Familie in den schwarzen Mercedes, und der Vater steuert Richtung Uznach, Rickenpass dem Appenzellerland zu. Irgendwann wird haltgemacht für eine kurze Wanderung und Einkehr in einem Restaurant. Und die Kinder, denen, eingepfercht auf dem Rücksitz, meist übel wird, träumen vom Baden im See.
Einen dieser Ausflüge wird Irma nie vergessen. Man besucht einen entfernten Verwandten des Vaters, den die Kinder nicht kennen, in der psychiatrischen Klinik im sankt-gallischen Wil. Die Kinder werden nicht informiert über die Art des Besuchs und erwarten eine Einladung zu Kaffee und Kuchen oder etwas Ähnliches. Als der Vater vor einem grossen Gebäude hält, erschrecken sie zuerst über die vergitterten Fenster und später über die Gesichter der Menschen, die sie in den langen Gängen antreffen. Am allermeisten aber ängstigen sie die unartikulierten Laute, die Schreie und das Jammern, das aus einigen der Zimmer zu hören ist. Irma läuft entsetzt davon, zurück zum Auto, und versteckt sich in einem nahen Gebüsch. So etwas Schlimmes hat sie noch nie gesehen oder gehört. Sie ist zutiefst schockiert. Niemals will sie so eingesperrt sein! Niemals überhaupt in irgendeiner Weise eingesperrt sein! Das schwört sie sich.
Die grosse, weite Welt
Im Juni 1948 hob auf der ersten Piste des neuen Flughafens Zürich Kloten erstmals eine DC-4 nach London ab, und wenige Monate danach wurde die 2,6 Kilometer lange Blindlandepiste feierlich eingeweiht, im Beisein geladener Gäste aus Politik und Medien. Weitere fünf Jahre später bestand der Flughafen bereits aus einem zentralen Passagiertrakt, flankiert von einem Restaurant und Bürotrakt, und einer grossen Zuschauerterrasse. Die Flugzeuge vor den Hangars zu bestaunen, die Start- und Landemanöver zu beobachten, war bald eine grosse Attraktion für die Bevölkerung von Zürich und Umgebung. Für viele Familien war der Sonntagsausflug zum Flughafen ein Höhepunkt des Jahres, und an schönen Sommersonntagen war die Zuschauerterrasse oft überfüllt, und manch einer träumte davon, in einem der startenden Flugzeuge zu sitzen und an einen exotischen Ort dieser Welt zu fliegen. Aber das war damals ein Privileg für wenige Auserwählte und Reiche. Die Männer und Knaben bestaunten die Maschinen und versuchten, sich gegenseitig mit fachmännischen Kommentaren zu überbieten, die Mädchen und jungen Frauen bewunderten die gross gewachsenen, schlanken Frauen in den eleganten, graublauen Uniformen, mit ihren gepflegten Frisuren und den kecken Hütchen. Jedes Härchen sass exakt da, wo es sollte, und die Lippen waren allesamt perfekt und leuchtend rot geschminkt. «Stewardessen» nannte man sie, und sie verkörperten für viele junge Mädchen einen Traum: den Traum von Eleganz, Schönheit, Exklusivität, von Weltoffenheit und Abenteuer. Ein Beruf, der gar nichts mit Arbeit zu tun zu haben schien, sondern eher eine Startposition darstellte, um bald von einem attraktiven, wohlhabenden und weit gereisten Mann entdeckt und geheiratet zu werden.
Читать дальше